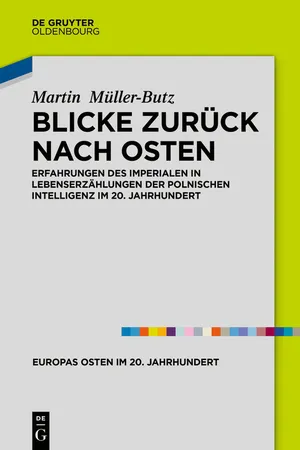1 Einleitung
In der Zeit des Zweiten Weltkriegs verfasste der polnische Schriftsteller Stanisław Stempowski (1870 – 1952) seine Memoiren und äußerte sich in ihnen über seine Kindheit in der Zeit des Russischen Imperiums in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Stempowski entstammte einer wohlhabenden Familie des polnischen Landadels in der Nähe von Kamenec-Podolʼskij (heute ukr. Kamʼʼjanecʼ-Podilʼsʼkyj) in der südwestlichen Peripherie des Russländischen Reiches und wuchs dort in einer ukrainisch geprägten Umgebung auf. In seinen Memoiren schreibt er über den väterlichen Gutshof und zwei dort wohnende Verwandte seiner Mutter, Tytus und Samson Bieńkiewicz:
Eben jener Tytus war auf einer Offiziersschule in Warschau gewesen, er hatte bei Ostrołęka, Dębie Wielkie und bei Grochów [gemeint sind die Schauplätze der Kämpfe zwischen Aufständischen und russischen Soldaten nach dem Warschauer Novemberaufstand 1831, M.-B.] gekämpft. […] Der Hauch der lebendigen alten Zeit, der auf mich von dieser grimmigen, hochmütigen Gestalt überging, fand sich in mir nach vielen Jahren wieder und spielte vielleicht auch eine Rolle in meiner nationalen Wiedergeburt. Der jüngere Bruder Samson war nach dem Krieg von 1831 zum russischen Militär eingezogen worden und hatte irgendwo im Osten als Offizier gedient. Unter den vielen Orden trug er auch eine Brosche für 25 Jahre Dienst, die dem Träger das Privileg verlieh, dass man ihn nur in Begleitung einer Regimentsdelegation mit Standarte verhaften durfte. Er erzählte, wie ihm die Brosche geholfen hatte, nachdem er im Streit mit einem Soldaten in einem Klub diesen durchs Fenster rausgeschmissen hatte. Nun war er pensioniert, es ging ihm gut und sicher half er dem armen Tytus, als sie gemeinsam in dem Haus wohnten. Einmal fuhr er zu uns nach Huta in seiner Paradeuniform mit all seinen Orden und dem Säbel – so blieb er mir im Gedächtnis, und immer dann habe ich sein Bild vor mir, wenn ich auf den ‚Vergifteten Brunnen‘ von Jacek Malczewski schaue.2
Mit der Erwähnung der beiden Vorfahren Tytus und Samson und ihrer beiden konträr verlaufenden Biographien eröffnet Stempowski der Leserschaft einen besonderen Blick in das vielschichtige Panoptikum der russisch-polnischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Nicht nur liefert er mit der Vorstellung zweier Vertreter einer nach den Teilungen Polens geborenen Generation biographisches Anschauungsmaterial dazu, in welchem Maße sich die russischen Machtverhältnisse in den östlichen Teilungsgebieten Polens und der Widerstand gegen diese bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die individuellen Lebenswege zweier polnischer Männer auswirken konnten – Tytus, der ältere von beiden, kämpft schließlich als polnischer Aufständischer aufseiten der Rebellen im Novemberaufstand von 1831 und wird zur Strafe in den Osten Russlands verbannt, während der jüngere Samson nach der Niederlage der Rebellen als Offizier in den lebenslangen Dienst des Russischen Imperiums tritt.
Mit dieser Wahl ist in Stempowskis Lebenserzählung zugleich eine Entscheidung getroffen, wem der beiden seine Sympathien gelten sollen. Der Autor legt mit dem Verweis auf den fünfteiligen Bilderzyklus Vergifteter Brunnen von Jacek Malczewski (1854 – 1929) von 1905 und 1906 und der Gleichsetzung von Samsons Biographie und dem Motiv des vergifteten Brunnens Spuren hin zu einem national-moralistischen Diskurs der polnischen Intelligenz um das eigene Selbstverständnis, der von der Frage um die angemessene Haltung zu den Teilungsmächten, insbesondere zum Russischen Imperium geprägt war. Die polnische Literaturwissenschaftlerin Maria Janion (geb. 1926) hat diesen Diskurs folglich als Ausdruck einer „moralischen Überlegenheit gegenüber dem ehemaligen Folterer“ beschrieben, als eine Haltung, die sich in der Zeit der polnischen Staatenlosigkeit und der Herrschaft Polens unter den europäischen Imperien entwickelte, und die sich aus der Erfahrung von der eigenen vergangenen Größe, dem Bezug auf das frühneuzeitliche Polen-Litauen und dessen Wahrnehmung als Zivilisator des Ostens speiste, und sich, wie Janion schreibt, bis weit in das 20. Jahrhundert erhielt3. Polens Verhältnis zum Osten beschreibt Janion denn auch als Komplex einer doppelten Erfahrung als Kolonisierer und als Kolonie: „Im 19. Jahrhundert von den Teilungsmächten kolonisiert, konnte man stolz darauf sein, einstmals selbst Kolonisator gewesen zu sein.“4 Mit dem Bezug auf Malczewski ordnet Stempowski seine Familienbiographie dem Konflikt zwischen vormaliger polnischer Größe und der Fremdherrschaft des späten Russländischen Reiches zu. Dabei unterstreicht er mit seinem Verweis auf die eigene „nationale Wiedergeburt“ die moralische Überlegenheit der Polen über die russische Teilungsmacht.5 Folglich identifiziert er sich mit Tytus und der Figur des anti-zaristischen polnischen Rebellen.
Das Zitat deutet lediglich an, wie sehr polnisches autobiographisches Schreiben zur Mitte des 20. Jahrhunderts immer noch bzw. wieder von der Auseinandersetzung der polnischen Intelligenz mit Russland als Teilungsmacht und mit der historischen Rolle Polens im Osten geprägt war. Stempowskis Memoiren entstanden in der Gegenwart eines durch das deutsche und sowjetische Herrschaftsregime gewaltsam geteilten und besetzten Polens. Die polnische Intelligenz sah sich nach dem Zerfall des Russischen Imperiums eben nicht nur mit dem Einfluss des russisch-imperialen Erbes auf das nationale Selbstverständnis und mit den eigenen biographischen Erfahrungen von der Krise und vom Zerfall des russischen Imperiums sowie vom Aufbau des freien Polens konfrontiert.6 Der sich rasch konsolidierende Nachfolgestaat im Osten, das sowjetische Russland, verfügte trotz der Geschichte des russischen Imperialismus mit seiner Botschaft einer sozialistischen Gesellschaft auch in Polen über eine immense ideologische Anziehungskraft, mit dessen Vision sich ausnahmslos alle Strömungen der Intelligenz auseinandersetzten.7
Für die Bevölkerung vor allem der westlichen Provinzen des früheren Russischen Imperiums waren dessen Zerfall, die Russische Revolution sowie der dann folgende Russische Bürgerkrieg und der Polnisch-Sowjetische Krieg oft gleichbedeutend mit dem Ende ihrer bisherigen Lebenswelten, mit ihrer Flucht und Vertreibung – die Betroffenen waren gezwungen, die Erfahrung vom Verlust ihrer Heimat und vom Zerfall der alten imperialen Ordnung angesichts der veränderten Verhältnisse in Polen in die eigene Biographie zu integrieren.8 Dass Heimat in der 1918 gegründeten Rzeczpospolita Polska (RP, Polnische Republik) aber nicht zu einer solch emotional aufgeladenen und öffentlichkeitswirksamen Kategorie emporgehoben wurde, wie etwa in Deutschland nach 1945 bzw. nach 1989, darauf hatten die Entstehung eines freien polnischen Staates nach mehr als einem Jahrhundert der Teilungen und der daraus resultierende Unabhängigkeitskult gehörigen Einfluss. Sie sollten die Erfahrung des Zerfalls der alten Gesellschaftsordnung zunächst überlagern.9 Ihr Übriges tat die Einführung einer nationalen Meistererzählung.10 Gerade in der polnischen Historiographie der Zwischenkriegszeit diente das Imperiale als negatives Gegenstück zum Nationalen. Deren Vertreter distanzierten sich von der imperialen staatenlosen Vergangenheit Polens als Makel der Nationalgeschichte, indem sie eine Geschichte des nationalen Martyriums unter der imperialen Herrschaft erschufen. In dieser Hinsicht bildete das unabhängige Polen im Vergleich zu den anderen „neuen“ Staaten Ostmitteleuropas keine Ausnahme.11 Dies demonstriert insbesondere der Verweis auf das Russische Imperium, dem eine Schlüsselfunktion zukam. Denn die nationale Opfererzählung kulminierte ganz besonders im Blick auf den Osten und schrieb dem Russischen Imperium die Rolle einer rückständigen Anti-Moderne zu.12 Welchen Platz wiesen also die polnischen Angehörigen der Intelligenz, die im späten Russländischen Reich sozialisiert wurden und dort gewirkt hatten, der eigenen Erfahrung vom Imperium und dessen Untergang sowie dessen westlichen Provinzen, dem ehemaligen polnischen Osten in ihren autobiographischen Schriften im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu?
1.1 Zur Fragestellung: Polnische Blicke nach Osten – das Fremde im Eigenen?
In den Darstellungen des Ostens in der polnischen Ideengeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, seien sie in der Literatur, in Memoiren und in der Forschung, haben Motive wie das der przyjaciele moskali (Moskoviter-Freunde), des sfinks (Sphinx), oder der czarna skrzynka (aus dem engl. black box) Tradition. Die Formel von den przyjaciele moskali geht auf ein Gedicht des polnischen Romantikers Adam Mickiewicz (1798 – 1855) Do przyjaciół Moskali (An die Freunde, die Moskoviter) aus dessen Erzählzyklus Dziady (Die Totenfeier) zurück, der Schriftsteller Władysław Jabłonowski (1865 – 1956) behalf sich der Beschreibung von Russland als sfinks in seinen gleichnamigen Aufzeichnungen über sein Leben in Russland, und der Begriff der czarna skrzynka stellt wiederum eine analytische Kategorie von Jens Herlth zur Beschreibung des polnischen Ostdenkens des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts dar.13 All diese Kategorien beschreiben die Ambivalenz des polnischen Denken bezüglich Russlands und des Ostens. An ihnen wird ersichtlich, dass, anders als in etlichen westlichen Diskursen Wahrnehmungen des Ostens in der polnischen Ideengeschichte nicht nur als Negationen von Selbstprojektionen, als Beschreibungen des Anderen zur Stärkung des Eigenen zutage traten (die sich auch in der polnischen Ideengeschichte finden lassen), sondern Ambivalenzen des Fremden und des Eigenen in sich vereinten.14 In diesen Wahrnehmungen fanden die Verhältnisse einer polnischen Dominanz aus der frühen Neuzeit im Osten ebenso Ausdruck, wie das als Besatzungsmacht wahrgenommene russisch-imperiale Teilungsregime, dessen Erfahrung es in solchen Projektionen zu kompensieren galt.15 Folgt man Maria Janion, verkörpern die kresy, die zur frühneuzeitlichen Rzeczpospolita gehörigen Ostgebiete, das „‚ost-westliche‘ polnische Bewusstsein“.16 In den Darstellungen der polnischen Literatur des 19. Jahrhunderts, so Janion, kulminierte die Ambivalenz des Eigenen und des Fremden insofern, als die kresy als Religions- und Kultur- oder als Zivilisationsgrenze sowie als Gebiet der polnischen Kolonisierung nach Osten mythisierend aufgeladen wurden – wie etwa in der Roman-Trilogie von Henryk Sienkiewicz (1846 – 1916).17 Die Vorstellung vom Grenzgebiet als Region der „Transkulturalisierung, der Hybridität und der Uneindeutigkeit“, wie sie bis zu den Teilungen Polens vorgeherrscht hatte, wurde so aufgeweicht.18 Die Zerrissenheit des polnischen Denkens zum Osten sieht Janion in der polnischen Literatur der Romantik letztlich auch in der Doppelrolle Polens und dessen geschichtlicher Zugehörigkeit zur christlichen Welt einerseits und zur slavischen Welt andererseits zum Ausdruck gebracht. In den Schriften Adam Mickiewiczs, Juliusz Słowackis (1809 – 1849) und anderer Literaten sei die Zugehörigkeit Polens zur slavischen Welt als verdrängtes Element wiederentdeckt worden und ihr zufolge ein Zeichen zerrissener Identität, welches sie mit der Formel von der „unheimlichen Slavizität“ benennt: „Die unheimliche Slavizität – fremd und nah zugleich – war Ausdruck der Zerrissenheit, eines unterdrückten Unterbewusstseins, einer mütterlichen, vertrauten unlateinischen Seite.“19
In der vorliegenden Arbeit soll Janions Perspektive auf das polnische Denken zum Osten für eine Untersuchung autobiographischer Schriften von jenen Angehörigen der polnischen Intelligenz im 20. Jahrhundert nutzbar gemacht werden, die auf eine eigene Erfahrung des Ostens, nämlich auf eine russisch-imperiale zurückblicken konnten und im Laufe ihres Lebens Versuche unternahmen, dieses autobiographisch zu ordnen. In den Schriften dieser Polinnen und Polen östlicher Provenienz, so die Leithypothese der Arbeit, verschmolzen Zeugenschaft, russisch-imperiale Erfahrung – die Erfahrung vom Leben im imperialen Russland, von dessen Zerfall und von der Integration in der neuen nationalstaatlichen Gesellschaftsordnung – und Autorinnen- und Autorenschaft vor dem Hintergrund des Diskurses um das polnische nationale Selbstverständnis und um die Frage der Östlichkeit darin zu einem Amalgam. Wie kam diese Erfahrung in den autobiographischen Schriften der polnischen Intelligenz zum Ausdruck? Auf welche Weise versuchten die Schreibenden, diese mit bestehenden polnischen Denktraditionen zu Russland und dem Osten zu vereinbaren, oder sich von diesen abzusetzen? Und inwiefern veränderten sich solche Erzählungen der russisch-imperialen Erfahrung infolge neuerer Erfahrungen und Zäsuren, wie den Ereignissen in Zwischenkriegspolen, den innersowjetischen Umwälzungen des Stalinismus, oder infolge späterer Zäsuren wie des Zweiten Weltkriegs und der anschließenden gesellschaftlichen Neuordnungen in der Volksrepublik Polen oder im Exil zur Zeit des sogenannten „Kalten Krieges“? Welchen Konjunkturen unterlagen diese Veränderungen?
Ziel der Untersuchung ist es nicht, den Diskurs zur polnischen nationalen Identität und dessen Muster und Verläufe zu analysieren, sondern vielmehr zu erfragen, in welchem Verhältnis individuelle Erfahrung, autobiographische Erzählung und Konzepte und Ideen nationalen Selbstverständnisses in den jeweiligen Lebenserzählungen stehen. Dabei sind der Begriff der Polonität und die Frage, ob sich in den Repräsentationen des O...