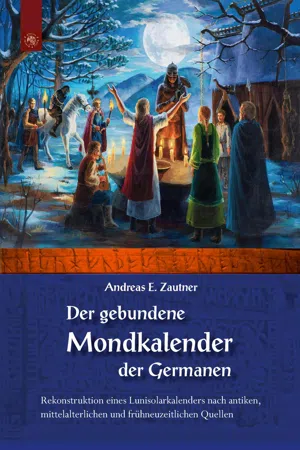
eBook - ePub
Der gebundene Mondkalender der Germanen
Rekonstruktion eines Lunisolarkalenders nach antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen
- 334 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Der gebundene Mondkalender der Germanen
Rekonstruktion eines Lunisolarkalenders nach antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Quellen
Über dieses Buch
Ein jeder von uns ist bestens vertraut mit dem nunmehr weltweit verbreiteten gregorianischen Kalender, der durch Reformierung des julianischen Kalenders entstanden ist. Bei beiden Kalendersystemen handelt es sich um reine Sonnenkalender, bei denen der Lauf des Mondes keinerlei Rolle für die Jahreszählung spielt. Doch vor der Einführung der reinen Sonnenkalender benutzten in Europa sowohl Römer, Griechen als auch Gallier und Germanen gebundene Mond- oder Lunisolarkalender, bei denen der Mond der maßgebliche "Jahrzähler" war. Neben dem gut überlieferten römischen und griechischen Lunisolarkalendern konnte der gallorömische Lunisolarkalender aus den Fragmenten von Coligny und Villards d'Héria weitestgehend rekonstruiert werden. Dieses Buch versucht nun anhand von antiken, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Literaturquellen die Charakteristika des gebundenen Mondkalenders der Germanen zusammenzustellen.
Dieser gebundene Mondkalender hat nicht nur seine Spuren in alten Gesetzbüchern und den mythologischen Überlieferungen der Eddas und Sagas hinterlassen. Er wurde noch lange, d.h. bis in 17. Jahrhundert, parallel zur Berechnung von Jahreskreisfesten benutzt. Diese Jahreskreisfeste im gebundenen Mondjahr bilden nach der Rekonstruktion der Schaltregeln des Lunisolarkalenders der Germanen den zweiten Schwerpunkt des Buches. In Exkursen über die antiken Kalender wird auch auf die Ursprünge von bekannten Festen wie Weihnachten und Ostern eingegangen.
Den Abschluss bilden die Festlichkeiten im Rahmen des (inklusiven) neunjährigen Schaltzyklus (Oktaeteris) dieses gebundenen Mondkalenders und der damit verbundene Mythos "Vom Tod König Auns", der uns als Teil der Ynglingasaga überliefert wurde.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der gebundene Mondkalender der Germanen von Andreas E. Zautner im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus History & World History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Vorwort zur 1. Auflage
Heutzutage benutzen wir nahezu auf der gesamten Welt den gregorianischen Kalender, der durch Reformierung des julianischen Kalenders entstanden ist. Dieser Kalender ist ein reiner Sonnenkalender, bei dem der Lauf des Mondes keinerlei Rolle für die Einteilung des Jahres spielt. Von der römischen Antike über das Mittelalter hinweg bis in die Neuzeit fand er weltweite Verbreitung.
Dieser Sonnenkalender hat seinen Ursprung im antiken Ägypten. Das Land am Nil war schon seit Jahrtausenden ein Zentrum des Sonnenkultes und Pharao Amenophis IV. (Echnaton) setzte bereits im 14. Jahrhundert v. Chr. die Verehrung des Sonnengottes Aton (Re) als oberste Gottheit durch. Dieser ägyptische Sonnenkult inspirierte auch die alexandrinisch-hellenistischen Gelehrten.
Im Jahre 47 v. Chr. reiste Gaius Julius Caesar nach Ägypten, genauer gesagt nach Alexandria, dem seinerzeit wahrscheinlich größten Zentrum der Wissenschaft weltweit. Dort ließ er sich von Acoreus, Sosigenes und anderen in Alexandria ansässigen Astronomen in die Komputistik des Sonnenkalenders einführen. Zwei Jahre später, im Jahre 45 v. Chr. wurde durch Gaius Julius Caesar ein ursprünglich hellenistisch-ägyptischer Sonnenkalender im gesamten Römischen Reich eingeführt.
Doch bevor dieser Sonnenkalender eingeführt wurde, war es insbesondere auf dem eurasischen Kontinent üblich, die Jahre (auch) nach dem Mond zu bestimmen. Sowohl Römer als auch Griechen, Kelten, Balten und Germanen benutzten anfänglich Lunisolarkalender, bei denen der Lauf von Sonne und Mond durch das Einfügen eines Schaltmonats aufeinander abgestimmt wurde.
Einen dieser Lunisolarkalender verwendete man noch im 17. Jahrhundert in Gamla Uppsala, dem alten Zentrum des schwedischen Königreiches. Dort wurde der Termin des Distingsmarktes, der seinen Ursprung in einem germanischen Fest hatte, weiterhin mit Hilfe von sogenannten Primstäben nach einem gebundenen Mondkalender berechnet. In Reisetagebüchern wie dem von Erich Lasota von Streblau und einigen Chroniken wie denen von Olaus Magnus und Olaus Wormius sind entsprechende Merkregeln hierfür erhalten. Mit Hilfe dieser Merkregeln und anderen Fragmenten, die verstreut über eine Reihe von Literaturquellen erhalten sind, soll in diesem Buch versucht werden, den gebundenen Mondkalender der Germanen zu rekonstruieren, wie er nachweislich in England bis zum 7. Jahrhundert und in Skandinavien bis ins 11. Jahrhundert Verwendung gefunden hat. Der deutsche Germanist und Literaturhistoriker Wolfgang Golther hatte in seinem Handbuch der Germanischen Mythologie (1908) einst behauptet, dass man einen derartigen Lunisolarkalender nicht rekonstruieren könne, da es hierfür zu wenig Quellen gäbe. Doch die Quellenlage ist bei tieferer Recherche gar nicht so gering.
Natürlich ist dies nicht der allererste Versuch sich diesem Mondkalender zu nähern. Insbesondere die Vorarbeiten von dem schwedischen Philologen und Religionshistoriker Martin Persson Nilsson (1920) und dem gleichfalls aus Schweden stammenden Religionshistoriker Andreas Nordberg (2006) sind bereits hier im Vorwort zu würdigen. Im Vergleich zu ihren Vorarbeiten soll in diesem Buch jedoch auch mehr auf kontinentaleuropäische Aspekte eingegangen werden und vor allem die Festtage im Jahreskreis werden eine stärkere Berücksichtigung finden. Im hinteren Teil des Buches werden sowohl die Festzeiten der germanischen Religion, die in den alten Sagas auch als Firne Sitte (an. forn siðr; Steinsland, 2005) bezeichnet wurde, als auch die Termine der eher weltlichen Dingversammlungen, vor dem Hintergrund des Lunisolarkalenders behandelt werden. Darüber hinaus gibt es im Bezug auf einzelne Aspekte unterschiedliche Sichtweisen im Vergleich zu den Vorarbeiten der anderen Autoren.
Bei der Rekonstruktion des gebundenen Mondkalenders werden die aus verschiedenen Epochen vorhandenen Literaturquellen vornehmlich unter der Maßgabe einer gewissen astronomischen Logik betrachtet und dieser Logik Folge leistend zu einem funktionellem Lunisolarkalender zusammengefügt.
Da wir uns bei der Rekonstruktion des gebundenen Mondkalenders der Germanen insgesamt mit fünf verschiedenen Kalendern, dem julianischen Kalender, dem gregorianischen Kalender, dem Nordischen Wochenkalender und selbstverständlich dem eigentlichen gebundenen Mondkalender, der in einer christlich beeinflussten und in einer „vorchristlichen“ Version (vor 1084) rekonstruiert werden wird, auseinandersetzen müssen, werden entsprechende Datumsangaben zur einfacheren Unterscheidung mit einem hochgestellten Buchstaben versehen (G-gregorianisch, J-julianisch, W-Wochenkalender).
Das Buch versucht insgesamt den Spagat zwischen möglichst hoher Wissenschaftlichkeit und allgemeiner Verständlichkeit. Dem entsprechend werden die einzelnen Quellen weitestgehend vollständig angegeben. Dennoch ist dieses Buch keine wirkliche wissenschaftliche Abhandlung und nicht vergleichbar mit einer Dissertationsschrift, die den Anspruch einer vollständigen Diskussion aller zu diesem Thema veröffentlichten Beiträge erhebt. Trotzdem würde ich mich über Hinweise auf weitere Quellen zu dem Thema freuen, um eine gegebenenfalls in Zukunft erscheinende, verbesserte 2. Auflage dieses Buches mit einem größeren Anspruch auf Vollständigkeit verfassen zu können.
Göttingen, 2013
Andreas Zautner
Vorwort zur 2. Auflage
Nachdem die 1. Auflage dieses Buches vor nun etwa fünf Jahren herausgekommen ist, möchte ich mich zunächst für die durchweg positive Resonanz und Korrespondenz zu diesem Buch bedanken, die mich dazu motiviert hat das Buch an einigen Stellen zu ergänzen und zu überarbeiten. In den wesentlichen Aspekten behält die 1. Auflage dennoch ihre Gültigkeit. Was ist nun also hinzugekommen? Als Einstimmung auf die Prinzipien eines Lunisolarkalenders diente der römische Lunisolarkalender. Hier wurde eine Abbildung zu den Fasti Antiates maiores und ein weiterer Anhang mit einer tabellarischen Auflistung der römischen Feiertage ergänzt.
Die Abhandlungen von Shaw und Udolph zu Ostern und Eostre sowie zu Hretha (Nerthus) sind an entsprechender Stelle in das Buch eingeflossen. In diesem Zusammenhang wurden auch die Etymologie des solmónað und des hréðmónað korrigiert.
Die Beschreibung der Festlichkeiten zum Ende der Polarnacht auf der Insel Thule von Procopios von Caesarea sind nun auch im griechischen Original in diesem Buch abgedruckt. Darüber hinaus konnte durch die geodätischen Analysen zur „Entschlüsselung“ von Ptolemaios Atlas der Oikumene diese Insel Thule nun auch exakt lokalisiert werden.
Ein weiterer indirekter Hinweis in Wulfilias Übersetzung des Kolosserbriefes auf einen gotischen Lunisolarkalender ist hinzugefügt worden.
Der neue Artikel über die Spurcalien von Nathan Ristuccia „The Rise of the Spurcalia“ wurde eingearbeitet.
Die wirklich interessante archäologische Arbeit von Magnell und Iregren, die die Opferfeste an den nordischen Quartalstagen auf dem Areal der Frösö-Kirche im schwedischen Jämtland nachweist, wird vorgestellt.
Die meisten Ergänzungen gab es im Bezug auf das Neunjahr bei den Germanen. So wurde der Runenstein von Stentoften als Quelle für das Neunjahresopfer ergänzt. Es gibt einen weiteren Exkurs über die Oktaeteris als Zeitmaß für die Delphischen Spiele und ein ganz neues Kapitel zum Neunjahr in der germansichen Mythologie.
Zur besseren Verständlichkeit wurde der Anhang über Franks Casket mit der Beschreibung der Ikonografie des Kästchens nahezu verdoppelt.
Um das heidnische Mittwinterfest zum Vollmond, der auf den ersten Neumond nach der Wintersonnenwende folgt, im Lesefluss leichter und eindeutig vom christlichen Weihnachtsfest zur beobachtbaren Wintersonnenwende am 24./25. Dezember unterscheiden zu können, richte ich mich in der 2. Auflage des Buches nach einer in der skandinavischen Literatur zum Teil üblichen Sprachregel und bezeichne nun ersteres mit dem altnordischen Begriff „Jól“ und zweiteres mit dem aktuellen skandinavischen Begriff „Jul“, was jedoch an den Textstellen schwierig wird, in denen von der terminlichen Verlegung des ersten auf das zweite geschrieben wird.
Darüber hinaus gab es hier und da noch einige kleinere Veränderungen.
Ich hoffe, durch diese Ergänzungen wird das Bild von dem oder besser den Lunisolarkalendern, die zwischen Völkerwanderung und später Wikingerzeit in Nordeuropa benutzt wurden, abgerundet und verständlicher.
Göttingen, 2018
Andreas Zautner
1. Die Weltmühle dreht sich –
zur Kosmographie der Germanen
Zu Beginn dieses Buches soll zunächst ein schematisierender Blick auf die Kosmographie der Germanen geworfen werden. Dabei sei angemerkt, dass sich diese in ähnlicher Form auch bei anderen antiken, indoeuropäischen Völkern findet.
Interessant hierbei ist zunächst der Wortkern des Begriffes Welt – ahd. Weralt, denn dieser bezeichnet eigentlich eine zeitliche Dimension und zwar das Zeit-alter (-alt), in dem die Menschen (Wer-) existieren. Der ursprüngliche Begriff für den kosmographischen Aufbau des Universums war Weltzimmer (ahd. Weraltzimbar). In seinem Grundaufbau war dieses Weltzimmer oder Weltgefüge dreigeteilt.
In Mittangart (ahd.; an. Miðgarðr) lebten die diesseitigen Menschen. Die große Ebene dieser mittleren Welt wurde als Irmingrunt (ahd.; an. Jörmungrundr), was allergrößter Grund bedeutet, bezeichnet. Nach außen wurde diese Weltebene durch das Weltmeer (ahd. Weraltmeri) begrenzt, welches wiederum ganz außen am Horizont bzw. Weltring (ahd. Weraltring) von einem riesigen Lindwurm (an. Jörmungandr), dem Mittgartswurm (an. Miðgarðsormr) umringt wurde. In der Mitte dieser Welt erhebt sich, wie wir es aus der Vita des Sankt Gallus erfahren, der Weltberg (ahd. Weraltberc) bzw. über diesem die Himmelskuppel, die auch als Himmelsberg (ahd. Himilinberc, an. Himinbjörg) bezeichnet wurde. Wenn man bedenkt, dass ein Weltberg eine Erdhalbkugel approximiert, ist, gemessen an modernen Weltvorstellungen, ein solches Weltbild gar nicht so primitiv.
Im Inneren dieses Weltberges bzw. unter der Weltebene befindet sich die verborgene oder besser verhehlte Welt – die Hellia (ahd.; an. Hel), die u.a. ein Daseinsort der Verstorbenen war.
Über der Menschenwelt Mittgart befindet sich der sogenannte Aufhimmel (ahd. ufhimil, an. upphimin; ae. upheofon). Dort hinein ragt der Gipfel des Welt- bzw. Himmelsberges. Auf dem Gipfel oder besser Gebirgskamm des Welt- bzw. Himmelsberges befand sich die Wohnstätte der Götter. Ein althochdeutscher Begriff für Pfahl, Balken, Dachfirst und dann im übertragenen Sinne auch für Gebirgskamm war ans (ahd.; an. áss, ae. ōs, got. ans, urgerm. ansuz). Dementsprechend hieß diese Wohnstätte der Götter auf dem ans / Gebirgskamm – Ásgarðr (an.). Die Götter wurden dementsprechend als Bewohner dieses Weltbergs-Gebirgsrückens als ensî (ahd.; an. æsir; ae. ēse, got. anseis) bezeichnet. Richard Wagner und andere Nationalromantiker haben diesen Begriff als Asen ins Neuhochdeutsche übertragen, obwohl, basierend auf der althochdeutschen Form ensî, die Bezeichnung Änse die richtigere neuhochdeutsche Schreibweise wäre (Bachmann, 2012). Die Analogie zu den griechischen Göttern, den Olympiern, die auf dem Gipfel des Olymps wohnten, geht auf die gleichen gemeinindoeuropäischen Vorstellungen zurück.

Abb. 1: Schematische Darstellung der germanischen Kosmographie
In der Mitte des Weltberges und der Wohnstätte der Änse befand sich die Weltachse, die Axis mundi, die allergrößte Säule – die Irminsûl (ahd.), die auch als Weltenbaum bzw. Weltesche (an. askr) angesehen wurde.
Doch was uns hier im Besonderen interessiert, ist die dynamische Komponente dieses Weltzimmers, denn dieses dreht sich, wie man leicht vermuten kann.
Dieses allumfassende Rotationsprinzip wird in der nordischen Mythologie durch die wahrscheinlich riesige Wesenheit Mundilfæri (an.) repräsentiert. Es gibt verschiedene Deutungen für den Namen Mundilfæri. Zum einen wird der Name aus altnordisch möndull = Mühlenstil) und -færi = Fahrer, im Sinne von „derjenige, der etwas in Bewegung setzt“ interpretiert (Nordberg, 2006). Demnach ist Mundilfæri „derjenige, der die Weltmühle in Rotation versetzt“, die Weltmühle selbst oder die rotierende Welt- bzw. Mühlenachse.
Eine andere Deutungsweise leitet den ersten Namensbestandteil Mundil- von dem altnordischen Wort mund = Zeit, Zeitpunkt und den zweiten Namensbestandteil -færi von dem althoch...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Abkürzungsverzeichnis
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort zur 1. Auflage
- Vorwort zur 2. Auflage
- 1. Die Weltmühle dreht sich
- 2. Vorbetrachtungen: Von Nächten, Tagen und Wochen
- 3. Die Vierteilung des Monats
- 4. Die Monatsnamen
- 5. Welche Arten von Kalendern gibt es?
- 6. Die germanischen Lunisolarkalender
- 7. Das Mit- und Nebeneinander der verschiedenen Kalendersysteme
- 8. Der Lunisolarkalender in der germanischen Mythologie
- 9. Die Jahreszeiten
- 10. Die Hohen Zeiten des germanischen Jahreskreises
- 11. „Alle neun Jahre“ – Festlichkeiten im Neunjahreszyklus
- 12. Wie lange wurde gefeiert?
- 13. Das Neunjahr
- 14. Zusammenfassende Rekonstruktion des gebundenen Mondkalenders
- Anhang A: Liste der Feiertage des römischen Lunisolarkalenders
- Anhang B: Liste der Eintragungen auf den Primstab
- Anhang C: Franks Casket: Ein Schicksalszauber und der Lunisolarkalender
- Nachwort
- Danksagung
- Der Autor