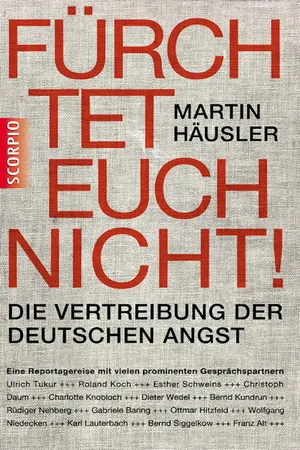![]()
1 EIN VOLK IN ANGST
Als würden wir auf die Probe gestellt: Trotz all unserer Ängste schwappen 2011 vier neue Furcht einflößende Wellen fast zeitgleich über uns hinweg. Die Medien transportieren sie über zehn Zentimeter große Buchstaben und die neu eingeführte Nachrichten-Darreichungsform des minütlich aktualisierten Krisentickers im Internet. Straßenumfragen, Netzforen, Blogs und Gespräche von Wochenmarkt bis Freundeskreis dokumentieren verlässlich, dass die Angst auch angekommen ist.
Die erste der vier Ängste infiltriert uns im Januar aus Nordafrika. Die zerbrechenden Bollwerke der dortigen Regime lassen viele Europäer Flüchtlingswellen sowie die Machtergreifung fanatischer Muslime befürchten. Eine weit größere Sorge erreicht die Republik im März aus Japan, wo nach Beben und Tsunami der nukleare Super-GAU eingetreten ist. Die Atomangst ist zurück. Sie ist so stark, dass sie die Menschen zu Hunderttausenden auf die Straße treibt und damit sogar die Politik zu Veränderungen zwingt. Die dritte Angst ist die vor neuem Terror, nachdem Osama Bin Laden Anfang Mai von einem amerikanischen Killerkommando erschossen wurde. Haben wir doch noch die weihnachtliche Warnung des Innenministers im Ohr, der nach Geheimdienstinformationen befand, dass wohl »Grund zur Sorge«, aber eben »kein Grund zur Hysterie« vor Anschlägen in Deutschland gegeben sei. Die vierte Angst trägt den Namen eines tödlichen Darmkeims. Eine bisher ungekannte EHEC-Mutation bringt Ende Mai – gerade mal 500 Meter von der eigenen Haustür entfernt – das Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf an den Rande der Belastbarkeit und – weltweit – die überforderte Wissenschaft ins Schwitzen.
Die meisten unserer Ängste werden nicht in derartiger Panoramaoptik dokumentiert. Zwar kann man sie eindrucksvoll spüren, wenn man sich auch nur ansatzweise umhört. Natürlich kann man sich diese gefühlte Angst auch von Experten bestätigen lassen. Und diese Recherchen nähren in der Tat den Verdacht, dass die Angst zu einem ständigen Begleiter geworden ist und sich wie ein dicker Mantel auf unser Land und jeden Bereich unseres Lebens gelegt hat, uns einengt und Luft raubt. Vor allem aber findet die deutsche Angst immer dann einen klaren Niederschlag, wenn repräsentative Umfragen dazu veröffentlich werden.
Das war wieder mal im September 2010 der Fall, dem vorläufigen Zenit des deutschen Angstklimas. Die R+V Versicherung konnte bei der Präsentation ihrer alljährlichen Angstumfrage von einem selten da gewesenen Angstniveau berichten. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) hatte für das Unternehmen 2500 Bundesbürger befragt und herausgefunden, dass sich inzwischen mehr als zwei Drittel vor steigenden Lebenshaltungskosten (68 Prozent) und einem Wirtschaftsabschwung (67 Prozent) fürchten. Auf Rekordhöhe ist die Angst um die Umwelt gestiegen. 64 Prozent gingen davon aus, dass die Zahl der Naturkatastrophen zunehmen wird. Zugenommen hat auch das Misstrauen in die Politik. 62 Prozent – knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr – befürchteten, dass die Volksvertreter der aktuellen Krisenlage nicht gewachsen sind. 61 Prozent der Deutschen bangten zudem um ihren Arbeitsplatz, eine leichte Aufhellung zwar, aber immer noch ein hoher Wert – zum Vergleich: Bei den Holländern hatten zur gleichen Zeit nur acht Prozent Angst um ihren Job. Richteten sich die Blicke auf die Zeit nach dem Berufsleben, zeugten die Antworten der befragten Bundesbürger von wachsender Furcht vor einem Lebensabend in Armut, Krankheit und Pflegebedürftigkeit.
Und das Angstwachstum nimmt kein Ende. Stärker denn je machten sich Eltern Gedanken um das Wohl ihrer Kinder. Die Kriegsangst wuchs. Die Terrorangst wuchs. Die Angst der Männer wuchs. Die Angst vor dem Zerbrechen der eigenen Partnerschaft wuchs. Damit kletterte das durchschnittliche Angstniveau auf 50 Prozentpunkte. In 20 Jahren Angststudie ist das der zweithöchste Wert – nach 51 Prozent 2003 und 2005.
Interessant ist, dass den Deutschen vor allem wirtschaftliche Ängste auf der Seele liegen. Sie sind seit Jahren Spitzenreiter im Ranking. »Die Suche nach Sicherheit kennzeichnet die Deutschen im besonderen Maße«, hatte Professor Manfred G. Schmidt vom Institut für Wirtschaft der Universität Heidelberg für die Auftraggeber der Studie das Ergebnis kommentiert, und er fügte an: »Ihr Wunsch nach einer sicheren persönlichen Lebensplanung mit festem Arbeitsplatz, einem finanziell abgesicherten Ruhestand und nach Preisstabilität wird in Krisenzeiten gefährdet. Das löst große Ängste aus.«
Warum ist das so? Das will ich von Manfred G. Schmidt persönlich wissen. Ich erreiche ihn in seinem Büro an der Uni Heidelberg. »Die Suche nach Sicherheit und die damit verbundene Angst um die eigene Sicherheit finden wir in Ländern, die wirtschaftlich entwickelt und hochgradig arbeitsteilig sind, wo der Einzelne darauf angewiesen ist, dass für seine Lebenssicherung nicht nur das private Streben wichtig ist, sondern dass die öffentlichen Einrichtungen intakt sind«, sagt Schmidt. »Deutschlandspezifisch allerdings ist die Erinnerung an Phasen fürchterlicher Unsicherheit, an Krieg, Vertreibung, Flucht, massenhaften Tod. Hinzu kommen ökonomische Traumata wie die Hyperinflation von 1924 oder die Währungsreform von 1948. Das durchschüttelt den gesamten Gesellschaftskörper so sehr, dass daraus ein Verlangen nach Sicherheit erwächst, das ungleich stärker ist als in anderen Ländern. Damit zu tun haben die hohen Angstwerte vor steigenden Lebenshaltungskosten als unser Topthema sowie die Sorge um die Geldwertstabilität.« Unsere Geschichte. Da haben wir sie schon. Natürlich war mir bewusst, dass die deutsche Historie eine Rolle spielen wird auf der Suche nach der Angst, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie zu einem der Schwerpunkte werden wird.
2010 wurden nicht nur der Deutschen Horrorvorstellungen von der GfK ermittelt, sondern auch die potenziellen Glücksbringer. Die hatten weniger mit finanziellen Werten zu tun. Für 24 Prozent brachte die Geburt von Kindern und Enkelkindern den größten Segen. Die Zukunft, in die diese hineinwachsen, wird allerdings weniger rosig gesehen. Gefragt nach den womöglich vorherrschenden Ängsten im Jahr 2030, nannten die Befragten rund 60 verschiedene Themen, darunter Angst vor Atomenergie, vor Egoismus, vor Korruption und vor Überbevölkerung. Für einige droht sogar der Weltuntergang. Wohlgemerkt: Die Antworten wurden ein Dreivierteljahr vor den Katastrophen von Japan gegeben!
Angstdaten dieser Art gibt es einige. Sie zementieren und konturieren das Bild vom ängstlichen und angstkranken Deutschen. Jobstudien wie der »Workplace Survey« des Personaldienstleisters Robert Half gaben 2010 darüber Auskunft, dass deutsche Manager aus Angst vor Arbeitsplatzverlust viel seltener bei Krankheit das Bett hüten als Manager anderer Nationen. 55 Prozent bekundeten, dass sie sich lädiert zur Arbeit schleppten. Ein Wert, der nur noch von den Österreichern getoppt wird, wo sich 59 Prozent aus Angst vor Jobverlust nicht zu Hause auskurieren.
Immer mehr Untersuchungen geben auch darüber Auskunft, dass es die Ängste selbst sind, die uns erst krank machen. So gab die Krankenkasse DAK Mitte 2010 eine alarmierende Pressemeldung heraus, die ihren Niederschlag in zahlreichen Medien fand. Kernbotschaft: Gerade bei jungen Erwachsenen haben die psychischen Erkrankungen überproportional zugenommen. Bei berufstätigen Frauen zwischen 20 und 29 Jahren sowie bei berufstätigen Männern zwischen 25 und 29 nahm die Anzahl von »Krankheitsfällen durch psychische Leiden« im Vergleich zu 1997 um 145 Prozent bzw. 124 Prozent zu. Das ergab die Langzeitauswertung der DAK-Gesundheitsreporte. »Die zunehmende Belastung durch Stress führt offenbar schon bei jungen Erwachsenen zu immer mehr Krankschreibungen aufgrund von Depressionen oder Ängsten«, ordnete ein Psychologe in der gleichen Pressemitteilung ein. Im Februar 2011 schiebt die DAK eine dazu passende Zahl hinterher: Der Anteil der psychischen Erkrankungen am Gesamtkrankenstand ist auf nie da gewesene zwölf Prozent angestiegen.
Mir geht es mit diesem Buch nicht in erster Linie darum, einmal mehr die pathologische Angst zu sezieren. Es geht mir um die diffuse gesellschaftliche Angst. Jedoch erscheint es mir angebracht, zumindest in einem der Gespräche auf das Phänomen der wachsenden Angsterkrankungen einzugehen. Denn auch sie sind Teil der deutschen Angst. Und die diffusen Ängste äußern sich ebenso irgendwann in körperlichen Symptomen.
Ich erfahre von einem Geschäftsführer, der gerade mit seiner Pharmafirma ein pflanzliches Präparat für Angstgeplagte auf den Markt gebracht hat. Mir liegt es fern, in irgendeiner Weise Werbung zu machen für irgendein Produkt, weshalb ich den Namen des Produkts hier auch nicht nenne. Aber der Mann, Dr. Traugott Ullrich heißt er, scheint mir ein guter Gesprächspartner zum Thema Angst zu sein: Neun Jahre Forschungsarbeit und Produktentwicklung liegen hinter ihm und seiner Mannschaft. Ich treffe Ullrich, Chef der Ettlinger Spitzner-Arzneimittelfabrik, zum Frühstück. Ullrich ist ein jugendlich aussehender Manager mit markanter Brille und geschliffener Sprache. Bevor er ins Pharmageschäft einstieg, studierte er Medizin, machte seinen Facharzt in Urologie und Chirurgie, legte noch ein BWL-Studium nach.
»
Wir haben nicht akzeptiert, dass es nicht ewig bergauf, sondern im Laufe einer Biografie auch mal runtergehen kann. «
Dr. Traugott Ullrich
Herr Ullrich, haben Sie in den neun Jahren Forschungsarbeit zum Thema Angst eine Zunahme der Angst beobachten können?
Ullrich Die Angstspezialisten – und wir haben in fünf Studien mit den größten Namen der europäischen Angstforschung zusammengearbeitet – würden diese Frage mit Ja beantworten. Wenn Sie sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anschauen, ist das doch auch völlig verständlich. Wir haben uns in den letzten zehn Jahren von einer sehr behüteten und sehr stabilen Gesellschaft zu einer mitten im globalisierten Wettbewerb stehenden Gesellschaft entwickelt, und zwar in einer Geschwindigkeit, die wir vorher noch nicht erlebt hatten. Das hat dazu geführt, dass ganz wesentliche Stützen der Menschen plötzlich nicht mehr sicher sind. Firmen, in denen man sein Leben lang geschafft hat, sind nicht mehr sicher. Die Familienbande werden labil. Nicht erst durch den Missbrauchsskandal ist klargeworden, dass die Institution der Kirche schwächer geworden ist. Ich glaube, dass die Leute gerade den Boden unter den Füßen verlieren. Unter diesen Rahmenbedingungen haben wir uns zu einer Gesellschaft entwickelt, die das Hohelied der Multioptionalität singt.
Was meinen Sie damit?
Ullrich Man ist dann der König, wenn man ganz viele Möglichkeiten hat und sich bestenfalls alle Möglichkeiten offenhält. Den Leuten ist dabei nicht klar, dass sie für Multioptionalität einen hohen Preis zahlen. Die Kehrseite davon ist nämlich die fehlende Sicherheit. Das ist hier noch nicht angekommen. Das ist im Übrigen auch etwas, was ich als typisch deutsch ansehe. Wir kommen aus einer unglaublich gesicherten Gesellschaft. Es war ja für alles gesorgt. Aber wir haben es nicht akzeptiert, dass das nicht ewig so geht und es im Laufe einer Biografie rauf- und runtergehen kann.
Befördert diese Situation Angsterkrankungen?
Ullrich Auch, ja. Ursachen für Angsterkrankungen liegen entweder in akut traumatisierenden Erlebnissen oder in einer chronischen Überforderungssituation. Wendet man sich dieser Angst nicht zu, setzt sich irgendwann eine Depression drauf. Wenn dann ein Patient nach sieben Jahren erstmals beim richtigen Arzt aufläuft, hat er eine Störung, die sehr schwierig zu behandeln ist.
Sieben Jahre?
Ullrich So lange dauert in Deutschland im Schnitt die Phase vom ersten Auftreten von Angstsymptomen bis zur ersten richtigen Behandlung. Wird der Leidensdruck so stark, gehen die Leute endlich zum Arzt – aber erst zum falschen. Da passiert Folgendes: Die Leute sagen nicht, dass sie ein Angstproblem haben, sondern klagen über chronische Kopfschmerzen, chronische Rückenschmerzen, chronische Magen-Darm-Beschwerden, über Herzrhythmusstörungen. So wie wir hier ausgebildet sind, stürzen wir uns auf die Symptomatik. Am Ende steht aber keine fassbare Diagnose. Das führt unter Umständen zu einer Beschleunigung der Angst. Diese Patienten wechseln oft die Ärzte, und überall präsentieren sie sich anders.
Das sind dann eher praktische Ärzte und Internisten und weniger Psychologen?
Ullrich Genau, das dauert sehr, sehr lange, bis dann diese nächste Hürde genommen wird. Einerseits empfinden sich diese Patienten nicht als psychisch krank, andererseits reagieren die praktischen Ärzte gar nicht darauf. Selbst wenn man jemand ist, der relativ offen sein Angstproblem anspricht, ist unser Medizinsystem so gepolt, dass es nicht honoriert, wenn man sich darauf einlässt. Letztlich hat doch ein Radiologe ganz andere Veranlassungen, Menschen in die Röhre zu schieben.
Er ist möglicherweise froh.
Ullrich Bis zu einem gewissen Punkt. Spätestens mit dem dritten Besuch des Patienten, dem man immer noch keine Lösung anbieten kann, wird der Patient anstrengend.
Warum wird der Psychologe noch immer so gemieden?
Ullrich Wir sind eine Gesellschaft, in der Schwäche, Versagen und Misserfolg nicht zu den Diskussionsthemen gehören. Das ist hier nicht vorgesehen. Im Gegenteil, psychische Erkrankungen haben in Deutschland heute immer noch etwas Stigmatisierendes. Man setzt sich nicht wirklich damit auseinander. Das muss noch nicht einmal ins Krankhafte gehen. Ein Manager mit Angst, mit Zweifeln, mit Misserfolg ist mit einem Makel behaftet. In der Folge von Robert Enkes Tod (der Nationaltorhüter, der sich 2009 umbrachte – Anm. d. Autors) ist – zynisch gesagt – zumindest die Depression etwas salonfähiger geworden. Aber Depressionen sind die eine Geschichte und Ängste sind die andere. Angst ist ein ganz klarer Makel. Die Leute wollen sich daher nicht outen, geschweige denn damit hausieren gehen.
Die Furcht vor dem Psychologen ist womöglich die Furcht vor Psychopharmaka.
Ullrich Das ist so. In Amerika gehört es zum guten Stil, dass man das Antidepressivum Prozak nimmt. Sind die Deutschen krank, verlangen sie inzwischen erst einmal nach etwas Pflanzlichem. Die Furcht vor Chemiehämmern wie auch Antibiotika liegt laut Untersuchungen nahe bei der Furcht vor einem platzenden Atomkraftwerk. Diese Angst hat mit der Vorstellung zu tun, dass man unter dem Einfluss des Medikaments nicht mehr der Gleiche ist.
Wie reagieren die Hersteller von Pharmakeulen auf Sie?
Ullrich Ich glaube, von denen werden wir gar nicht richtig ernst genommen. Natürlich spielen wir in einer anderen Liga. Wir sind nicht rezeptpflichtig. Aber ich denke, beides hat eine Berechtigung, nebeneinander zu existieren.
Weil unterschiedliche Ängste unterschiedlich behandelt werden müssen?
Ullrich Ja, wir haben ja nicht die schweren Ängste im Blick. Die größte Gruppe von Angststörungen in Deutschland ist die der generalisierten Angststörungen. Das sind Dinge, vor denen jemand Angst hat, aber eigentlich nicht Angst haben müsste. Klassisches Beispiel: Sie sind kerngesund, sehen aber, dass einige Leute um Sie herum krank werden, weshalb Sie denken, dass Sie morgen auch Krebs haben werden. Oder: Sie machen eigentlich einen guten Job, haben aber ständig Angst, Ihren Arbeitsplatz zu verlieren, sodass Sie völlig aus der Spur geraten und Ihr Leben nicht mehr in den Griff bekommen. Oder: Sie geben Ihrem kleinen Kind schon früh ein Handy mit und rufen es alle zehn Minuten an, weil Sie denken, ihm könnte etwas passiert sein.
Wie groß schätzt man diese Gruppe Menschen?
Ullrich Zwölf bis 15 Prozent der Gesamtbevölkerung machen irgendwann in ihrem Leben eine Phase einer solchen Angststörung durch. Medizinisch definiert ist diese Angststörung nicht nur durch die Sorgen, die man nicht mehr in den Griff kriegt. Sie ist auch dadurch definiert, dass diese Phase mindestens sechs Monate dauern muss. Es gibt aber unglaublich viele Menschen, die dieses Phänomen nur sechs bis acht Wochen haben. Damit fallen die aber aus der Gruppe der generalisierten Angststörung heraus. Das ist ein riesiges Manko. Spezialisten wissen, dass es unter der generalisierten Angststörung eine leicht unterschwellige generalisierte Angststörung gibt, die zwar kürzer währt, in ihrer Auswirkung auf die Alltagsfähigkeit aber genauso einzuordnen ist. Nun kann man doch jemandem mit einer Angststörung – nur weil sie nicht ausreichend ausgeprägt ist – nicht die Behandlung verweigern.
Sicher, da argumentieren Sie als Hersteller eines – wenn auch pflanzlichen – Produkts. Aber für Ihr Präparat gilt doch auch: Du kannst es zwar nehmen, um dich besser zu fühlen, aber deine Angst anschauen, um sie zu beseitigen, musst du immer noch selbst!
Ullrich Das stimmt natürlich. Unsere Marktforschung hat ergeben, dass sich die Patienten in zwei Gruppen sche...