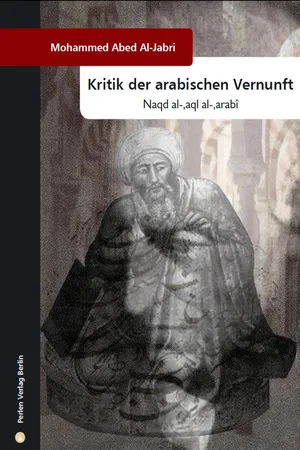
eBook - ePub
Kritik der arabischen Vernunft
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Kritik der arabischen Vernunft
Über dieses Buch
Vier Jahrzehnte lang arbeitete der marokkanische Philosoph Mohammed Abed Al-Jabri an der umfassenden und kritischen Reflexion des Niedergangs der arabischen Kultur. Sein Hauptwerk Naqd al-'aql al-'arabî, zu Deutsch 'Kritik der arabischen Vernunft', erschien von 1984 bis 2001 in vier Bänden und löste von Marokko über Ägypten bis Syrien heftigste Diskussionen aus. Nachdem mehrere deutsche Verlage trotz großen Interesses mit Hinweis auf die Verfolgung von Salman Rushdie von einer Veröffentlichung abgesehen hatten, erschien die 'Die Einführung zur Kritik der arabischen Vernunft' 2009 erstmals als Hardcover (232 Seiten) im Perlen Verlag und 2013 in einer aktualisierten und erweiterten Ausgabe als eBook. Deutschlandradio Kultur: "Ein epochales Werk!" Mehr Informationen und Rezensionen auf
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kritik der arabischen Vernunft von Mohammen Abed Al-Jabri, Vincent von Wroblewsky, Sarah Dornhof, Vincent von Wroblewsky,Sarah Dornhof im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Politische Philosophie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
PhilosophieI. Eine andere Lesart des Traditionsdiskurses
1. Die gegenwärtigen Schwächen
Die fundamentalistische Lesart
„Wie kann die Größe unserer Zivilisation wiedererlangt werden? Wie kann unsere Tradition wiederbelebt werden?“ Zwei Fragen, die eng miteinander verbunden sind und die in ihrer Überlagerung eine der drei zentralen Achsen der Problematik des modernen und zeitgenössischen arabischen Denkens bilden.
Der Dialog über diese Fragen und die von ihnen implizierte dialektische Ordnung bewegen sich zwischen Vergangenheit und Zukunft. Die Gegenwart hingegen ist nicht gegenwärtig, nicht nur weil man sie ablehnt, sondern auch weil die Vergangenheit bis zu einem Punkt gegenwärtig ist, wo sie sich auf die Zukunft ausdehnt und diese absorbiert. Die Vergangenheit nimmt die Stelle der Gegenwart ein, man sieht in ihr ein Mittel zur Behauptung und Rehabilitierung der Identität.
Der wesentlich Grund für eine solche Selbstbehauptung des arabischen Bewusstseins ist bestens bekannt und unbestritten: Es handelt sich um die Herausforderung des Westens in all ihren Formen. Wie für jedes Individuum oder jede Gesellschaft nimmt eine solche Identitätsbehauptung die Form des Rückzugs auf rückwärtsgewandte Positionen an, die als Schutzwall und Verteidigungsposition dienen.
Dies ist die Haltung, welche die fundamentalistische Strömung im modernen zeitgenössischen arabischen Denken vertritt. Diese Strömung steht, mehr als jede andere, dafür ein, die Tradition wiederzubeleben, die sie aus einer exzessiv ideologischen Sichtweise interpretiert, nach der eine ideologisch erzeugte „strahlende Zukunft“ auf die Vergangenheit projiziert wird. Auf diese Art wird „bewiesen“, dass „die Ereignisse der Vergangenheit sich in der Zukunft verwirklichen können“.
Ursprünglich trat diese Strömung in Form einer religiösen und politischen, reformistischen und offenen Bewegung auf, die von Jamal al-Din al-Afghani[9] und Muhammad ‘Abduh[10] begründet wurde. Diese Bewegung rief zur Erneuerung (tajdīd) gegenüber dem „nachahmenden Konformismus“ (taqlīd) auf. Die Ablehnung des nachahmenden Konformismus ist hier auf eine ganz spezifische Weise zu verstehen; sie zielt auf die „Beseitigung“ eines gesamten Dispositivs von Kenntnissen, Methoden und Begriffen, die von der „Epoche des Niedergangs“ geerbt wurden, ohne sich dabei im „Netz“ des westlichen Denkens „zu verfangen“. Was die „Erneuerung“ betrifft, so bedeutete sie, zu einer „neuen“ Interpretation der religiösen Dogmen und Gesetze zu gelangen, die unmittelbar auf den Grundsätzen des Islam beruhe. Es ging darum, die Religion zu aktualisieren, sie zeitgenössisch zu wenden und sie zur Grundlage unserer Renaissance zu machen.
Die Leitmotive dieser fundamentalistischen Strömung waren „Authentizität“ (asāla), eine Verbundenheit mit den Wurzeln und die Verteidigung der Identität, in einer Interpretation dieser Begriffe, nach der jeder von ihnen der Islam selbst sei: „der wahre Islam“, nicht ein Islam, wie er aktuell von den Muslimen gelebt wird.
Es handelt sich also um eine polemische ideologische Lesart, die zu jener Zeit insofern begründet war, als sie dazu diente, die eigene Identität zu behaupten und Vertrauen wiederzubeleben. Sie äußert sich in Form des üblichen Verteidigungsmechanismus und wäre legitim, wenn sie im Rahmen eines globalen Projektes stünde, sich der Epoche anzuschließen. Aber das genaue Gegenteil traf ein. Das Mittel ist Zweck geworden: Es ist die Vergangenheit – eilfertig rekonstituiert, um als Sprungbrett für den „Aufschwung“ zu dienen –, die zum eigentlichen Ziel des Projektes der Renaissance erklärt wurde. Fortan unterliegt die Zukunft einer Lesart, die sich auf die Interpretation der Vergangenheit stützt, nicht die Vergangenheit, wie sie wirklich war, sondern eine „Vergangenheit, wie sie hätte sein sollen“. Da jedoch eine solche Vergangenheit nie außerhalb der Empfindung und Imagination existierte, war die Auffassung einer kommenden Zukunft nie in der Lage, sich von der Vorstellung der vergangenheitsbezogenen Zukunft abzugrenzen. Diese Vorstellung belebt den Fundamentalismus in seiner ganzen Seele, nicht nur als romantisches Ideal, sondern auch als lebendige Realität. Man sieht in ihm auch ideologische Spannungen der Vergangenheit wieder aufleben, die mit vollem militanten Eifer Leib und Seele erfassen und sich nicht nur mit den Kontrahenten aus der Vergangenheit begnügen, sondern diese auch in der Gegenwart und Zukunft suchen.
Die fundamentalistische Lesart der Tradition ist eine ahistorische Lesart und kann somit nur zu einer einzigen Art, die Tradition zu begreifen, führen: zu einem Verständnis der Tradition, das in der Tradition eingeschlossen ist, von ihr absorbiert wird, ohne dass es ihm seinerseits gelingt, die Tradition zu umfassen. Die Tradition, um die es hier geht, ist eine sich wiederholende.
Die Lesart der religiösen Fundamentalisten geht von einer religiösen Auffassung der Geschichte aus, nach der die Geschichte ein Moment ist, der sich bis in die Gegenwart ausdehnt, in das Gefühlsleben erstreckt, als Zeuge des immerwährenden Kampfes und der ewigen Leiden, die zur Behauptung der Identität auf sich genommen werden. Und da es der Glaube und die religiöse Überzeugung sind, die zur Definition dieser Identität dienen, erhebt der Fundamentalismus den spirituellen Faktor zur alleinigen Antriebskraft der Geschichte. Andere Faktoren werden als sekundär erachtet, die vom Spirituellen abhängig sind oder den „wahren“ Verlauf der Geschichte verzerrt wiedergeben.
Die liberale Lesart
„Wie können wir unsere Zeit leben? Wie können wir uns mit unserem Verhältnis zur Tradition auseinandersetzen?“ Zwei weitere Fragen, die ebenfalls eng miteinander verknüpft sind und die in ihrer Überlagerung die zweite der zentralen Achsen der Problematik des modernen und zeitgenössischen arabischen Denkens bilden. Der Dialog darüber und die darin implizierte dialektische Ordnung bewegen sich dieses Mal zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Keineswegs eine uns eigene Gegenwart, sondern die Gegenwart des europäischen Westens, die sich als „Subjekt-Ich“ aufzwingt, von dem aus der Blick auf unsere Zeit, auf die gesamte Menschheit gerichtet wird, und sich somit als „Grundlage“ einer jeden möglichen Zukunft aufdrängt. Diese Instanz wird am Ende auf unsere eigene Vergangenheit projiziert und hinterlässt dort ihre Prägung.
Der liberale arabische Blick auf die arabisch-islamische Tradition geht von der von ihm gelebten Gegenwart aus, jener des Westens. Die liberale Lesart ist europäisierend, das heißt, sie übernimmt ein europäisches Referenzsystem. Dergestalt sieht sie in der Tradition nur das, was die Europäer in ihr sehen.
Diese Strömung wird von der orientalistischen Lesart vertreten, die sich bei arabischen Akademikern fortsetzt und sich bei ihnen zu einem orientalistischen Habitus wandelt. Ihre Vertreter beanspruchen Wissenschaftlichkeit und berufen sich auf Objektivität und eine „strikte“ Neutralität. Diese Lesart behauptet von sich, „unparteiisch“ zu sein und „keinerlei ideologische Intention zu verfolgen“.
Vertreter dieses Habitus geben vor, sich nur für das Begreifen und Erkennen zu interessieren: Zwar entlehnen sie bei den Orientalisten die „wissenschaftliche“ Methode, weisen jedoch deren Ideologie entschlossen zurück. Dabei vergessen sie, oder geben vor es zu vergessen, dass sie sich mit der Methode auch gleichzeitig die Sichtweise zu eigen machen. Sind Methode und Sichtweise nicht untrennbar verbunden?
Die Perspektive der orientalistischen Methode stellt Kulturen einander gegenüber, liest eine Tradition mit Hilfe einer anderen. Darin gründet die philologische Methode, die behauptet, alles bis auf seinen „Ursprung“ zurückzuverfolgen. Wenn es darum geht, die arabisch-islamische Tradition zu lesen, wird man sich also damit zufrieden geben, sie auf ihre jüdischen, christlichen, persischen, griechischen, indischen etc. „Ursprünge“ zurückzuführen.
Die orientalistische Lesart behauptet, sie sei allein um das Verstehen bemüht. Was aber will sie verstehen? Sie will verstehen, bis zu welchem Grad die Araber das Vermächtnis ihrer Vorfahren „verstanden“ haben. Warum? Weil der arabische Beitrag nur insoweit Wert habe, als die Araber eine Vermittlerrolle zwischen der hellenistischen und der modernen (europäischen) Zivilisation spielten. Die Zukunft habe in der Vergangenheit somit darin bestanden, eine fremde Vergangenheit in die arabische Vergangenheit aufzunehmen (im Wesentlichen die griechische Kultur). Gleichermaßen würde analog die Zukunft im arabischen Zu-Künftigen von der Aufnahme der europäischen Vergangenheit-Gegenwart abhängen.
Die modernistischen Thesen des liberalen modernen und zeitgenössischen arabischen Denkens sind somit Ausdruck einer gefährlichen Entfremdung der Identität, nicht allein sofern sie in einer zurückgebliebenen Gegenwart verankert ist, sondern auch, viel schlimmer noch, einer Entfremdung der Identität als Trägerin von Geschichte und Kultur.
Die marxistische Lesart
„Wie können wir unsere Revolution machen? Wie können wir unsere Tradition wiederherstellen?“ Zwei weitere, wiederum eng verknüpfte Fragen, die in ihrer Überlagerung die dritte und letzte der zentralen Achsen der Problematik des modernen und zeitgenössischen arabischen Denkens bilden.
Der Dialog über diese Fragen und die zwischen ihnen implizierte dialektische Ordnung bewegen sich zwischen Zukunft und Vergangenheit. Jedoch in dem Sinn, in dem beide noch im Projektstatus verharren: das Projekt einer noch nicht realisierten Revolution und das einer Rekonstruktion der Tradition, die fähig wäre, die Revolution auszulösen und ihr ein Fundament zu geben.
Hier handelt es sich um eine dialektische Beziehung: Von der Revolution wird erwartet, dass sie die Rekonstruktion der Tradition ermöglicht, und von der Tradition, dass sie zur Revolution beiträgt. Das Denken der modernen arabischen Linken irrt noch immer durch diesen Teufelskreis, stets auf der Suche nach einer „Methode“, diesem selbst zu entkommen.
Warum?
Weil es der dialektischen Methode nicht als einer anzuwendenden, sondern als einer bereits angewandten Methode folgt. So „soll“ das arabisch-islamische kulturelle Erbe einerseits Widerspiegelung des Klassenkampfes sein, andererseits ein Feld der Konfrontation zwischen Materialismus und Idealismus. Folglich wird die Lektüre der Linken darin bestehen, mit dem Finger auf die jeweils in diesem doppelten Konflikt beteiligten Parteien zu zeigen und ihre Positionen gegeneinander abzugrenzen. Wenn es feststellt, dass es seine Aufgabe nicht „so wie es sein sollte“ erfüllen kann, verdammt das Denken der Linken, unruhig und verwirrt, plötzlich „die Abwesenheit einer wahren Schreibweise der arabischen Geschichte“ oder führt die Schwierigkeiten an, die damit verbunden sind, die extreme Komplexität zu analysieren, durch die sich die Ereignisse unserer Geschichte auszeichnen. Wenn sich trotz allem manche Anhänger dieser Strömung abmühen, diese Schwierigkeiten so gut es geht zu verringern, geschieht dies zum Preis, die historische Realität in entsprechende theoretische Schemata hineinzuzwingen. Gelingt es nicht, in dieser Geschichte Spuren eines „Klassenkampfes“ zu finden, berufen sie sich auf eine „historische Verschwörung“. Finden sie in ihr keinen wissenschaftlichen „Materialismus“, so sprechen sie von einem unreifen Materialismus.
Eine solche Lesart der arabisch-islamischen Tradition seitens der arabischen Linken führt so zu einem marxistischen Fundamentalismus, oder anders gesagt, zu dem Versuch, den Gründungsvätern des Marxismus ihre fertige dialektische Methode zu entlehnen, als wäre das Ziel, die Gültigkeit der fertigen Methode zu beweisen, statt die Methode anzuwenden.
Darin liegt der Grund, warum sich diese Lesart als so wenig produktiv erwiesen hat.
2. Plädoyer für eine wissenschaftliche Kritik der arabischen Vernunft
In diesem kurzen Überblick über die am weitesten verbreiteten Lesarten der Tradition im zeitgenössischen arabischen Denken sind es hier weniger die von den einen oder anderen behaupteten, übernommenen oder „entwickelten Thesen“, die uns interessieren, als vielmehr die Denkweise, nach der sie alle verfahren, das heißt der unbewusste „geistige Akt“, der sie leitet. Eine Kritik, die den kognitiven Boden ignoriert, auf dem ihr Objekt beruht, bliebe eine ideologische Kritik der Ideologie und könnte demnach nichts anderes als Ideologie hervorbringen. Den Anforderungen eines wissenschaftlichen Vorgehens kann allein durch eine Kritik entsprochen werden, die auf die theoretische Produktionsweise, das heißt auf den „geistigen Akt“ gerichtet ist. Eine solche Kritik kann den Weg zu einer distanzierten wissenschaftlichen Lesart öffnen.
Wenn wir aus dieser Perspektive die drei soeben knapp analysierten Lesarten betrachten, stellen wir fest, dass aus epistemologischer Sicht – das heißt mit Blick auf die theoretische Funktionsweise, nach der alle drei verfahren – ihnen zwei wesentliche Fehler anhaften: ein Fehler in der Methode und ein Fehler in der Sichtweise.
Hinsichtlich der Methode fehlt diesen Lesarten jedes notwendige Minimum an Objektivität. Hinsichtlich der Sichtweise leiden sie unter einer fehlenden historischen Perspektive.
Abwesenheit einer historischen Sichtweise und Mangel an Objektivität sind zwei eng miteinander verbundene Charakteristika, die jedes Denken beeinträchtigen, das unter der Vormundschaft eines der Elemente der Gleichung steht, die es aufzustellen versucht; jedes Denken, das nicht in der Lage ist, sich unabhängig zu machen und seinen Mangel dadurch zu kompensieren sucht, dass es bestimmten Objekten, auf die es sich richtet, die Rolle eines Kriteriums zur Bewertung anderer zuweist. Das Subjekt wird auf diese Weise vom Objekt vereinnahmt und das Objekt tritt an die Stelle des Subjekts. Das Subjekt – oder das, was von ihm bleibt – flüchtet an einen entfernten, weit zurückliegenden Ort, auf der Suche nach Halt bei einem Gründungsvater, der ihm helfen kann, seine Selbstachtung wiederzuerlangen. Das moderne und zeitgenössische arabische Denken entspricht dieser Art des Denkens. Auch zeigt es größtenteils eine fundamentalistische Tendenz. Seine verschiedenen Strömungen und Tendenzen unterscheiden sich eigentlich nur durch die Art des „Gründungsvaters“, bei dem sie Zuflucht suchen.
Aus welchem Grund ist das gesamte zeitgenössische arabische Denken von einer solchen fundamentalistischen Tendenz geprägt?
Dank der hier entwickelten Lesart konnten wir diese Tendenz feststellen und ihre Ursprünge auffinden, denn die streng methodische Untersuchung eines zu lesenden Gegenstandes kann als erste Folge den Leser dazu bringen, sein Instrumentarium zu überprüfen. Berichten wir also von unserer Feststellung als unverzichtbare Einleitung zu der hier entwickelten Lesart.
Die drei hier besprochenen Lesarten sind fundamentalistisch. Sie unterscheiden sich auch aus epistemologischer Sicht nicht wesentlich voneinander, da sie alle auf einer gleichen Art des Schlussfolgerns basieren, das die alten arabischen Gelehrten den „Analogieschluss vom Bekannten auf ein Unbekanntes“ (qiyās al-ghā’ib ‘alā al-shāhid) nannten. Um welche der betrachteten Denkströmungen es sich auch handelt – religiös, nationalistisch, liberal oder links – jede verfügt über ein „Bekanntes“ (shāhid), auf dessen Grundlage es ein „Unbekanntes“ (ghā’ib) nachbildet. Das Unbekannte ist jeweils die „Zukunft“, so wie sie von den Anhängern dieser Strömungen vorgestellt oder erträumt wird; das Bekannte findet sich im ersten Teil der zweifachen Fragestellung einer jeden Strömung („die Größe unserer Zivilisation“ für die fundamentalistische Strömung, etc.).
Wie funktioniert diese Analogie? Wir bezweifeln nicht, dass der Analogieschluss von einem Bekannten auf ein Unbekanntes ein wissenschaftliches Verfahren sein kann, solange es bestimmten Gültigkeitsbedingungen entspricht. Die Methode wurde von Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Grammatik und des Rechts in der herausragenden wissenschaftlichen Arbeit angewandt, die zur Kodifizierung der arabischen Sprache und des religiösen Gesetzes führte. Von ihnen übernahmen sie die Theologen und bereicherten sie noch durch ihre Kontroversen und ihre Terminologie. Sie wurde auch von Physikern benutzt und durch ihre Anwendung in experimentellen Verfahren in ihrer Genauigkeit und Fruchtbarkeit weiter entwickelt. In der arabisch-islamischen Kultur stellt sie die wissenschaftliche Methode par excellence dar, die Gelehrte aller Disziplinen zu etablieren und zu kodifizieren halfen, indem sie Grenzen und Voraussetzungen ihrer Gültigkeit festlegten. Die wesentlichen Voraussetzungen, die diese Gelehrten aufstellten, um die Gültigkeit der Analogie zu garantieren, lassen sich unter folgenden zwei Prinzipien zusammenfassen:
- die Analogie zwischen zwei Termen ist nur dann gültig, wenn beide von gleicher Natur sind;
- die Analogie zwischen zwei Gliedern ist nur dann gültig, wenn beide Glieder, die von gleicher Natur sind, ein bestimmendes Element gemeinsam haben, das für die Konstitution eines jeden Glieds als wesentlich erachtet wird.
Um das „für...
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort Ex okzidente lux
- Brief von Mohammed Abed Al-Jabri
- Editorische Notiz
- Kritik der Arabischen Vernunft
- Einleitung
- I. Eine andere Lesart des Traditionsdiskurses
- 1. Die gegenwärtigen Schwächen
- 2. Plädoyer für eine wissenschaftliche Kritik der arabischen Vernunft
- II. Philosophisches Denken und Ideologie
- 4. Größe und Niedergang der Vernunft
- 5. Die andalusische Wiedergeburt
- Schlussfolgerung
- In memoriam Al Jabri
- Impressum