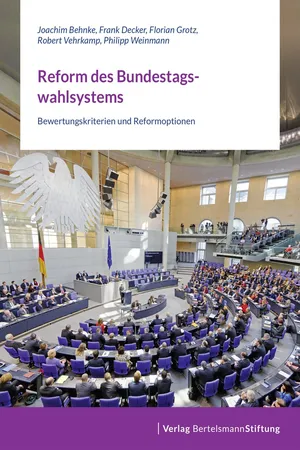![]()
V.Zweipersonenwahlkreise oder die Reduktion der Anzahl der Einpersonenwahlkreise als »Catch all«-Reformoptionen
Joachim Behnke
1. Beschreibung der Ausgangslage und des damit verbundenen Reformdilemmas
Wie in Kapitel II erwähnt, hat das Bundesverfassungsgericht mit seinem Urteil vom Sommer 2012 das kurz zuvor von der schwarz-gelben Koalition verabschiedete Wahlgesetz für verfassungswidrig erklärt (zur Vorgeschichte vgl. Dehmel und Jesse 2013; Grotz 2014). Da sich die Kritikpunkte des Gerichts sowohl auf das negative Stimmgewicht als auch auf die Überhangmandate bezogen, stellen diese beiden Punkte gewissermaßen die Mindestanforderungen dar, die von jedem guten Vorschlag eines Wahlsystems auf befriedigende Weise berücksichtigt bzw. gelöst werden müssen, wenn dieses als ernst zu nehmender Reformvorschlag betrachtet werden soll. Gleichzeitig sollen weitere Bedingungen gelten, nach denen die Qualität eines Wahlsystems zu bemessen ist.
Diese sind vor allem allgemeine Fairness- und Gerechtigkeitserfordernisse wie die Einhaltung des Proporzprinzips: einerseits bezüglich des bundesweiten Vergleichs der Parteien (Parteien- oder genauer Interparteienproporz) und andererseits bezüglich des Sitz-/Stimmenverhältnisses zwischen den Ländern (Länderproporz), wobei bei Letzterem vor allem in Hinsicht auf Fairnesserwägungen die Unterschiede zwischen den Landeslisten einer Partei von Relevanz sind (Intraparteienproporz). Ebenfalls gilt es, eine übermäßige Vergrößerung des Bundestages zu vermeiden und durch eine grundlegende Akzeptanzfähigkeit des Wahlsystems seine Legitimität zu sichern.
Überhangmandate nehmen nun insofern eine Schlüsselstellung ein, weil sie all diese genannten Aspekte direkt berühren und in der Regel das Phänomen darstellen, das für die als problematisch erachteten Effekte zu einem wesentlichen Teil, oft zur Gänze kausal verantwortlich gemacht werden kann. Auf den Punkt gebracht: Die Überhangmandate sind die Wurzel allen Übels. Gäbe es keine Überhangmandate, so wäre das alte Wahlsystem, das in dieser Form – abgesehen von marginalen Veränderungen – zwischen 1956 und 2012 gültig war, nie auf nennenswerten Widerspruch gestoßen, zumindest nicht aus den Gründen, die schließlich zu seiner Abschaffung führten.
Die Wahlsystemdebatte der 1950er- und 1960er-Jahre (vgl. Unkelbach 1956; Sternberger 1964; Hermens 1968; Jesse 1985) bezog sich im Wesentlichen auf den Typ des Wahlsystems selbst, also ob dieses ein Verhältniswahlsystem oder ein Mehrheitswahlsystem sein sollte. Bezeichnend ist ja, dass die Wahlsystemdebatte mit der Bundestagswahl von 1994 in Gang kam, also genau dann, als die Überhangmandate in einer bis dahin unbekannten Größenordnung anfielen. Von den insgesamt 16 Überhangmandaten entfielen bei dieser Wahl zwölf auf die CDU und vier auf die SPD, wodurch sich die extrem knappe Mehrheit der schwarz-gelben Koalition von nur zwei Sitzen auf einen relativ sicheren Vorsprung von immerhin zehn Sitzen vergrößerte. Mit der von Niedersachsen angestrengten folgenden Normenkontrollklage und dem Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1997 begann die juristische und wahlrechtliche Auseinandersetzung um das Wahlsystem. Auf die Ergebnisse der Bundestagswahl von 1994 bezog sich auch der für die folgende Debatte grundlegende und wegweisende Artikel von Hans Meyer (1994) mit dem bezeichnenden Titel »Der Überhang und anderes Unterhaltsames aus Anlaß der Bundestagswahl 1994«. Darin beschrieb Meyer erstmals das Phänomen des negativen Stimmgewichts, was aus der Sicht des Autors damals noch zum »anderen Unterhaltsamen« zählte.
Die Behauptung, die Überhangmandate seien die Wurzel allen Übels, fußt allerdings auf der fundamentalen Annahme, dass die Überhangmandate selbst ein Übel seien, genauer gesagt die von ihnen hervorgerufenen Konsequenzen oder die möglichen Konsequenzen, die sich aus ihnen ergeben können. Hier gehen die Meinungen auseinander, wie nicht nur die 4:4-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1997 belegt. Eine der problematischsten Konsequenzen der Überhangmandate kann darin gesehen werden, dass sie – wie der knappe Ausgang der Wahl von 1994 exemplarisch zeigt – das Potenzial besitzen, Mehrheiten und damit den politischen Ausgang einer Wahl zu verändern.
Überhangmandate bevorzugen außerdem bestimmte Parteien, geben diesen damit ein höheres Gewicht im Verhältnis zu den von ihnen errungenen Stimmen und verschaffen somit auch den Wählern der betroffenen Parteien einen größeren Einfluss auf das Wahlergebnis, als ihn die Wähler der anderen Parteien besitzen. Diese Diskussion wurde verfassungsrechtlich unter Begriffen wie dem der »Erfolgswertgleichheit« oder dem der »gleichen Erfolgschancen« geführt. Diese Diskussion soll hier nicht weiter ausgeführt werden.
Wir gehen im Folgenden schlichtweg von der Annahme aus, dass die Überhangmandate bzw. die von ihnen hervorgerufenen Konsequenzen als problematisches Phänomen zu betrachten sind – eine Sichtweise, die ja auch durch das Urteil von 2012 weitgehend geteilt wird; mit der begründungstechnisch etwas holprigen Einschränkung, dass Überhangmandate bis zur Obergrenze von 15 Mandaten nach dem Urteil immer noch zulässig wären (vgl. Haug 2012). Man muss sich daher keineswegs zwingend der Meinung anschließen, dass die Überhangmandate bzw. die von ihnen hervorgerufenen Konsequenzen beseitigt werden müssen: sei es, weil man sie nicht als zwingend verfassungswidrig ansieht, sei es, weil man in ihnen sogar begrüßenswerte Effekte erkennt (Poschmann 1995; Papier 1996; Pappi und Herrmann 2010).
Akzeptiert man jedoch die Forderung, dass die Überhangmandate bzw. die von ihnen hervorgerufenen Konsequenzen abzuschaffen sind, als eine nicht infrage zu stellende Vorgabe, dann muss geradezu zwingend die Einsicht folgen, dass die Umsetzung dieser Vorgabe zu nicht wünschenswerten Folgen führt, wenn man lediglich die Konsequenzen der Überhangmandate beseitigen will, aber nicht diese selbst. In diesem engeren Sinn sind die Überhangmandate selbst, das heißt in ihrem Auftreten an sich, als Wurzel allen Übels zu betrachten und nicht nur in Form der von ihnen hervorgerufenen Konsequenzen, also z. B. einer Verzerrung der Erfolgswerte oder der drohenden Gefahr eines Mehrheitswechsels.
Die Beseitigung der Konsequenzen der Überhangmandate konzentriert sich in der Regel auf die Wiederherstellung der Erfolgswertgleichheit unter der Formulierung einer Nebenbedingung, womit die Lösung oder zumindest der einzuschlagende Lösungsweg weitgehend determiniert sind. Nebeneffekte, die bei der Verfolgung dieses Lösungswegs auftreten, geraten hingegen nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit oder werden sogar bewusst ignoriert. Ist z. B. die Nebenbedingung (neben der Wiederherstellung der Erfolgswertgleichheit) die, dass die Größe des Bundestages möglichst beibehalten werden soll, dann kann dies dadurch geschehen, dass Überhangmandate einer Partei dadurch neutralisiert werden, dass dieser Partei in anderen Bundesländern Listenmandate abgezogen werden, diese also gewissermaßen zur Kompensation der Überhangmandate herangezogen werden.
Dieser Vorschlag zur Neutralisierung der Überhangmandate wird schon seit den 1990er-Jahren diskutiert (stellvertretend Nicolaus 1995; Naundorf 1996); in Verknüpfung mit einem Divisorverfahren wie Sainte-Laguë wird er von Behnke (2003a) und Pukelsheim (2008) thematisiert – von Letzterem stammt die Bezeichnung »direktmandatsbedingte Divisormethode mit Standardrundung« für das Verfahren. Das Kompensationsverfahren wird in seinen Grundzügen von den Gesetzesentwürfen der Grünen und der Linken in der Debatte von 2011 verkörpert, wobei sich die beiden Entwürfe dahingehend unterscheiden, wie mit externen Überhangmandaten umgegangen werden soll, also wenn nicht genügend Listenmandate zur Kompensation der Überhangmandate zur Verfügung stehen (ein Problem, das insbesondere im Zusammenhang mit der CSU relevant ist).
Die negative Seite dieses Verfahrens besteht darin, dass es zu einer erheblichen Verzerrung des Intraparteienproporzes führen kann. Wäre dieses Verfahren z. B. bei der Bundestagswahl 2009 angewandt worden, wären die 21 Überhangmandate der CDU mit den einzig noch vorhandenen 21 Listenmandaten der CDU verrechnet worden. Die Landesliste der CDU in Nordrhein-Westfalen hätte dafür mit acht Mandaten zahlen müssen, die von Niedersachsen mit fünf, die von Brandenburg mit vier Sitzen, wobei die CDU in Brandenburg insgesamt nur einen Anspruch auf fünf Sitze gehabt hätte, also vier Fünftel ihres Sitzanspruchs durch die Kompensation verloren hätte (vgl. Behnke 2010a: 547). Da eine Kompensation, die so einseitig zulasten einzelner Landeslisten geht, schwer politisch vermittelbar ist (insbesondere den betroffenen Landesverbänden), wurde als Reaktion darauf u. a. auch ein Modell entwickelt, das durch die Schaffung eines Puffers von Listenmandaten dafür sorgen sollte, dass die Verzerrungen des Länderproporzes maßvoller ausfallen (Peifer et al. 2012).
Durch eine Art präventiven Aufschlags auf die Direktmandate einer Partei von zehn Prozent wird eine sogenannte Mindestsitzzahl bestimmt, die dieser Partei auf jeden Fall zusteht. Liegt diese über der Sitzzahl, die der Partei aufgrund der Anwendung der Proporzregel zusteht, dann wird die Gesamtsitzzahl so lange erhöht, bis die Mindestsitzzahl durch die bundesweite proportionale Verteilung der Sitze zwischen den Parteien gedeckt ist. Auch das Verfahren von Behnke und Weinmann eines Flexiblen und Zielgerichteten Ausgleichs reagiert auf übermäßige Verzerrungen des Intraparteienproporzes und erhöht die Sitzzahl so lange, bis die Verzerrung auf eine bestimmte, vorher festgelegte Größenordnung reduziert werden kann (Behnke und Weinmann 2016).
Beide Modelle zeigen exemplarisch das Grundproblem auf: Wenn der Ruhezustand einer proportionalen Verteilung der Sitze durch die Entstehung von Überhangmandaten einmal gestört ist, dann kommt es zu einem Trade-off zwischen dem Ziel eines ausgeglichenen Intraparteienproporzes und dem einer sparsamen Verteilung von Sitzen. Je mehr Wert man auf die Verwirklichung des einen Zieles legt, desto mehr Abstriche muss man bei der Verfolgung des anderen Zieles machen.
Auch andere Modelle wie das Ausgleichsmodell der SPD von 2011 (dessen Funktionsweise in Lübbert, Arndt und Pukelsheim 2011 beschrieben wird) oder das eines vollständigen bzw. doppelten Ausgleichs, bei dem die Sitzzahl so lange erhöht wird, bis sowohl der Proporz zwischen den Parteien als auch der zwischen den Landeslisten gewährleistet ist, unterscheiden sich von dem Kompensationsmodell oder von dem von Peifer et al. (2012) vorgeschlagenen nur durch das Gewicht der Bedeutung, die sie dem Intraparteienproporz bzw. der Vermeidung einer übermäßigen Vergrößerung des Bundestages beimessen. All diesen Verfahren ist gemeinsam, dass sie den Interparteienproporz gewährleisten.
Das Dilemma des Wahlsystemkonstrukteurs besteht daher darin, hier den Trade-off bzw. die relativen Gewichte mehr oder weniger willkürlich in Form einer politischen Entscheidung festzulegen, die bestenfalls mit pragmatischen Gründen verteidigt, aber nicht in ihrer substanziellen Form gerechtfertigt werden kann. Diese...