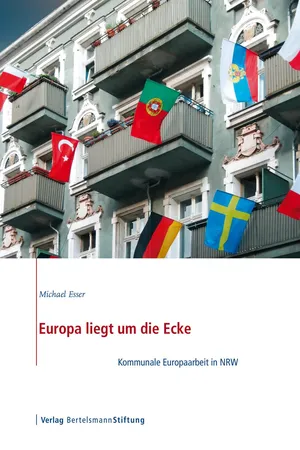![]()
Kreis Steinfurt
Unser Mann in Brüssel
Es war einer der vielen Abende in Brüssel mit einem der vielen Empfänge bei einer der vielen Veranstaltungen im europäischen Rahmen, irgendwann 2005 oder 2006. Mit dabei: Udo Röllenblech aus dem Kreis Steinfurt. Der Verwaltungsfachmann und Europaexperte der Kreisverwaltung unterhält sich die ganze Zeit mit einem interessanten Gesprächspartner. »Auf Englisch, alles«, erzählt er. »Den ganzen Abend über! Über alles Mögliche. Und dann verabschiedet sich der Gesprächspartner mit einem ›schönen Abend noch‹ – auf Deutsch!« Der Mann – ein Landsmann. Und Udo Röllenblech um eine europäische Überraschung reicher.
Vier Jahre – von 2005 bis 2009 – war Röllenblech für den Kreis Steinfurt »unser Mann in Brüssel«. Als erste NRW-Kommune überhaupt hatte der Kreis schon im Jahr 2000 einen Mitarbeiter dauerhaft in die EU-Metropole geschickt, als Vertreter der kommunalen Interessen. Bis dahin geschah das allein über die kommunalen Spitzenverbände und die Landesvertretung NRW. Früher »unser Mann in Brüssel«: Udo Röllenblech, Wirtschaftsförderer der Kreisverwaltung Steinfurt, war ein Pionier für direkte kommunale Interessenvertretung in Brüssel.
»DAS WAR EINE PREMIERE ÜBERHAUPT, dass ein Kreis so etwas eigenständig machte«, erzählt Udo Röllenblech. Die Aufgabenstellung war nicht weniger als sehr ehrgeizig: die »Stimme der Basis« erheben und etwas für den Kreis erreichen. Aber wie?
Einer der Wege führte über die vielen Empfänge. Das Wort weckt in der Heimat die Assoziation von »Nichtstun und bezahlt werden fürs Rumstehen«, ist in Brüssel aber tatsächlich fast gleichbedeutend mit Fachtagung. Gemeint ist eine möglichst aktuelle, also wichtige und am besten unverzichtbare Diskussionsveranstaltung, zu der Minister, Fachleute, Beamte und andere eingeladen werden. Es gibt die Möglichkeit, dass die Lobbyisten, zu denen Röllenblech ja auch zählte, Fragen stellen oder ihre Position erklären können. Anschließend gibt es üblicherweise einen Empfang. Natürlich gibt es dann auch einen Sekt und diese Erinnerung lässt den Europamann gleichzeitig schmunzeln und noch im Nachhinein angestrengt dreinschauen: »Ich kann nur sagen: Sekttrinken ist auch harte Arbeit.«
WIRTSCHAFT:
umsatzstärkste Branchen: Nahrungs- und Futtermittelherstellung, Maschinenbau, Autoteilefabrikation, Gummi- und Kunststoffwaren • die relativ meisten Arbeitsplätze stellen die Branchen Nahrung und Maschinenbau • eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten in NRW
Gerade am Anfang, wenn man keinen kennt und sich etwas überlegen muss, geht es sprichwörtlich um Sekt oder Selters. »Am Anfang habe ich rumgestanden wie so ein kleiner Junge, hier kennst du ja keinen, schrecklich! Dann habe ich mir gesagt, du hast einen Auftrag, nun mach hin. Dann spricht man jemanden an und legt irgendwie los. Dabei ist die Visitenkarte dann das wichtigste Arbeitsinstrument. Die gibt man weiter, weil man denkt, man könnte vielleicht für den Gesprächspartner interessant sein. Im Zweifelsfall ist man das gar nicht und der schmeißt die Visitenkarte weg. Aber nicht schlimm, ich habe ja auch dessen Karte bekommen.« Zu jeder Karte hat Udo Röllenblech dann wichtige Angaben notiert: die Gesprächsthemen, private Dinge wie verheiratet oder nicht, Kinder, Hobbys, Studienort usw. Dieser Aufwand hat sich bei späteren Kontakten und Treffen ausgezahlt. »Ich habe angerufen und gefragt, wie es gerade so mit dem Segeln klappt, wenn Segeln das Hobby war, oder ich hatte das und das aus seiner Stadt gehört, schon war das Gespräch viel lockerer.« Von der Visitenkarte zur Eintrittskarte, auch eine Strategie.
Na gut, so funktioniert es auch in Deutschland. Aber an einem dieser Abende mit einem dieser vielen Empfänge aus einem der vielen europäischen Anlässe machte Röllenblech eine entscheidende Erfahrung, was Brüssel von sagen wir zu Hause unterscheidet. »Ich bin an dem Abend dreimal gefragt worden, was denn meine Hauptsprache sei. Man hat nicht gefragt, wo ich herkomme! Sondern was meine erste Sprache ist. Ich hab dann kapiert: Es geht in Brüssel nicht um Nationalität und Herkunft, sondern um Verständigung. Dass man miteinander reden kann.«
Eine weitere bemerkenswerte Erfahrung zeigte dem Kommunallobbyisten zugleich die Grenzen seiner Arbeit auf. In Brüssel sind Lobbyisten durchaus willkommen. Dem EU-Parlament fehlt zum Beispiel der wissenschaftliche Dienst, den der Deutsche Bundestag um fachkundige Auskunft befragen kann. Auch die Kommissionsbehörden sind nicht allwissend, sondern auf Wissenszugänge angewiesen. Das ist die Chance der Interessenvertreter. Die Lobbyisten, die nach Brüssel geschickt werden, gehören auch immer zu den Besseren und Besten ihres Fachs. Die Expertise der externen Berater ist deshalb in Brüssel erwünscht und willkommen. »Man möchte in Brüssel ja keine Entscheidungen treffen, die nur für Deutschland oder nur für Frankreich oder ein anderes Land gelten«, erläutert Röllenblech. »Man versucht, allgemeine Regelungen zu treffen, die für alle 28 Mitgliedstaaten gelten und die weit, weit nach vorne gedacht sind.« Europa als Sündenbock – die Zeiten sind nicht mehr so. VERGANGENHEIT:
ländlich: Kreis gehört zu den größten landwirtschaftlichen Produzenten • industriell: Bergwerk Ibbenbüren wird 2018 als letzte Steinkohlenzeche in Deutschland geschlossen • schon früher beträchtliche Arbeitsplatzverluste durch Standortschließungen Heeresflieger Rheine und Karmann-Autowerke • seit Millenniumswechsel dennoch rund 10.000 Arbeitsplätze geschaffen
Wie weit nach vorne, lässt sich sogar ziemlich genau sagen. Meist zwischen fünf und sieben Jahren im Voraus. Das ist der Vorlauf, den eine siebenjährige Förderperiode zur Vorbereitung benötigt. Die aktuelle Kommissionsstrategie »Europa 2020« – Leitinitiativen für intelligente, nachhaltige und integrative Entwicklungen – ist 2010 beschlossen und in den zehn Jahren davor vorbereitet worden. Ähnliches gilt für die Ausrichtung der insgesamt fünf EU-Strukturfonds, die beispielsweise die regionale oder soziale Entwicklung in bestimmte Richtungen steuern sollen. Für alle gleich heißt dabei nicht ohne Unterschiede. So rechnet Udo Röllenblech nicht damit, dass Brüssel den deutschen Meisterbrief abschaffen wird. »Aber vielleicht wird etwas Gleichwertiges benannt.« Eine Abschaffung sähe er ziemlich kritisch, das käme ja einer Bevormundung gleich.
ZUKUNFT:
zukunftsträchtigen Wirtschaftsmix aus Gewerbe, Industrie, Tourismus und Freizeit fortsetzen • Strukturwandel nach Zechenschließung Ibbenbüren meistern (Strategiepapier »Wandel als Chance«)
Brüssel ist dem Rest Europas also Jahre voraus. Was in der belgischen Hauptstadt diskutiert wird, kommt mit jahrelanger Verspätung in den Regionen an. Das muss man wissen, wenn man auf Prozesse und Entscheidungen Einfluss nehmen will. Die unterschiedlichen Abläufe und Vorstellungen erschweren allerdings die Informationen Richtung Heimat. »Vieles, was man aus Brüssel berichtet, wird zu Hause oft nicht wahrgenommen. In Brüssel arbeitet man schon an der Förderung für sieben Jahre später, zu Hause nimmt man gerade das wahr, wofür es aktuell Fördermittel gibt. Das ist ein ganz schwerer Spagat, den alle erleben, die Europaarbeit machen.« Will sagen: Die Kommunen müssen weiter vorausdenken, als sie es vielleicht bisher tun.
Zwei wirklich spürbare und nachhaltige Erfolge reklamiert der Verwaltungsfachmann aus seiner Zeit für die lokale Seite. Wohlverstanden: nicht seine, sondern Erfolge aller kommunalen Stimmen in Brüssel. »Wir haben erreicht, dass nicht nur schwache Strukturen gefördert werden, sondern auch Stärken gestärkt, sprich mit Geld unterstützt werden. Das gilt jetzt auch in NRW und war damals erstmalig.« Profitiert haben davon etwa das Münsterland und auch der Kreis Steinfurt, die zum Beispiel ihre touristischen Angebote mit Geld aus Brüssel »stärken« und sich als attraktive Urlaubsregion bei der Grünen Woche in Berlin präsentieren konnten. Zweites Beispiel: die gerade in Deutschland viel kritisierte Dienstleistungsrichtlinie. Hier konnte das »Herkunftsprinzip« entschärft, de facto sogar »umgedreht« werden. Ursprünglich sollte für die Anbieter von Handwerksarbeiten, allgemein Dienstleistungen, das Recht des Herkunftslandes gelten. Für einen polnischen Maurer in Köln also polnisches Recht. Jetzt gilt das Recht des Ausführungsortes mit vielleicht strengeren Standards.
2009 hat der Kreis Lippe die Stelle in Brüssel übernommen. Mittlerweile trug der Landkreistag etwa die Hälfte der Kosten und eine andere Kommune sollte die Arbeit fortsetzen. Ohnehin haben sich nach Ansicht des Steinfurter Landrats Thomas Kubendorff die Verhältnisse in Brüssel geändert, der Einfluss kommunaler Stellen habe sich verändert (siehe Interview »Kommunen kommen an Europa nicht vorbei«). Ein Ende der kommunalen Europaarbeit sieht Udo Röllenblech damit jedoch nicht gekommen. Die Europabeauftragten seien für die Entwicklungen in den Kommunen weiter von Vorteil. Ihr Anforderungsprofil: »Sie sollten viele persönliche Kontakte haben oder sich erarbeiten können. Europaarbeit darf nicht eine von tausend ihrer Aufgaben sein; sie müssen sich schnelle Wege in der Verwaltung erschließen, am besten bei der Verwaltungsleitung angesiedelt sein und auch schon mal für das Haus sprechen dürfen – wenn sie es denn können«, so der 45-Jährige. Und eines sollte nicht zur einzigen Aufgabe eines Europabeauftragten werden: Fördermittel beantragen. »Da sind oftmals Experten gefragt, die das notwendige Fachwissen und entsprechende Kompetenzen haben.«
Vier Jahre hat Udo Röllenblech in Brüssel gelebt und Kontakte geknüpft, Veranstaltungen und Empfänge besucht, Informationen hin und her transportiert, in dieser Zeit sogar einen Direktor aus der Generaldirektion für Regionalpolitik zu einem mehrtägigen Besuch in den Kreis Steinfurt gelotst und am Ende eines jeden Jahres 450 Überstunden gezählt. Neben zahlreichen einzelnen großen und kleinen Geschehnissen hat sich ein Punkt nachhaltig bei ihm festgesetzt. »Ich bin erst in Brüssel überzeugter Europäer geworden. Das Gerede vom Raumschiff Brüssel stimmt zwar irgendwo auch. Aber die Idee ist faszinierend, an einem gemeinsamen Europa zu bauen, bei dem alle zu ihrem Recht kommen.« Auf Deutsch – oder in einer anderen EU-Sprache.
Europa? Wir kriegen’s gebacken!
EUROPA IST FÜR VIELE EINE SACHE DES VERSTANDES, eine Angelegenheit für den Kopf. Es gibt Vernunftgründe genug, für Europa zu sein. Frieden, Wohlstand, Menschen- und Bürgerrechte zum Beispiel. Oder Reisefreiheit, Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechte. Das »Gefühl Europa« kommt dabei nicht selten zu kurz. Das Projekt »Schaufenster Europa« in Steinfurt-Burgsteinfurt wollte das ändern. Europa hören, sehen, fühlen, anfassen und mitgestalten hatten sich die Organisatoren auf die Fahnen geschrieben – und das gleich vier Wochen lang.
Einen kompletten Monat lang – im Mai 2013 – bestimmte Europa die Innenstadt des 18.000 Einwohner zählenden Stadtteils von Steinfurt. Fußgängerzone und Straßen zwischen den Fachwerkhäusern und modernen Gebäuden waren mit europäischen Fahnen geschmückt, fast jedes zweite Schaufenster zeigte europäische Themen. Insgesamt fanden in den vier Wochen 28 Veranstaltungen statt, fast jeden Tag eine andere. Darunter Theaterspiele, Ausstellungen, Zeitzeugenberichte, musikalische, literarische und kulinarische Überraschungen. Ein Riesenangebot für die Bürger und Besucher. Udo Röllenblech vom Europe-Direct-Büro bei der Wirtschaftsförderung des Kreises: »2013 hatte die EU zum Jahr der Bürger erklärt. Das wollten wir mit dem ›Schaufenster Europa‹ feiern und zeigen, dass Europa überall ist, wo die Bürger sind, auch da, wo wir alle zu Hause sind.« Ein Europa voller Farbe, Freude, Gefühl und Überraschungen erleben, das war die Absicht der Europafreunde vom Amt.
Eine dieser Überraschungen servierte Konditormeister Berthold Probst über die Ladentheke. Er betreibt das größte und mit mehr als 40 Jahren älteste Café in Burgsteinfurt. Viele Menschen aus den Niederlanden, aus Frankreich und England kommen auf Besuch in den Ort. Burgsteinfurt bietet mit rund 80 Einzelhandelsgeschäften ein für eine Kleinstadt vielfältiges Geschäftsangebot. Auch viele Bü...