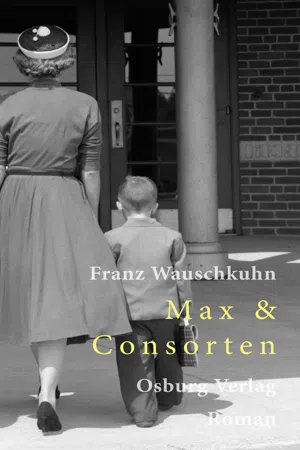![]()
1.Von Schweinen und Menschen
Dürft’ ich einmal sehen
Dein heimliches Walten
Und dann verstehen.
So hebe Du auch mich
vom Staube zu Dir auf,
nur einen Augenblick
zu sehen, wie Du lenkest
aller Welten Lauf,
die Ursache zu sehen
der Dinge sonder Zahl,
Die wunderlich geschehen.
Carl von Linné, Uppsala 1765
Adolf war kein Eber, sondern eine Sau – wie Eva. Aber so hießen die Schweine. Keiner störte sich daran. Die beiden rosigen Säue hausten in zweiter Generation in der Garage. »Kaffeemühlen« nannte man die quadratischen Backsteinhäuser, die während der 1920er Jahre solide für kleineres Geld errichtet worden waren. Obgleich das Haus von Werner und Lydia Lück nach außen Ruhe und Gediegenheit ausströmte, war es innen tagsüber von Kinderlärm, von unentwegtem Auf und Ab auf den Holztreppen erfüllt. Es gab nur drei Ruhepole: ein Herren- und ein Damenzimmer, in das sich Erwachsene und etwaiger Besuch flüchteten, und das Schlafzimmer der Eltern.
Der breitwangigen Köchin Rosi oblag die Kindererziehung, weil die Kindermädchen regelmäßig nach sechs Monaten kündigten. Köchin und Kindermädchen verfügten über winzige Verschläge unter dem blauen Spitzdach. Die waren Tabuzone.
Irgendwie gehörte auch Max Coehn zum lebenden Inventar. »Mäxchen, hier weiß ich dich in bester Obhut«, sagte seine Mutter Babette, die häufig verreiste. Auf ein Kind mehr oder minder kam es bei Lücks nicht an. Max schlief einige Tage – manchmal wurden es mehrere Wochen – im Zimmer der Zwillinge Henning und Rolf auf einer Wolldecke. Die wurde abends auf dem Fußboden ausgebreitet. Im Sommer 1950, als Max fünf geworden war, hatte ihn Dr. Lück aus dem Garten auf die Veranda gerufen und ihm mit seinen fleischigen Fingern das Stethoskop auf Brust und Rücken gesetzt. Er war Lungenfacharzt. Dann hatte er dem Jungen einen Klaps auf den Po versetzt: »Schieb ab, Mäxchen. Alles in Butter.«
Lydia und Babette, die selbst in schlimmster Zeit Kontakt gehalten hatten, waren sich 1928 zum Ball des Studenten-Corps Borussia in Berlin-Mitte begegnet. Die zarte, mit ihren dunklen Augenringen anämisch ausschauende, doch stets elegant auftretende Lydia hatte sich dort in den grobschlächtigen Mediziner aus Ostholstein verliebt, ihn gegen den Willen ihres Vaters, eines erfolgsverwöhnten Berliner Bauunternehmers, geheiratet und nach und nach acht Kinder zur Welt gebracht. »Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wird man nie verstehen«, wunderte sich ihre Freundin Babette ein ums andere Mal, wenn sie die weiße, hölzerne Gartentür schloss.
Die Hungerjahre des Ersten Weltkriegs hatten sich Werner Lück ins Gedächtnis gebrannt. Deshalb hatte er im Herbst 1939 unten in der Garage einen Schweinekoben gezimmert: Küchenabfälle, alte Pflaumen, Äpfel, Eicheln und Kastanien gibt’s genug. Zwei Schweine lassen sich davon mästen. Sein DKW-Dreitakter werde ohnehin nicht geklaut. »Benzin ist rationiert. Das kriegt man nur mit Vitamin B.« Lydia hatte ihm nicht widersprochen – das tat sie so gut wie nie –, war in ihr Damenzimmer entschwunden und hatte auf dem Zeichenblock Kostüme entworfen – im Stil von Coco Chanel. Sie hatte den Studiengang Modezeichnen zum Sommersemester 1927 an der Kunsthochschule Berlin begonnen, aber nicht beendet.
Adolf und Eva grunzten und quiekten im Koben so laut, dass sie selbst in den Kinderzimmern des ersten Stocks zu hören waren. Max fand, es seien die lustigsten Schweine der Welt. Öffnete man die Garagentür einen Spalt, grunzten sie freudig Begrüßung, stellten ihre spitzen Ohren auf und blinzelten die Kinder mit ihren wachen blauen Augen erwartungsvoll an. Henning und Rolf, die Zwillinge unter den acht Geschwistern Lück, wedelten häufig die Garagentür hin und her, womit sie Quiekorgien provozierten. Passanten drohten mit dem Zeigefinger.
»Ihr müsst Adolf und Eva in Ruhe lassen, sonst werden sie nie Speck ansetzen«, mahnte die Köchin. »Außerdem kriegen sie Angst vor Willy.« Das war der schwarz-weiße Hirtenhund der Familie, der nie gebürstet wurde. Den Zwillingen zottelte er wie ein Schatten hinterdrein. Als Schweinetrog diente eine verbeulte Kinderwanne aus Zink. Ständig leckte braune Brühe heraus. Eklig fanden das nur die Mädchen. Die Jungen schauten fasziniert zu, wenn Adolf und Eva schmatzend modrige Äpfel, Suppenreste aus der Küche oder Unmengen wässriger Kartoffelschale fraßen.
Auch die Familien der Nachbarschaft aßen immerzu Kartoffeln: Kartoffeln mit Quark, mit Salz, mit Erbsen, mit Tomaten. Bratkartoffeln mit Hering gab es ausnahmslos in den Familien, die im Altonaer Fischereihafen und am Fischmarkt zu tun hatten. Sie galten als privilegiert. Kartoffeln wurden im Garten gezogen, auf Flächen, die vordem als Zierrasen oder Rosenbeet gedient hatten, oder wurden bei Verwandten organisiert. Babette Coehn hielt stets zwei Netze in petto. Hatte sie jemandem ihr Bohnerwachs angedreht und im Flur oder einer Kellerecke eine Kartoffelhorde erspäht, fragte sie: »Ach, sagen Sie, was für eine Sorte? Bintje? Ackersegen? Dürfen wir mal probieren?« Ohne das Ja der Hausfrau abzuwarten, hatte sie blitzschnell ihr Netz gefüllt. Sie sagte: »Seien Sie herzlich bedankt.« Weg war sie.
Ihre eigene Kartoffelhorde war ab März so gut wie leer. Die restlichen Kartoffeln, der eiserne Bestand, fingen unerbittlich an zu keimen. »Ihr Männer könnt Kartoffeln putzen«, sagte Babette zu ihren drei minderjährigen Söhnen. Zuunterst fanden sich wässrige, faulig süßlichen Gestank ausdünstende Kartoffeln, die sofort durchs Kellerfenster in den Garten flogen, wo die Hühner sie auspickten.
»Wenn wir nicht ewig Ratten hätten, hätten wir keine angefressenen Kartoffeln«, schimpfte Babette. Sie bestand darauf, dass ihre Söhne sie Mama nannten: »Mutti klingt abscheulich.«
Die Ratten kamen durchs Küchensiel. Dessen gusseiserne Abdeckung fehlte. Es gab Tage, da sprangen sie aus der Klosettschüssel ins Haus, auch die war früher mit einem Deckel versehen gewesen. Es ist unmöglich, Ratten im Lauf zu erschlagen. Achim und Peter, die älteren Brüder von Max, hatten es ein ums andere Mal versucht. Seither herrschte brüderliche Arbeitsteilung: Hörten sie unter der Kartoffelhorde Ratten nagen, nahm Mäxchen einen Weidenstock, legte sich bäuchlings auf die kalten Bodenfliesen und schlug mit einer dünnen Rute wie wild unter der Horde hin und her.
Anfangs drückte sich die Ratte in die Ecke, dann stieß sie einen kreischenden Laut aus und sprang zum Angriff der Rute entgegen. Darauf musste Max gefasst sein, rasend schnell wieder und wieder nach ihr schlagen. In ihrer Panik stieß die Ratte unter der Horde hervor. Aber da ereilte sie das umgekehrte Ende des Holzschrubbers, mit dem Achim oder Peter gelauert hatten. Die berstenden Knochen knirschten. Mit einem Eimer Wasser wurde das Rattenblut ins Küchensiel geschwemmt. »Das ärgert die anderen Ratten«, wusste Peter.
»Ihr kriegt die Pest, wenn ihr sie anfasst«, hatte Babette gesagt. Aber Mäxchen strich mit dem Zeigefinger jeder Ratte zwischen den Ohren, sobald sie vor ihm lag. Das musste er.
Im Winter warfen die Jungen jeden Kadaver mit der Kehrschaufel in den Ofen. Es roch noch lange. Im Sommer steckten sie die Kadaver in den Mülleimer. Manchen Leuten passierte unversehens das Malheur, vor ihrer Haustür in eine tote Ratte zu treten. Dies Missgeschick ereilte allerdings nur Mitmenschen, die Babette kein Bohnerwachs abkauften. »Bohnerwachs – von ’ner Jiddn!«
Die Zwillinge hatten die Idee: »Wenn Schweine alles fressen, fressen sie auch tote Ratten.« Unglücklicherweise hatte Max an jenem Sommertag nur eine einzige parat. »Wir brauchen aber zwei. Eine für Adolf, die andere für Eva.« So strichen drei Tage dahin, bis die Brüder Coehn die zweite Ratte morgens kurz vor sieben, noch vor dem Gang zur Schule, erlegten. Babette schüttete den Haferbrei gerade aus dem Aluminiumtopf in die Teller, da hatte Max die Ratte zwischen seinem Stuhl und dem Bein des Küchentischs entdeckt. Sie war fett, blickte doof zu ihm hoch und bewegte sich erstaunlich behäbig. Ein leichtes Opfer. Peter schlug von hinten mit dem Schrubber zu. Kein Pieps war zu hören. »Die war trächtig«, sagte Peter, studierte eine Ewigkeit die blutigen Eingeweide und warf sie schließlich durchs geöffnete Souterrainfenster. »Die Katzen freuen sich.« Babette und Achim ließen ihre Teller stehen. Der Haferbrei erkaltete zu Fladen.
Als die Zwillinge und Max die rechte Garagentür öffneten, grunzten die Schweine gut gelaunt. Henning und Rolf ahmten das Grunzen nach und traten vor die Bretter des Kobens. Alles geschah nun blitzschnell: Auf die Schnuten von Adolf und Eva plumpsten die Rattenkadaver. Die Schweine stießen Angstschreie aus und warfen sich panisch gegen die Kobenwand. Die unteren Bretter barsten. Im Nu waren Adolf und Eva auf der Straße.
Die Jungen liefen hinterdrein. Doch das Angstgeschrei der Schweine wurde nur lauter. Sie galoppierten davon, hielten witternd inne und trappelten dann gemächlich werdend von der Anhöhe der Dürerstraße zum S-Bahnhof Othmarschen hinab. »Adolf, Eva«, riefen die Jungen. Ab und an schielte die Sonne zwischen den Wolken hervor. Die Schweine spitzten zwar die Ohren, aber keines schien gehorchen zu wollen. Gehört aber hatten die Kinder in den umliegenden Gärten.
Als die Säue die Bahnunterführung querten und sich daranmachten, die kleine Wiese am Statthalterplatz umzuwühlen, waren es mehr als zwanzig Jungen und Mädchen. Die lachten und schwatzten, während es Henning, Rolf und Max mulmig zumute wurde. »Einkesseln müssen wir sie«, schrie Rolf. Doch das war mit Adolf und Eva nicht zu machen. Sie hoben drohend Kopf und Rüssel, schnauften und liefen stracks auf ein Mädchen mit rotem Pony-Haarschnitt zu. Die Kleine wich entsetzt zurück. Die Säue besannen sich.
Morgens und nachmittags war der Statthalterplatz voller tarnfarbener Tommy-Laster, die Hunderte britischer Besatzungssoldaten vom Feldflugplatz an der Wilhelmshöhe zur S-Bahn brachten. Noch im März 1945 waren dort Abfangjäger der Luftwaffe gestartet. Doch just als die beiden Schweine nun mehreren Hauseingängen ihre Aufwartung machten, waren weder plattschnäuzige Armeelaster noch Privatautos zu sehen. Die Kinder johlten: »Adolf, Eva, Adolf, Eva.« Alte Damen öffneten erbost die Fenster und drohten mit der Polizei. Kein Kind scherte sich darum. Stattdessen versuchten sie, die Schweine am Schwanz zu packen. Die wichen jedoch geschickt aus, tänzelten hin und her, um in einiger Entfernung plötzlich erneut wie angewurzelt stehen zu bleiben. Bis endlich Willy auftauchte. Nie haben ihn die Zwillinge und Max mehr geliebt als damals. Nach Art der Hirtenhunde begann er die Säue zu umkreisen, bellte sie mehrfach mit dem gelassenen Ernst eines Oberlehrers an und trieb sie souverän zurück in die Garage. Der Hund verstellte ihnen weitere Exkursionen.
»Hätten wir Deutschen doch so einen Willy gehabt«, sinnierte die Köchin. Henning und Rolf mussten ihren Eltern haarklein beichten. Sie schrien erbärmlich unterm Rohrstock. Zwei Tage lang konnten sie weder auf einem Stuhl noch auf der Schulbank sitzen. Ihr Vater berichtete beim Abendbrot vom Anruf eines Unbekannten, der gedroht hatte: »Wer den Namen des Führers und der hohen Frau versaut, gehört ins KZ.« Werner Lück hatte ihm lakonisch geantwortet: »Was das Schwein verbrochen hat, müssen die Ferkel büßen.« Das verschwieg er aber, als er die Kinder ermahnte: »Macht das nie, nie wieder! Ich brauch für unsere Praxis Privatpatienten, also Raucher. Also auch Nazis.«
»Wer hat angerufen?«, fragte Heidi beim Abendbrot. Ihre mongoloiden Augen wanderten vom Vater zur Mutter. Sie war im Juli 1943 geboren, pünktlich zur Operation Gomorrha, dem ersten Großangriff der Royal Air Force auf Hamburg. »Heidi hat einen Geburtsschock erlitten, weil es so fürchterlich gerumst hat und die Häuser plötzlich alle schaukelten. Deshalb ist sie nicht so wie ihr«, hieß es. Ihre Geschwister akzeptierten Heidi. Ja, sie hatten sie besonders gern. Heidi verstand Situationskomik und lachte so glucksend, dass sie alle damit ansteckte. Dann lachten plötzlich alle Geschwister. »Seid ihr meschugge?«, stöhnte die Köchin.
Als Babette von der Schweineoper erfuhr, rief sie Max und knallte ihm eine Ohrfeige: »Du sollst keine Ratte anfassen, schon gar nicht in der Hosentasche rumschleppen.« Abends neigte sie sich über sein Kopfkissen und flüsterte in sein schmerzendes Ohr: »Ich hab so gelacht, kleiner Mann. Mach weiter.« Er schlief glücklich ein.
![]()
2.Kinder, Kinder …
Dicker legte den Tippeltoppel über die Ritze zwischen Fußweg und Kantstein. Alle Kinder schauten gespannt. Der Tippeltoppel, also ein knapp zwanzig Zentimeter kurzes Aststückchen, das beidseitig konisch zugespitzt wird, fliegt bekanntlich nur weit, sofern er so sacht mit dem Stock hochschleudert wird, dass man in der Luft noch ein-, ja zweimal nachschlagen kann. Diese Geschicklichkeit besaßen Dicker und Max.
»Max, Mäxchen«, rief Babette. Er blickte sich um. Da stand sie zwischen den weißen Pfosten der Gartenpforte. Sie trug ihr blaues Kleid, das mit den großen weißen Punkten. Sie zog es sonntags an, wenn sie ihren Söhnen befahl, mit ihr spazieren zu gehen. Ein anderes Kleid besaß Babette nicht. Eines Morgens, beim Überstreifen, hatte sie gesagt: »Mit den Weibern hier kann ich’s allemal aufnehmen«, hatte sich über Brust und Hüften gestrichen und sich dabei vor ihrem winzigen Schrankspiegel hin und her gewendet.
Max wusste nur zu gut: Sie war ungeduldig – stets – und unberechenbar. Aber schließlich war er als Nächster dran mit dem Tippeltoppel. Auch die anderen Kinder taten, als hätten sie Knetgummi in den Ohren.
»Max«, rief Babette wieder. Es klang schon gereizt. »Wir wollen los!«
»Verzieh dich bloß«, sagte Dicker lässig mit rauer Stimme und der Tippeltoppel flog. Er rannte hinterher, schlug ein-, zwei-, dreimal. Es war die beste Schlagfolge, die er bisher geschafft hatte. Weshalb ihn alle Dicker nannten, wusste niemand, denn Hans Georg, wie er richtig hieß, war ein schlankes, drahtiges Kerlchen. Außerdem war er sehr schlau und zeigte Erwachsenen gegenüber einen ausgesprochenen Charme.
»Du kommst jetzt, aber sofort«, war Babette zu vernehmen. Das klang bereits wie eine Strafandrohung: »Wenn du nicht hörst, sitzt du heut Nachmittag wieder unter der Terrasse!« Stinkig war es dort zwischen feuchtem Bruchholz und den Briketts für die Öfen. Natürlich gab es unter der Terrasse auch Ratten, aber sie nahmen keine Notiz von Max, wenn er dort Strafe absitzen musste. Abwechslung gab’s nur, wenn Dicker leise durch die Rhododendren ans Drahtgitter schlich, hinter dem Max hockte. Mit dem Schuhabsatz drehte Dicker eine kleine Kuhle. Durchs Gitter konnte Max die Murmeln werfen.
»Ja-a«, schrie er und lief Babette entgegen.
»Du darfst dir aussuchen, wohin wir gehen: Zu Großmama oder zum Friedhof?«, sagte sie. Keine Frage: Auf dem Friedhof war es besser. Zwei Reihen hinter Großpapas Grab gab es einen glatten Sandsteintrog, aus dem Leute mit Gießkannen Wasser schöpften. Als Kind konnte man bequem darin baden, wenn das Wetter warm war.
»Zu Großpapa«, sagte Max. Babette umarmte ihn. Weil sie so angenehm duftete, legte er gern den Kopf an ih...