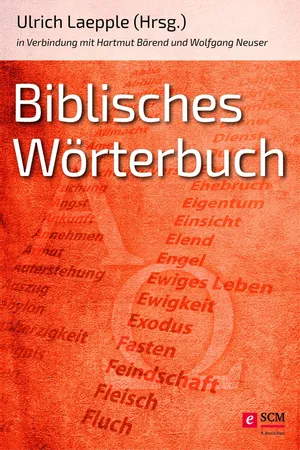
eBook - ePub
Biblisches Wörterbuch
- 624 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Biblisches Wörterbuch
Über dieses Buch
Ein seit Jahrzehnten bewährtes Nachschlagewerk erscheint in neuer Form: das Biblische Wörterbuch. Es führt in alle wichtigen Begriffe der Bibel (so etwa "Abendmahl", "Heiligung", "Gemeinschaft" oder "Offenbarung") ein und erklärt diese in klarer, gut verständlicher Weise. Dabei werden die Wortbedeutung, der biblische Hintergrund und vor allem die Bedeutung für unser Leben heute ausführlich dargestellt.
Das Biblische Wörterbuch ist eine Hilfe für jeden, der biblische Inhalte für sich erschließen und an andere vermitteln möchte. Was der christliche Glaube aussagt, wird dabei gerade den Nicht-Theologen in ansprechender Weise vor Augen geführt.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
G
Gebet/Bitten
I. Wortbedeutung
Das AT kennt 19, das NT 14 Ausdrücke für Gebet und Bitten. Das schon mag ein Hinweis auf die unterschiedlichsten Nuancen und Gebetssituationen sein, die in der Bibel vorkommen. Dem dringlichen Bitten im Sinne des »Forderns« steht ein »Anflehen« (wörtl. »weich machen«) gegenüber. »Sich ins Mittel legen«, also die Mittlerrolle eines Beters, die er mit seiner ganzen Existenz trägt, gehört ebenso zum biblischen Beten wie das Bußgebet (»Herr, sei mir Sünder gnädig«). Eine besondere Stellung nimmt die Anbetung ein (griech. proseuchä, wörtl. »sich ergießen«). In ihr vergisst der Mensch sich und seine Bedürfnisse und »ergießt« sich mit seinem ganzen Sein bewundernd, lobend und preisend vor Gott (z. B. Röm 11,33-36).
II. Die Begriffe in der Bibel
1.) Gott hört jedes Gebet und erhört es auf seine Weise
Die Bibel kennt keine genau ausgeführte Lehre vom Gebet. Aber einige Grundlinien lassen sich deutlich erkennen: Jedes Gebet ist seinem Wesen nach eine Zwiesprache mit Gott. So redeten z. B. Adam (1Mo 3,10), Kain (1Mo 4,9) und Abraham (1Mo 18,23ff) in klar erkennbarer Wechselrede mit Gott. Häufiger wird in der Bibel von Gebeten berichtet, auf die keine akustisch wahrnehmbare Antwort erfolgt. Und doch hört Gott jedes Gebet. Manchmal ist Gottes Reaktion ein Ereignis. Aber auch sein Schweigen kann eine Antwort sein. Vielleicht erprobt Gott durch Schweigen wie bei Hiob den Glauben. Oder aber es gilt der Satz: »Ihr bittet und empfanget nicht, weil ihr in übler Absicht bittet« (Jak 4,3; ähnlich auch Kla 3,8.44). Ja, wir kennen sogar das Gerichtswort: »Wer sein Ohr abwendet, um die Weisung nicht zu hören, dessen Gebet ist ein Gräuel« (Spr 28,9; vgl. Ps 109,7).
2.) Das Gebet in den Psalmen
Die Psalmen haben weitgehend die Form der Anrede an Gott, also den Charakter von Gebeten der → Buße, der Bitte, etwa aus großer Not heraus, und des Dankes für erfahrene Hilfe. Der Tempel- bzw. Synagogengottesdienst hatte Raum dafür, dass Teilnehmer, namhafte wie David oder auch namenlose, in der versammelten Gemeinde Bitte und Dank, auch in eigener Sache, zum Ausdruck brachten. Und die Gemeinde betete und dankte mit. Anschließend wurden solche Gebetslieder im Gotteshaus in Verwahrung genommen und in der Folge immer wieder bei den Gottesdiensten verwendet. Schließlich wurden sie der entsprechenden Sammlung, dem »Gesangbuch« und »Gebetbuch« → Israels, dem Psalmenbüchlein, eingefügt. In den Psalmen wird oft auch die Not des ganzen Volkes Israel vor Gott gebracht und ebenso der Dank für die hier erfahrene Hilfe. Beispiele von Psalmen, die Gebete sind: Psalm 3; 4; 5; 6; 8; 12; 13; 16; 18; 22; 25; 26; 30; 31; 36; 42/43; 51; 56; 57 und viele andere. Manchmal gehen hier Worte an Menschen über zu Worten, die an Gott gerichtet sind.
3.) Jesus als Beter
Die Evangelien erwähnen oft, dass Jesus betete, vor allem an besonderen Weichenstellen seines Lebens (Lk 3,21; Mt 14,23; Lk 9,18.28-29). Er suchte in der Stille der Morgenfrühe das Gespräch mit seinem Vater und kam für die Begegnung mit den Menschen und ihrer Not bereits her von Gott (Mk 1,35). Bevor er den engeren Kreis seiner → Jünger einschließlich Judas endgültig berief, war er eine ganze Nacht lang in der Zwiesprache mit seinem Vater (Lk 6,12ff). Die Frage ist: Woher kommen wir, wenn wir die großen und kleinen Entscheidungen unseres Lebens treffen? Vom Selbstgespräch unserer Gedanken, von dem, was uns gerade gut erscheint oder die Menschen von uns erwarten, oder aber ebenfalls von Gott und der Zwiesprache mit ihm? Als die Jünger Jesus beten hörten, wurde ihnen der Mangel ihres Gebets bewusst. Darum baten sie ihn: »Herr, lehre uns beten« (Lk 11,1).
Ein besonderes bemerkenswertes Gebet ist das große Sichverantworten und die große Fürbitte Jesu am Vorabend seines Todes, das »Hohepriesterliche Gebet« in Joh 17. In Gethsemane rang sich Jesus im Gebet dazu durch, das → Kreuz und damit alle Sündenlast der ganzen Menschheit freiwillig auf sich zu nehmen (Mt 26,36ff). Die letzten Worte Jesu am Kreuz waren weitgehend Gebetsworte, zum Teil Worte aus den Psalmen: »Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? (Mt 27,46; Ps 22,2). »Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände« (Lk 23,46; Ps 31,6).
4.) Leben in der Atmosphäre des Gebets
Die Urgemeinde hielt einmütig fest am Gebet (Apg 1,14). Als Petrus im Gefängnis lag, betete die Gemeinde »ohne Aufhören für ihn zu Gott« (Apg 12,5). Paulus betont in vielen Formulierungen dieses »Beten ohne Aufhören« (z. B. 1Thess 5,17) und beschreibt es an einem eigenen Beispiel: »… indem wir nachts und tags über die Maßen flehen, dass wir euer Angesicht sehen mögen und euch zurechthelfen in den Mängeln des Glaubens« (1Thess 3,10).
5.) In der Erwartung der Erhörung
Das ist nicht selbstverständlich, sonst wäre die Aufforderung überflüssig: »Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht« (Jak 1,6). Daher lasse man sich Zeit zum Gebet. Ein »Plappern wie die Heiden«, die meinen, dass sie erhört werden, »wenn sie viele Worte machen« (Mt 6,7), bleibt wirkungslos, weil die Gedanken dabei nicht auf Gott, sondern auf sich selbst gerichtet sind. Das Gegenstück dazu ist das Gebet der Urgemeinde, von dessen Intensität eine große Wirkung ausging: »Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren; und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut« (Apg 4,31). Durch das Gebet der Gemeinde wurde Petrus aus dem Gefängnis befreit (Apg 12); durch Beten, Loben und Danken wurden Paulus und Silas die Türen im Gefängnis in Philippi geöffnet (Apg 16).
6.) Wie Gott Gebet erhört,
das ist seine Sache
das ist seine Sache
Jenen eben genannten verblüffenden Gebetserhörungen stehen andere Antworten Gottes auf Gebete der Gläubigen gegenüber: Obwohl Paulus in intensivem Gebet für eine Befreiung von einem »Dorn« in seinem Leib (Luther: »Pfahl im Fleisch« – möglicherweise eine Krankheit oder eine Wesensart) bat, erhielt er als Antwort den Hinweis: »Lass dir an meiner → Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig« (2Kor 12,8-9). In Apg 12 wird nicht nur von der Befreiung des Petrus berichtet, sondern auch davon, dass Jakobus hingerichtet wurde (V. 2). Es ist anzunehmen, dass auch für ihn die Gemeinde intensiv gebetet hat. Da Gottes Gedanken höher sind als unsere Gedanken, dürfen wir in solchen Führungen eine höhere → Weisheit Gottes sehen und trotzdem (oder gerade deshalb) mit der Wirksamkeit der Gebete rechnen.
7.) Die Fürbitte
Im Ganzen der Schrift spielt die Fürbitte eine große Rolle. Sie ist ein Dienst besonderer Art, den ein Mensch damit tun kann, dass er die äußeren und inneren Anliegen anderer, Einzelner oder vieler im Gebet vor Gott bringt. Im AT sehen wir große Fürbitter: Abraham für Sodom; so ausführlich betete er in eigener Sache nie (1Mo 18,16-33). Mose für Israel; er war sogar bereit, seine eigene Seligkeit zum Opfer zu bringen (2Mo 32-34, insbesondere 2Mo 32,32; vgl. Röm 9,3). Daniel für sein Volk; er, der für Gott in die Löwengrube gegangen war, fasste sich dennoch mit seinem untreuen Volk in dem → Bekenntnis der Schuld und in der Buße zusammen (Dan 9,1-19). Im Neuen Testament sehen wir in den Evangelien Fürbitte vor allem da, wo Menschen bei → Jesus Hilfe für andere suchten: ein römischer Hauptmann, eine kanaanäische Frau, ein Synagogenvorsteher, ein königlicher Beamter usw. (Mt 8,5ff; 15,21ff; Mk 5,22ff; Joh 4,47ff).
In der Zeit der frühen Christenheit sehen wir viel an Fürbitte allgemein und insbesondere, wie die Gemeinde den Dienst der Boten des Evangeliums mit ihrer Fürbitte begleitete (Jak 5,16; Eph 3,14; Kol 1,3.9; 2Thess 1,11; Apg 12,5.12; 13,3; 14,23; Röm 15,30; Kol 4,3; 1Thess 5,25; Hebr 13,18 usw.). Vor allem Jesus tat (und tut) Fürbitte (Lk 22,32). Ja, es gehört zur Bedeutung des Kreuzestodes Jesu, dass er sich hier mit seinem ganzen Leben in seine große Fürbitte für die Welt hineingeopfert hat. Er ist der »große Hohepriester« und das Opferlamm in einem (Hebr 7,26-27; 8,1; 9.12.14; Joh 1,29; 1Joh 1,7). Er vertritt uns vor Gott (Röm 8,34; 1Joh 2,1).
Gottfried Schröter/Fritz Grünzweig
III. Die Begriffe heute
1.) Warum beten?
Beten ist nicht selbstverständlich, auch wenn Menschen in allen Religionen »beten« und sich immer schon an Gott wenden. Die Begründung für das Beten liegt jedoch in der → Verheißung, die Gott dafür gegeben hat. Beten gewinnt seine Bedeutung erst in der bestimmten Kommunikation mit dem Gott, der sich durch das Christusgeschehen in der Bibel offenbart hat. Deshalb ist mein Gebet schon die Antwort auf Gottes Anrede an mich. Der griechische Kirchenvater Basilius von Cäsarea sieht eine Entsprechung zwischen unserem Beten und der Art und Weise, wie Gott sich offenbart hat, nämlich als der Vater durch den Sohn (→ Sohn Gottes) im Heiligen Geist (→ Geist Gottes). Deshalb geschieht alles Beten in der »umgekehrten Richtung«, nämlich in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes durch Jesus Christus, also im Anschluss an sein Beten und sein Werk für uns, zum Vater im Himmel. Das ist mehr als formale Korrektheit. Darin liegt die innere Logik der Kommunikation mit Gott.
2.) Beten lernen
Beten ist das »Lebenszeichen« des Glaubens. Glaube besteht in der gelebten Beziehung zu Gott. Das Gebet ist dabei die Kommunikation mit Gott in allen Facetten. Automatisch fängt niemand zu beten an, auch Kinder nicht. Beten muss man lernen wie eine Sprache. Beten lernt man durch Beten, so wie man lieben durch Liebe lernt. Die inneren Regeln des Betens lassen sich nicht vom Beten selbst ablösen. Es muss eingeübt werden, mit Gebeten, die man sich äußerlich und innerlich angeeignet hat und an denen sich eigene Versuche schulen können. Aber ebenso wie beim Sprechenlernen gilt: Irgendwann muss man auch selber sprechen. Das freie Beten und das Sprechen von fest formulierten Gebeten inspirieren einander und sind wechselseitig aufeinander bezogen. Das Gebet des Einzelnen und das gemeinsame Beten hängen miteinander zusammen und bedingen einander.
3.) Vielfältiges Reden mit Gott
Mit Gott zu reden ist so vielfältig wie Gott selber, wie er sich uns zeigt, an uns handelt und mit uns redet. Im Gespräch mit Gott gibt es eine Reihe wiederkehrender Elemente und Sprachformen, die sich schon in den Psalmen finden. Da ist zuerst die Anrede, das »Anrufen« Gottes. In ihr kommt schon die gesamte Beziehung der »Gesprächspartner« zum Ausdruck. Im Anreden findet ein »Wiedererkennen« statt, das eine bestehende Beziehung erneut aufnimmt, eine abgebrochene erneuert oder neu konstituiert. In der Anrede sprechen wir Gott schon auf das an, was er uns bedeutet, was wir mit ihm schon erlebt haben oder was wir von ihm erwarten.
Auch im Gespräch mit Gott gibt es ein Erzählen, und beten lernen bedeutet in dieser Hinsicht, Gott mein Leben zu erzählen, dabei aber zwischen meiner Perspektive und Gottes Perspektive auf mein Leben noch unterscheiden können. Diese Differenz zwischen mir und Gott lässt das Beten jedoch nicht abbrechen, sondern kann wiederum betend zum Ausdruck kommen, im Aussprechen des Bekenntnisses etwa, dass Gott mich besser kennt als ich mich selber. Solches Erzählen ist viel mehr als Information, die Gott ohnehin nicht braucht. Gott an meinem Leben teilnehmen zu lassen bedeutet, »vor Gott zu leben« und erzählend wiederum an »Gottes Leben« teilzunehmen und mir seine Geschichte erzählen zu lassen.
Noch etwas anderes passiert beim Erzählen: Wir begegnen uns selbst, wenn wir Gott erzählen, was uns bewegt. Das kann befreiend sein, manchmal aber auch schmerzhaft, weil wir uns plötzlich nicht mehr wiedererkennen und unserer Schuld begegnen. Gott unsere Schuld zu bekennen und vor Gott auszusprechen, was uns von ihm trennt, ist nicht von oben verordnete Selbstkritik. Seine Schuld zu bekennen setzt gerade großes Vertrauen voraus und geschieht so wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn: zu Gott kommen und merken, dass er mir schon entgegeneilt. Kleinmut und Angst dagegen verhindern das freie Bekennen gerade und schaffen eine Atmosphäre des Verhörs und des Geständnisses.
Die Beziehung zu Gott kann gestört sein. Nicht nur durch Schuld, sondern manchmal durch den Eindruck, dass Gott nicht da ist. Die Klage ist Ausdruck einer solchen Diskrepanz zwischen dem eigenen Erleben und Ergehen, dem eigenen Leid – oder dem Leid anderer! – und Gottes Versprechen, da zu sein. Zu klagen ist mehr als der Ausdruck der eigenen Bedrohung oder der Krankheit. Es betrifft die Gotteserfahrung selber, wenn seine scheinbare gegenwärtige Abwesenheit oder Teilnahmslosigkeit nicht mehr mit der vergangenen Erfahrung seiner Nähe vermittelbar scheint. So ist die Klage zugleich die Art und Weise, Gott zu sagen, dass ich ihn (jetzt) nicht verstehe. Das kann, zum Beispiel bei Hiob, sogar Züge einer Anklage annehmen. Aber diese Anklage Gottes richtet sich eben an Gott selber und kann paradoxerweise die Beziehung unter Umständen sogar intensivieren und vertiefen. Diese Diskrepanz vor Gott auszusprechen bedeutet, an der Beziehung festzuhalten und auf Gott zu warten: »Wie lange noch …?« Und nicht darin nachzulassen, Gott anzurufen, ihn um sein Kommen zu bitten und mit diesem Kommen um alles, was wir zum Leben brauchen (Mt 6,33).
So gesehen steckt in jeder Bitte um etwas auch eine Bitte um Gott selbst. Im Bitten zeigt sich, wie meine Beziehung zu Gott wirklich aussieht, ob in der Bitte die Beziehung selbst vertieft oder verzweckt wird. Deshalb ist eine Bitte an Gott alles andere als ein magisches Verhalten, um Gott dazu zu bewegen, meine Wünsche zu erfüllen und unter Umständen etwas zu tun, was er sonst aus eigenem Willen nicht täte. Mit dem Zauberwort »bitte« kann nicht auf versteckte Weise Macht ausgeübt werden. Vielmehr spreche ich mein Gegenüber auf seine Freiheit und Liebe an. Deshalb müssen wir vor Gott nicht betteln oder ihn zu überreden versuchen, auch wenn es bei Jesus heißt, dass wir bei Gott ruhig ordentlich quengeln dürfen (Lk 11,8; 18,7-8), weil sich darin die Beziehung zwischen Gott und uns ausdrückt: nicht die von Bittstellern, sondern von Kindern zu ihrem Vater, den sie mit allem nerven dürfen – auch wenn der oft besser weiß, was die Kinder wirklich brauchen, und es mitunter besser ist, eine Bitte nicht zu erfüllen. Das bedeutet aber nicht, aus diesem Grunde nicht mehr zu bitten, denn so bräche die bestehende Beziehung ab.
4.) Gebetserhörung
Dass Gott wirklich hört, was wir ihm sagen, das kann ich ihm ähnlich wie in einem »normalen« Gespräch nur glauben, wenn er es sagt: »Ich höre dir zu.« Alles Tun, jede Reaktion kann zwar Zeichen von Aufmerksamkeit sein, ihr Ausbleiben bedeutet aber nicht, sicher zu wissen, der Betreffende hätte nicht zugehört. Dass Gott uns zuhört, hat er schlicht versprochen, wir haben seine → Zusage, auf die hin wir überhaupt erst zu beten anfangen können. Unser Gebet beginnt deshalb nicht als Rufen ins Leere oder als Fragen ins Ungefähre, sondern kann sich schon auf Gott berufen, der gerade mit uns sprechen will. Auch dass Gebet erhört wird, ruht auf einem solchen Versprechen Gottes und ist keine Wunscherfüllung. Es bedeutet, ihn in → Freiheit gebeten zu haben und es seiner Freiheit – und seinen Ideen, seiner Güte, seiner Voraussicht – zu überlassen, auf unser Gebet zu reagieren, besser noch, es in seinen guten Willen für uns aufzunehmen, der geschieht, auch ohne dass wir Gott darum bitten. Es geht darum, in der Bitte »Dein Wille geschehe« unseren und Gottes Willen zusammenzubringen, und wo dies gelingt, ist der Heilige → Geist am Werk. Doch müssen Gottes Wille und mein Wille dabei noch voneinander unterscheidbar bleiben, denn sonst wird die unterschiedslose Einigung praktisch entweder zur fatalistischen Resignation, die alles, was geschieht, schon für Gottes Willen hält – hier wird das Beten letztlich überflüssig. Oder die Einigung mit Gottes Willen geschieht umgekehrt im fanatischen Irrtum, der eigene Wille wäre schon längst mit Gottes Willen identisch. Auch hier müsste das Gespräch letztlich abbrechen, weil darüber hinaus nichts mehr zu sagen wäre.
5.) Danken und Loben
Ganz ähnlich ist schließlich auch der Dank, den wir Gott »schulden«, keine »Quittung« für empfangene Güter, die den Endpunkt einer zweckgebundenen Kommunikation darstellen würde; auch keine erzwungene Katzbuckelei, sondern Ausdruck der Freude, der Aufmerksamkeit für das, was wir täglich, stündlich empfangen. »Zu Dank verpflichtet zu sein« bedeutet aber genau wie beim Bitten, in einer fortwährenden Beziehung zu Gott zu stehen, nicht bloß für dieses oder jenes Empfangene zu danken. Letztlich bedeutet zu danken immer, darin den »Geber« zu meinen und...
Inhaltsverzeichnis
- Umschlag
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- Z
- Abkürzungsverzeichnis
- Autorenverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Erfahre, wie du Bücher herunterladen kannst, um sie offline zu lesen
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Lehrbuch-Abo, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 990 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Erfahre mehr über unsere Mission
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Erfahre mehr über die Funktion „Vorlesen“
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren
Ja, du hast Zugang zu Biblisches Wörterbuch von Ulrich Laepple, Hartmut Bärend, Wolfgang Neuser, Ulrich Laepple,Hartmut Bärend,Wolfgang Neuser im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Biblische Studien. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.