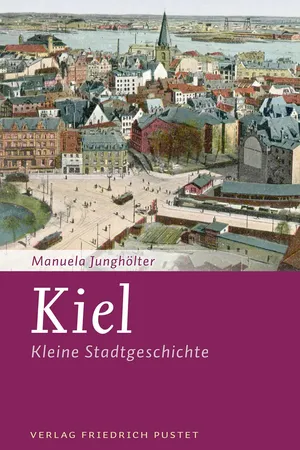
- 176 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Mit Kiel, der Stadt an der Förde, verbinden sich Begriffe wie Meer, Schiffe und Segeln, aber auch frische Luft, Wind und Kieler Sprotte. Die Stadt lebt am, vom und mit dem Meer und hat sich als Standort für Schiffbau, für Wissenschaft und Forschung, als Kreuzfahrt- und Fährhafen, als Mekka für Wassersportler auch international einen Namen gemacht. Während ihrer mehr als 770-jährigen wechselvollen Geschichte hat sich die Stadt immer wieder neu erfinden müssen.
Dieses Buch vermittelt einen fundierten, kurzweiligen Überblick zur Geschichte der Ostseestadt, angereichert mit Anekdoten, Biografien und Hintergrundinformationen, die es in dieser Zusammenstellung noch nicht gibt. Manuela Junghölter lädt den Leser ein, selbst auf Spurensuche zu gehen und sich in ihrer Heimatstadt Kiel den Wind um die Nase wehen zu lassen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kiel von Manuela Junghölter im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus History & Historical Geography. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
HistoryThema
Historical GeographyGlanz und Gloria in der Kaiserzeit 1871—1918
Die Marine nimmt Quartier
Das Jahr 1865 sollte für die weitere Entwicklung Kiels schicksalhaft sein. Auf die Verlegung der preußischen Marinestation von Danzig an die Förde und die Festlegung Kiels als Marinehafen des Norddeutschen Bundes folgte nach Gründung des Deutschen Kaiserreiches 1871 der Ausbau Kiels zum Reichskriegshafen. Die Stadt wurde zum wichtigsten Marinehafen an der Ostsee, so wie Wilhelmshaven an der Nordsee. Die Voraussetzungen für einen rasanten Aufschwung der Stadt waren geschaffen. Es verband sich damit auch praktisch die zweite Gründung der Stadt, die ihren Status als ländliches Mittelzentrum endgültig hinter sich ließ. Das deutsche Kaiserreich strebte einen Platz im Reigen der Großmächte an und suchte »die Zukunft Deutschlands auf dem Meer«. Dafür war der Aufbau einer Flotte notwendig, und Kiel bot mit einem geschützten Tiefwasserhafen und vielversprechenden Ausbaumöglichkeiten beste Voraussetzungen.
Trotz der Aussicht auf gute wirtschaftliche Entwicklungen war das Verhältnis zwischen Marine und Stadtverwaltung aber durchaus ambivalent. Während der Marineausbau immer mehr Platz in Anspruch nahm und sich in das Stadtgebiet ausbreitete, wurden die Möglichkeiten für den Aufbau einer zivilen Wirtschaft eingeschränkt. Eine gemeinsame Strategie zum Wohle der Stadt, bei der beide Interessen berücksichtigt wurden, gab es nicht. Höhepunkt war der Wiker Hafenprozess 1904, den die Stadt Kiel gegen die Marine anstrengte und verlor. Die bereits 1891 von der Marine erteilte zehn Jahre gültige Zustimmung für den Bau eines zivilen Hafens in der Wiker Bucht in unmittelbarer Nähe zum Kaiser-Wilhelm-Kanal (heute Nord-Ostsee-Kanal) setzte die Stadt nicht fristgerecht um. So realisierte die Marine eigene Pläne an gleicher Stelle und setzte mit dem Tirpitzhafen, benannt nach dem Großadmiral und Begründer der deutschen Hochseeflotte Alfred von Tirpitz (1849–1930), der Marineakademie – dem heutigen Landtag –, den Garnisonskirchen sowie mit der Marinekommandantur auch architektonisch Akzente. Trotz allem profitierte die Stadt von ihrem neuen Status in jeder Hinsicht und wurde zum Ziel vieler Menschen, die hier ein Auskommen suchten.
Anfänge des Schiffbaus
Der Schiffbau spielte bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in der Entwicklung der Stadt zunächst nur eine untergeordnete Rolle. Eine Reihe kleinerer Schiffbauplätze an der Kieler Förde produzierte auf ihren Hellingen Holzfrachtschiffe für den küstennahen Transport. Die Familienunternehmen bauten auf Bestellung und erhielten ihr Werkmaterial Holz aus dem Umland. Die Entwicklung nahm zwar mit dem Eisenschiffbau und dem Übergang vom Wind- zum Dampfantrieb Fahrt auf, die kleineren Schiffbaubetriebe hatten aber weder eine ausreichende Finanzdecke noch moderne Fertigungsmethoden, um mit der fortschreitenden Industrialisierung Schritt halten zu können. In der Folgezeit wurden der Holzschiffbau und damit viele Familienbetriebe zugunsten der industriellen Fertigung zurückgedrängt.
Schweffel und Howaldt – Ein geniales Duo
Johann Schweffel (1796–1865), der geborene Unternehmer, übernahm 1819 im Alter von gerade mal 23 Jahren den elterlichen Gewürz-, Steinkohle- und Eisenhandel und erweiterte diesen 1825 um eine Eisengießerei auf der Rosenwiese (heute Kaistraße). Drei Frachtsegler und das Liniendampfschiff »Löven«, das regelmäßig nach Kopenhagen fuhr, komplettierten seinen Betrieb. Sein kaufmännischer Weitblick verband sich mit dem Ideenreichtum und dem Sinn fürs Praktische von August Ferdinand Howaldt (1809–83), der als Maschinist auf der »Löven« unterwegs war und den man als typischen ›Selfmademan‹ der Frühindustrialisierung bezeichnen kann. Zusammen gründeten die beiden 1838 die »Schweffel & Howaldt Maschinenbauanstalt und Eisengießerei«, die zunächst mit 120 Mitarbeitern Dinge des täglichen Bedarfs, landwirtschaftliche Geräte und Dampfmaschinen produzierten. Die Waggons der neuen Eisenbahnstrecke, die seit 1844 zwischen Altona und Kiel verkehrte, wurden dort ebenso hergestellt wie die 320 Gaskandelaber, die seit 1854 in Kiel für gute Ausleuchtung sorgten. Ein besonderes Ereignis in der Firmengeschichte war sicherlich der Auftrag für den Bau des »Brandtauchers«. Die Familie Schweffel zog sich später aus dem Geschäft zurück, der prachtvolle Wohnsitz in der Klinke 2, der wegen der neuen Straßenführung 1907 abgerissen wurde, ist heute noch als Modell im Stadtmuseum zu bewundern. Dafür profitierten August Howaldt und seine Nachkommen vom boomenden Schiffbau in der Kaiserzeit und gründeten verschiedene Werftenstandorte auf dem Ostufer der Kieler Förde.

Abb. 11: Porträt des Werftgründers August Ferdinand Howaldt
BIOGRAFIE
Schiffsmakler und Reeder August Sartori
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lockten exotische Ziele und gute Geschäfte die Kieler Reedereien, sich im Fernhandel nach Ostasien oder über den Atlantik nach Amerika zu engagieren. Der Schiffsmakler und Reeder August Sartori (1837–1903) sah in seiner Stadt das Potenzial zum Drehkreuz des Skandinavien- und Ostasienhandels. Nach einer kaufmännischen Lehre stand der Gründung seiner eigenen Firma 1858 aber sein jugendliches Alter im Weg, denn Sartori war nach damaligem Verständnis noch nicht volljährig. So musste er sich einen älteren Partner suchen, den er im Kaufmann Johann Albert Berger fand. Berger verließ die Firma vier Jahre später vertragsgemäß, sein Name ist aber bis heute Teil des Firmennamens. Sartori begann mit einem Segelschiff, hatte 1884 bereits 21 Dampfschiffe unter seiner Flagge und stellte 1903 den 79. Neubau in Dienst. Mit seinen Schiffen bediente er die Fährverbindungen in den Ostseeraum. 1880 kam eine Tages-Dampfschifffahrtslinie ins dänische Korsør hinzu. August Sartori war auch politisch aktiv und Mitglied in vielen Gremien und Vereinen der Stadt, so auch als Gründungsmitglied der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Die Firma Sartori & Berger hat ihren Firmensitz heute im Alten Speicher am Wall und kümmert sich unter anderem um die Belange der Kreuzfahrtschiffe, die den Kieler Hafen jedes Jahr anlaufen.
Die Werften machen Dampf
Neben Howaldt engagierte sich auch Friedrich Krupp aus Essen in Kiel und gründete 1895 die aus der Norddeutschen Werft hervorgegangene Germania-Werft an der Hörn, dem südlichsten Zipfel der Kieler Förde. Dabei war der Schiffbau nur ein Teil der breiten Produktpalette des Krupp-Konzerns. Heute wird die noch erhaltene alte Produktionshalle als Veranstaltungsort und Restaurant genutzt, das Kruppsche Gästehaus am Fördeufer ist Teil des Instituts für Weltwirtschaft. 1871, mit der Ausrufung zum Reichskriegshafen, wurde auch die Kaiserliche Werft gegründet, ein Staatsbetrieb für den Bau der Kriegsflotte, die militärisch organisiert und mit 14 000 Mitarbeitern der größte Arbeitgeber in der Stadt war. Bei der verordneten flächenmäßigen Ausdehnung wurde jedoch keine Rücksicht auf Bestehendes genommen. So wurden 1903 das Fischerdorf Ellerbek mit seinen historischen Gebäuden abgerissen und die 150 Familien in eine Arbeitersiedlung eines Nachbarviertels umgesiedelt. Die drei großen Werften, die zwischen 1914 und 1918 insgesamt 33 000 Arbeiter beschäftigten, belegten den größten Teil des Ostufers an der Förde. Die Marineschiffe sollten aber auch mit dem neuesten technischen Gerät ausgestattet werden. Dazu entwickelte sich eine weitreichende Zulieferindustrie, die ebenfalls viele weitere Arbeitsplätze versprach. Kiel war damit zu Beginn des 20. Jahrhunderts der bedeutendste Werft- und Schiffbaustandort Deutschlands.
HINTERGRUND
Kieler Erfindungen auf allen Meeren
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben zwei Kieler Erfindungen die Sicherheit in der Schifffahrt maßgeblich verbessert: Kreiselkompass und Echolot. Hermann Anschütz-Kämpfe (1872–1931) fand zu seiner Bestimmung als Erfinder über einen Umweg via Medizin und Kunstgeschichte. Das beträchtliche Vermögen, das sein Adoptivvater ihm zu wissenschaftlichem Zwecke hinterlassen hatte, und Anschütz’ Interesse an ungewöhnlichen Experimenten trieben ihn an. Er löste das Problem des Magnetkompasses, der in Polnähe und in Eisenkörpern nicht funktionierte, durch die Erfindung des Kreiselkompasses, dessen Herstellung und Vermarktung er mit seiner eigenen Firma 1905 übernahm. Als es 1915 zu Patentstreitigkeiten mit ähnlichen Erfindungen in Amerika kam, holte sich Anschütz niemand Geringeren als Albert Einstein, der gelegentlich auch auf der Förde beim Segeln zu beobachten war, als Gutachter an seine Seite. Der Streit ging zugunsten von Hermann Anschütz aus.
Für den Physiker Alexander Behm (1880–1952) war der Untergang der »Titanic« 1912 das impulsgebende Ereignis, um eine Möglichkeit zu finden, künftig Katastrophen dieser Art zu verhindern. Mit der Erfindung des Echolots entwickelte er ein Warnsystem, bei dem mittels der Ausbreitung des Schalls unter Wasser verborgene Hindernisse sichtbar gemacht werden können. Seine Experimente begannen mit einem Goldfischglas und einem Gewehrschuss als Schallquelle. 1915 setzte Behm seine Versuche in der Heikendorfer Bucht auf der Kieler Förde mit dem Kanonenboot »Otter« fort, das er für diesen Zweck angekauft hatte, und machte sich 1920 mit der Gründung der Behm-Echolot-Gesellschaft in Kiel selbstständig. Der geniale Erfinder meldete insgesamt 110 Patente an, unter anderen für das Behm-Luftlot, die unhörbare Hundepfeife und die Behm-Fliege, ein Angelköder zum Fliegenfischen, den er auf der Fischereiausstellung 1927 in Kiel präsentierte und mit dem er seiner Passion, dem Sportangeln, nachkommen konnte. Anschütz und Behm arbeiteten zusammen und hielten gemeinsam viele Patente.
Prestigeprojekt Kaiser-Wilhelm-Kanal
Der Anstoß für ein neues Kanalprojekt durch Schleswig-Holstein ging vom Hamburger Reeder Hermann Dahlström (1840–1922), genannt »Kanalström«, aus, der einen ersten Streckenverlauf erarbeiten ließ. Zwar war der bereits vorhandene Eiderkanal noch in Benutzung, seine Kapazitäten reichten jedoch für die immer größer werdenden Schiffe nicht mehr aus. Der Ausbau der Infrastruktur auf dem Wasser war auch für die kaiserliche Flotte unerlässlich, und so ließ der Kanzler des neuen Deutschen Reiches, Otto von Bismarck (1815–98), ebenfalls schon 1864 eine Machbarkeitsstudie über eine seegängige Verbindung zwischen Ost- und Nordsee bzw. bis zur Elbe erstellen. Handels- und Kriegsmarine sollten den Kanal wetterunabhängig und mit entsprechender Zeit- und Streckenersparnis nutzen können. Erst 1878 lag ein tragfähiges Konzept vor, von dem auch Kaiser Wilhelm I. überzeugt war. Eine kaiserliche Kanalbau-Kommission wurde gegründet und überwachte die Bautätigkeit, die mit der Grundsteinlegung am 3. Juni 1887 in Kiel-Holtenau begann.
Mit 8900 Arbeitern, zum Teil aus dem Ausland rekrutiert, ausgerüstet mit der neuesten Technik des Eimerkettenbaggers und der Lorenbahn für die 80 Millionen Kubikmeter Aushub, konnte der Kanal nach acht Jahren Bauzeit und Kosten von 156 Millionen Goldmark zur Kieler Woche am 21. Juni 1895 eingeweiht werden. Die knapp 100 km lange Wasserstraße erhielt an ihren Enden in Brunsbüttel und Holtenau je ein Schleusenpaar, um die Wasserschwankungen auszugleichen.
Die erste Erweiterung war bereits 1907–14 fällig, bei der auch die bis heute größten Schleusen der Welt (330 m Länge) in Betrieb genommen wurden. Der Kanalbau hatte nicht nur einen wirtschaftlichen Nutzen, sondern war auch Ausdruck des Leistungsvermögens des Kaiserreiches und Wertschätzung der neuen preußischen Provinz Schleswig-Holstein. Zur Finanzierung des Bauvorhabens wurde eine Sektsteuer eingeführt, die bis heute erhoben wird. Der Nord-Ostsee-Kanal, wie er heute heißt, oder international Kiel-Canal, ist mit mehr als 30 000 Schiffbewegungen im Jahr nach wie vor die am meisten befahrene künstliche Wasserstraße der Welt. Seine Anlagen sind aber in die Jahre gekommen und bedürfen dringend einer Erneuerung, um weiter zukunftsfähig zu bleiben. Bis 2018 wird der Bund als Betreiber des Kanals 1,5 Milliarden Euro für eine grundlegende Sanierung, den Ausbau der Oststrecke und den Neubau der fünften Schleuse in Brunsbüttel bereitstellen.
HINTERGRUND
»Guter Mond …«
Die offiziellen Einweihungsfeierlichkeiten für den neuen Kanal am 21. Juni 1895 sollten in Kiel-Holtenau stattfinden, bei denen sich 232 Schiffe auf der Förde tummelten. Dafür hatte man einen Festplatz am Schleusenvorhafen mit Tribünen für 7400 Gäste vorgesehen. Die kaiserliche Motoryacht »Hohenzollern« an der Spitze eines Schiffskonvois erreichte nach Kanaldurchfahrt von Brunsbüttel kommend und mit Kaiser Wilhelm II. an Bord am Morgen Holtenau. Mit dem Durchbrechen einer über den Kanal gespannten Kordel war der Kanal offiziell für die Schifffahrt freigegeben. Es folgten die Schlusssteinlegung für den Kanal und die Einweihung des Denkmals für den Namensgeber und Initiator Kaiser Wilhelm I. Das für 1000 Gäste vorbereitete Festbankett fand in einem nicht fahrfähigen Nachbau der 1849 gebauten Kreuzerkorvette »Niobe« statt. Die mit kleinen Tendern zum Festschiff transportierten 17 ausländischen Delegationen – sogar der japanische Kaiser reiste an – wurden an Bord mit ihrer jeweiligen Nationalhymne begrüßt. Für die türkische Abordnung fehlten dem Kapellmeister zwar die Noten, aber er griff, inspiriert vom Halbmond in der Landesflagge, auf ...
Inhaltsverzeichnis
- Buchinfo
- Haupttitel
- Impressum
- Vorwort
- Aller Anfang ist schwer
- Kiel als Mitglied der Hanse
- Die Reformationszeit in Kiel
- Die Gründung der Kieler Universität 1665
- Politische Verhältnisse im 18. Jahrhundert
- Kiel im dänischen Gesamtstaat 1773—1864
- Nationalbewusstsein und der Konflikt mit Dänemark
- Glanz und Gloria in der Kaiserzeit 1871—1918
- 1918 — Kiel und die Revolution
- Zwischen Krise und Kommerz: Kiel in der Weimarer Republik 1918—1933
- Kiel unterm Hakenkreuz 1933—1945
- Wiederaufbau und Wirtschaftswunder 1945—1970
- Von den 1970er-Jahren bis heute
- Zeittafel
- Kiel in Kürze
- Internetadressen
- Städtepartnerschaften
- Bildnachweis
- Oberbürgermeister seit 1867
- Stadtpräsidenten seit 1950
- Literatur
- Stadtplan
- Eigenanzeigen