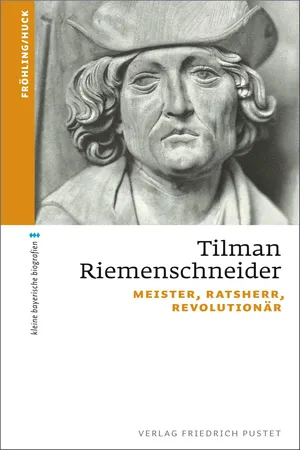
- 144 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Hätte sich Tilman Riemenschneider als Würzburger Ratsherr im Bauernkrieg 1525 nicht auf die Seite der Aufständischen gestellt, sein Leben als gefragter und wohlhabender Künstler wäre auch weiterhin ruhmreich verlaufen. Doch mit der Niederlage des Bauernheers war er der Gnade des Fürstbischofs ausgeliefert. Riemenschneider kam trotz Einkerkerung, vermutlicher Folter und dem Verlust von Teilen seines Vermögens zwar mit dem Leben davon, aber Aufträge des 'Establishments' sollte er nicht mehr erhalten. So geriet er in Vergessenheit, und erst sein 1822 zufällig aufgefundener Grabstein führte zu einer Wiederentdeckung des "Meisters aller Meister", wie ihn der Schriftsteller Max von der Grün bezeichnet. Die Biografie schildert sein Leben und Werk sowie die Nachwirkungen seiner Kunst.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Tilman Riemenschneider von Stefan Fröhling,Markus Huck im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Geschichte & Frühneuzeitliche Geschichte. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
Geschichte1 Die frühen Jahre
Name und Geburtsjahr
Die Quellenlage ist nicht gerade ergiebig. Will man sich mit dem Leben des spätgotischen Bildschnitzers und Bildhauers Tilman Riemenschneider näher befassen, ist man demnach immer wieder auf Vermutungen angewiesen. Doch so wenig sich seine Vita genauer dokumentieren lässt, so gut lässt sich sein künstlerisches Wirken erfassen, und zwar mittels der reichlich vorhandenen Kunstwerke aus seiner Hand und seiner Werkstatt.
Während der Blütezeit seines Schaffens, also zwischen 1483 und 1525, war Riemenschneider in und um Würzburg auf seinem meisterlichen Niveau konkurrenzlos und arbeitete für zahlreiche Auftraggeber zwischen der Rhön im Norden, Bamberg im Osten, dem Taubergrund im Süden und Aschaffenburg im Westen. Seine künstlerische Genialität wie auch die seiner zeitgenössischen Kollegen in der Freien Reichsstadt Nürnberg prägten die Bildhauer- und Schnitzkunst der fränkischen und deutschen Spätgotik. Veit Stoß (um 1447–1533), Peter Vischer d. Ä. (um 1455–1529) oder Adam Kraft (um 1460–1509) sind hier zu nennen, die letztlich der moderneren Kunst der Renaissance nicht abgeneigt waren. Dass zu Riemenschneiders Zeitgenossen zudem berühmte Maler wie Albrecht Dürer (1471–1528), Lucas Cranach d. Ä. (1472–1553) oder Mathias Grünewald (um 1475/80–1531/32) gehören, sei zumindest am Rande erwähnt.
Der Vorname »Til(l)« oder die von ihm abgeleitete Koseform »Til(l)man(n)« geht auf den Personennamen »Dietrich« zurück und war in der damaligen Zeit recht beliebt. Auch war es Usus, dass die Vornamen über Generationen in den Familien beibehalten wurden. Daher verwundert es nicht, dass Tilman Riemenschneider denselben Vor- bzw. Taufnamen trug wie sein Vater. Mit der Reformation nahm die Verwendung von Heiligennamen als Vornamen ab. Protestantische Familien griffen stattdessen lieber auf alttestamentliche Namen zurück.
Der Gebrauch von Nachnamen setzte ab dem 13. Jahrhundert ein, was vor allem angesichts der anwachsenden Bevölkerung in den Städten notwendig wurde – und das allein schon aus rechtlichen Gründen, so etwa bei Beurkundungen oder bei der Erstellung von Steuerlisten. Die Familiennamen beruhten dabei oft auf handwerklichen Berufsbezeichnungen oder bezogen sich auf die Region, aus der jemand kam (»Schwab«), resp. auf den Ort, wo jemand wohnte (»Angermann«). Der Nachname »Riemenschneider« (Gürtelmacher) war wie der Vorname »Til(l)« in jenen Tagen keineswegs selten.
Das Geburtsjahr des Sohnes Tilman ist urkundlich nicht belegt und wird nur anhand eigener Angaben aus seinem späteren Leben für die Zeit um 1460 angenommen. Die Eltern Tilman und Margarete stammten aus dem Eichsfeld und lebten damals in Heiligenstadt. Das Eichsfeld liegt im Nordwesten Thüringens und reicht bis ins Hessische und Niedersächsische hinein, mit der seit dem Jahr 973 schriftlich bezeugten Gemeinde Heiligenstadt im Zentrum.
Von der Mutter Tilman Riemenschneiders weiß man kaum mehr als den Vornamen. Von seinem Vater ist bekannt, dass er gelernter Kupferschmied war und wohl eine Kupfermühle besaß, in der sein Sohn bereits als Kind erste handwerkliche Eindrücke gesammelt haben dürfte.
Ortswechsel und Hilfe aus Würzburg
Heiligenstadt gehörte in jener Zeit zum Erzbistum Mainz. Die dortigen Bischöfe waren zugleich auch mächtige Kurfürsten, die das Recht der Königswahl innehatten. So blieb es nicht aus, dass die Stadt in den kriegerischen Konflikt um die Neubesetzung des Bischofsstuhls hineingezogen wurde, der als »Mainzer Stiftsfehde« (1461–63) in die Geschichte eingegangen ist: Adolf II. von Nassau (reg. 1461–75) konnte sich mit Hilfe des Papstes gegen den vom Domkapitel gewählten Diether von Isenburg (reg. 1459–61) durchsetzen, der jedoch nach dem Tod seines Widersachers nochmals zu bischöflichen Ehren, also zu einer zweiten Amtszeit zwischen 1475 und 1482, kam.
Der Kupferschmied Tilman Riemenschneider hatte als ein Vertreter seiner Zunft vermutlich zur ›falschen‹ Seite gehalten, sodass es für ihn und seine Familie nach der Beendigung der Stiftsfehde ratsam erschien, Heiligenstadt um 1465/66 zu verlassen und nach Osterode am Harz zu ziehen, das politisch dem Geschlecht der Welfen unterstand. Dortselbst hat er gewiss sein erlerntes Handwerk erneut betrieben und ist offenbar zu einigem Ansehen gelangt; denn nach geraumer Zeit wurde ihm die seit dem 13. Jahrhundert in der Stadt bestehende Münzstätte übertragen, die er fortan als Münzmeister zu leiten hatte.
Münzherstellung und Münzmeister
Im Spätmittelalter waren in Deutschland drei Zahlungsmittel bekannt: Die Goldmünzen wurden für den internationalen und nationalen Großhandel sowie für die Geldaufbewahrung verwendet; im Kleinhandel und bei der Lohnauszahlung kam das Weiße Geld zum Einsatz, das so hieß, weil es mindestens zur Hälfte aus Silber bestand; die täglichen Einkäufe hingegen zahlte man gewöhnlich mit Kleingeld, das wegen seines hohen Kupferanteils Schwarzes Geld genannt wurde. In Süddeutschland waren jedoch auch silberne Münzen (»Heller«) als Kleingeld im Umlauf.
Die Prägung erfolgte in einer vom Münzmeister geleiteten und beaufsichtigten Münzstätte. Im ausgehenden Mittelalter stand dieser als freier Unternehmer mit dem Inhaber des Münzregals – zu dieser Zeit dem jeweiligen Landesherrn oder einer Freien Reichsstadt – in einem Vertragsverhältnis. Als Münzregal (»Regal« = wörtlich »Königsrecht«) wurde generell das Hoheitsrecht eines Herrschers bezeichnet, das die Währungsbestimmung, also das Herstellungs- und Verkaufsrecht der Münzen, umfasste. Zwar verfügten im Mittelalter nur die Kaiser oder Könige über das Prägerecht, aber dieses Recht konnte auf treue Gefolgsleute, etwa untergeordnete Adelsfamilien, übertragen werden. Allerdings dürften manche von ihnen eigenmächtig Münzen geprägt haben.
Zum herrschaftlichen Privileg gehörte auch das Recht auf den Schlagsatz oder Schlagschatz, worunter die positive Differenz zwischen dem Metallwert sowie den Herstellungskosten einerseits und dem Nennwert der Münze andererseits – kurz: der zu erzielende Gewinn – zu verstehen ist. Das Gewicht und der Feingehalt der Münzen wurden zwischen dem Münzherrn und dem Münzmeister in einem Kontrakt festgelegt, denn Gold und Silber wurden immer mit einem Zusatz unedler Metalle verarbeitet. Der Feingehalt bezeichnet dabei den jeweiligen Edelmetallanteil. Eine Verringerung desselben kam einer Abgabenerhöhung gleich. Der vom Münzherrn festgesetzte Münzfuß bestimmte generell, wie viele Münzen aus einer entsprechenden Gewichtseinheit des Edelmetalls angefertigt werden durften oder sollten. Zudem war die Beteiligung des Münzmeisters am Schlagsatz vertraglich geregelt.
Falschmünzern drohten im Mittelalter drakonische Bestrafungen. Die »Peinliche Halsgerichtsordnung« Kaiser Karls V. von 1532 zählt in Artikel 111 drei Münzvergehen auf: Missbrauch des Münzstempels, unerlaubtes Hinzufügen unedlen Metalls und Verringerung des Münzgewichts. Einem Münzmeister, der sich der Falschmünzerei schuldig gemacht hatte, konnte zur Strafe die Hand abgehackt werden. Auch das Sieden und der Feuertod waren als Strafen gebräuchlich. Die Münzverfälschung galt nämlich als ein Angriff auf die Münzhoheit des Herrschers und somit als Majestätsbeleidigung. Freilich führten die Münzmeister in der Regel nur die Vorgaben ihres Herrn aus, mussten jedoch für dessen Verfehlungen den Kopf hinhalten.
Der Vater scheint in Osterode ebenfalls nicht immer klug gehandelt zu haben, denn er hatte sowohl mit persönlichen wirtschaftlichen als auch mit lokalen politischen Widrigkeiten zu kämpfen, sodass er in den Jahren 1471 und 1474 seinen in Würzburg lebenden Bruder um juristischen Rat und tätigen Beistand bitten musste: Nikolaus Riemenschneider verfügte nicht nur als Notar, sondern vor allem in seinem Amt als Fiskal des Würzburger Fürstbischofs über beträchtlichen Einfluss und vermochte somit seinem Bruder zu helfen. Der Fiskal war als leitender Beamter für die Verwaltung der Staatskasse und die Besteuerung zuständig. Nikolaus Riemenschneider war dieses Amt im Jahr 1458 durch Fürstbischof Johann III. von Grumbach (reg. 1455–66) übertragen worden, und er hatte in dessen Nachfolger, Fürstbischof Rudolf II. von Scherenberg (reg. 1466–95), einen sehr tatkräftigen Dienstherrn über sich, der viel für die staatspolitische Festigung seines Bistums unternahm.
Natürlich war ein hochstehender Kleriker wie Nikolaus Riemenschneider aufgrund diverser Pfründe, die an sein kirchliches Amt gebunden waren, gut versorgt. Es gelang ihm darüber hinaus, seinem Neffen Tilman mit einem Altarbenefizium am Würzburger Stift Haug eine solche Pfründe zu verschaffen, die wahrscheinlich der Familie in Osterode zeitweilig das Auskommen sicherte. Vielleicht hegte der Oheim die Hoffnung, dass sich der junge Tilman gleichfalls für eine klerikale Laufbahn entscheiden würde. Die Verleihung eines Benefiziums war damals allerdings nicht an das Sakrament der Priesterweihe gebunden, sondern setzte höchstens die sogenannten »Niederen Weihen« voraus, die lediglich als vorbereitende Schritte zur Priesterweihe anzusehen waren und keinen sakramental verpflichtenden Charakter hatten.
Osterode am Harz
Im Jahr 889 schenkte der ostfränkische König Arnulf von Kärnten (um 850–99) einem Grafen Adalger im Gau »Hlisgo« (»Lisgau«) an der Nordwestseite des Harzes vier Höfe mit Ackerland. Das damalige Gebiet deckt sich ungefähr mit dem heutigen Landkreis Osterode am Harz. Die Bezeichnung »Osterode« weist auf eine »östlich gelegene Rodungsstelle« hin. Später kam das Lisgau zuerst unter die Herrschaft der Grafen von Katlenburg und ab 1106 der Grafen von Northeim, bis es schließlich an Herzog Heinrich den Löwen (um 1130/35–95) fiel. Die am Fluss Söse gelegene wohlhabende Siedlung Osterroth, die ihr erstes Aufblühen zwei sich kreuzenden Handels- und Verkehrswegen verdankte, wurde jedoch 1152 in einer Fehde zwischen Heinrich dem Löwen und Markgraf Albrecht dem Bären von Brandenburg (um 1100–70) stark zerstört.
Die Siedlung ist danach freilich wiedererstanden und erhielt im 13. Jahrhundert das Stadtrecht. Im Jahr 1234 wurde die Ummauerung erweitert, und ab dem Jahr 1238 verfügte Osterode über ein die Stadt regierendes Ratskollegium. Bereits 1233 wird bei der noch älteren St.-Jakobi-Kirche am Neuen Markt ein Konvent der Zisterzienserinnen erwähnt, aus dessen Klosterschule die städtische Lateinschule hervorging. 1263 wird die Stadt erstmals als Münzstätte genannt. Deren Einrichtung bot sich an, weil in der Umgebung erzhaltiges Gestein abgebaut werden konnte. Die Eisenhütten gelangten 1460 in den Besitz der Stadt.
Von 1286 bis 1596 residierte die Grubenhager Linie der Welfen in Osterode. Das Adelsgeschlecht ließ sich das Kloster der Zisterzienserinnen zu einem Schloss umbauen, nachdem die Nonnen es 1558 im Zuge der Reformation hatten aufgeben müssen. Die St.-Jakobi-Kirche diente fortan als Schlosskirche. Im 17. und 18. Jahrhundert erlebten das Tuch- und Schuhmachergewerbe sowie die Wollproduktion eine Blütezeit. Auch das Bier der Region war so berühmt, dass sogar Königin Christine von Schweden (reg. 1632–54) einen Braumeister aus Osterode engagierte. Obwohl die Stadt vom 16. bis ins 19. Jahrhundert mehrfach von großen Bränden heimgesucht wurde, sind noch zahlreiche historische Fachwerkbauten zu bewundern. Die mittelalterliche Burg ist als Ruine erhalten geblieben.
Lehr- und Gesellenzeit
Der Sohn des Kupferschmieds war von seiner künstlerischen Ausrichtung nicht mehr abzubringen. Er absolvierte wohl im heimatlichen Osterode eine handwerkliche Lehre, und zwar zugleich als Bildschnitzer und als Steinbildhauer. Die Lehrzeit dauerte in der Regel vier bis sechs Jahre und vermittelte dem Lernenden alle grundlegenden Kenntnisse für die Ausübung des entsprechenden Handwerks. Auch die Zusammenarbeit in einer größeren, hierarchisch strukturierten Werkstatt musste erlernt werden.
Einer solchen Lehrzeit als »Lehrknecht« folgte sodann üblicherweise eine jahrelange Wanderschaft als Geselle, um in den Zentren der jeweiligen Handwerkskunst bei angesehenen Meistern die neuesten Techniken und Stile zu erlernen sowie die künstlerischen Fähigkeiten zu vervollkommnen. Der junge Tilman kam jedenfalls am Beginn seiner Wanderjahre nach Würzburg, und zwar vermutlich bereits 1478, im Todesjahr seines Onkels Nikolaus. Bekannt ist, dass Tilman etwa zur selben Zeit sein Benefizium zurückgab, was seine endgültige berufliche Entscheidung dokumentieren dürfte. Allerdings ist nicht ganz klar, ob der Verzicht auf die Pfründe ursächlich mit dem Tod seines Förderers zusammenhing. Vorweggenommen sei, dass Tilman Riemenschneider in den Jahren 1496 bis 1499 – und längst in Würzburg als Bildhauer etabliert – da...
Inhaltsverzeichnis
- Buchinfo
- Zur Buchreihe
- Haupttitel
- Impressum
- Einleitung
- 1 Die frühen Jahre
- 2 Die Etablierung in Würzburg
- 3 Kunsthandwerk im Spätmittelalter
- 4 Ehen und Kinder, Wohlstand und Ämter
- 5 Der Bauernkrieg von 1525
- 6 Der Zenit wird überschritten
- Zeittafel
- Werke (Auswahl)
- Museen
- Bildnachweis
- Literatur (Auswahl)
- Eigenanzeige