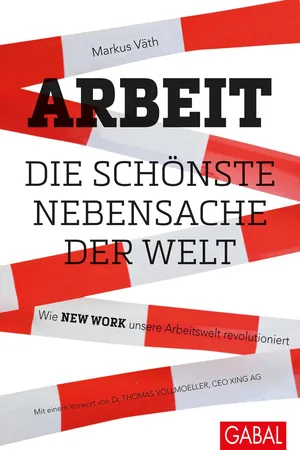![]() Teil 1
Teil 1
Warum wir New Work brauchen![]()
Depression, Angst, Burn-out – Psycholeiden auf dem Vormarsch
Für die allermeisten Menschen ist Arbeit etwas Selbstverständliches. Sie stehen auf, gehen zur Arbeit, kommen irgendwann wieder nach Hause, erzählen vielleicht ihrem Partner von ihrem Tag, bringen die Kinder ins Bett und suchen sich eine sinnvolle Abendbeschäftigung. Sogar für Menschen ohne Arbeit ist Arbeit etwas Selbstverständliches – als etwas, was zum Leben dazugehört, was sie jedoch nicht haben. Genau wie ein Leben ohne Atmung oder ohne Steuern können sich viele Menschen ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen. Von daher hat das Vorhandensein von Arbeit, aber auch ihre Gestaltung oder ihr Wesen eine enorme Wirkung auf unser Leben, unser Selbstbild, unseren Wohlstand und auch auf unsere Gesundheit. Im Allgemeinen wird unterstellt: Hat man Arbeit, fühlt man sich gebraucht, verdient genug Geld zum Leben, ist sozial integriert und hebt damit auf breiter Front sein Wohlbefinden.
Aber kann Arbeit auch krank machen? Immerhin ist Gesundheit ein sogenanntes »multifaktorielles« Geschehen. Ob jemand gesund ist oder krank, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von Lebensgewohnheiten, Alter, Ernährung und genetischer Veranlagung. Außerdem zeigen uns Forschungen der Positiven Psychologie und die moderne Motivationsforschung, dass Arbeit einen gesundheitsförderlichen, manchmal geradezu lebensverlängernden Effekt haben kann. Der Psychologe Mihály Csíkszentmihályi hat das in seinem Konzept des Flows festgehalten. »Im Flow vergisst der Ausführende teilweise die Zeit und erlebt quasi eine ›zeitlose‹, erfüllende Qualität in seiner Tätigkeit. Das Flow-Konzept wurde ursprünglich für Extrem- und Risikosportarten entwickelt und erst später auf die Alltagsarbeit übertragen. ›Im Flow zu sein‹ bedeutet, spielerisch in einer Tätigkeit aufzugehen, in der idealen Balance zwischen Über- und Unterforderung. […] Der Flow ist der Zenit, der Olymp der Arbeitseffizienz und in diesem Sinne nicht nur ein theoretisches Liebhaberstück für Weltverbesserer, sondern ebenso eine handfeste Größe für Personaler und Führungskräfte.«
Das Flow-Konzept definiert Bedingungen, unter denen Menschen Freude an ihrer Arbeit und Produktivität entwickeln. Unter anderem sind dies das Gefühl der Kontrolle über unsere Arbeit, die Fähigkeit, uns auf unsere Arbeit zu konzentrieren, deutliche Ziele der Aufgabe und ein unmittelbares Feedback zu unseren Erfolgen und Misserfolgen. Und genau diese Faktoren des Gelingens, der Freude am eigenen Tun, eben des Flows, sind in unserer heutigen Arbeitswelt massiv in Gefahr.
Ein entscheidender Faktor hierfür liegt in dem Anteil an Arbeitsaufkommen und Prozessen, den wir nicht kontrollieren können – und dieser Anteil steigt stetig. Ob man raucht oder nicht, ist eine persönliche Angelegenheit. Ob man Sport treibt oder nicht, ebenso. Aber gilt das auch für den Aufgabenbereich, für Arbeitsziele, für die Erreichbarkeit via Telefon und E-Mail, für die Einteilung von Arbeitsschichten? Hier sind Zweifel angebracht. Über einige Faktoren des Arbeitsalltags hat man schlicht keine Kontrolle. Manchmal ist dies für das eigene Wohlbefinden oder die Gesundheit egal, manchmal aber eben auch nicht. Und wenn Glück, Produktivität und Flow die positive Seite der Arbeitsmedaille darstellen, haben wir es gleichzeitig mit Stress, ungünstigen Arbeitsbedingungen und Perspektivlosigkeit zu tun – der anderen Seite der Medaille. Diese Medaille hängt uns umso schwerer um den Hals, je mehr Zeit unsere Arbeit in Anspruch nimmt. Als Faustregel gilt immer noch: Wir verbringen mehr Zeit auf der Arbeit als mit unserem Partner. Und jetzt stelle man sich einmal vor, wie einen der Partner jahrelang beeinflusst, einen prägt, aufregt, aber auch beglückt. Und den Schreibtisch sieht man noch öfter als den eigenen Partner! Daher kann man ruhigen Gewissens die These aufstellen, dass Arbeit unsere geistige und körperliche Gesundheit wesentlich beeinflusst.
Dies hat der Gesetzgeber mittlerweile ebenfalls erkannt, wobei er mitunter schon übers Ziel hinausgeschossen ist, so etwa mit dem unsinnigen »Anti-Stress-Gesetz«. Positiv ist jedenfalls, dass auch politisch die Gesundheit der arbeitenden Menschen immer stärker in den Vordergrund rückt. Als eine der wichtigsten Maßnahmen dürfte hier die Erweiterung des § 5 Arbeitsschutzgesetz gelten: Unternehmen müssen nicht nur »physikalische, chemische und biologische Einwirkungen« am Arbeitsplatz analysieren, sondern auch »psychische Belastungen bei der Arbeit«. Denn wenn man vom Zusammenhang zwischen Arbeit und Krankheit spricht, ist ein Trend der postmodernen Lebens- und Arbeitswelt offensichtlich: Das Gehirn wird immer mehr zum zentralen Leidensorgan. Neben der Unkontrollierbarkeit der Arbeitsbedingungen ist dies der zweite Hauptgrund für die Zunahme arbeitsbedingter Krankheiten.
Betrachtet man die Entwicklung der Arbeitsanforderungen über die letzten Jahrzehnte, lässt sich die grobe Formel aufstellen: Es geht immer weniger um Körperkraft und immer mehr um Geisteskraft. Dementsprechend gibt es immer mehr Arbeitsplätze für brain worker (»Kopfarbeiter«). Das Fraunhofer-Institut hat 2013 sogar einen speziellen »Kopfarbeiter-Index« (KAI) geschaffen, um Fähigkeiten, Ressourcen und Belastungen speziell von Kopfarbeitern zu untersuchen. In dieselbe Richtung geht der zunehmend lautere Ruf der Wirtschaft nach akademisierten Ausbildungsmodellen. Handwerk ist out, der maßgefertigte Bachelor ist in. Mit 522.200 geschlossenen Ausbildungsverträgen wurde im Jahr 2014 folgerichtig ein neuer Tiefstand seit der Wiedervereinigung gemessen.
Eine Studie der ING-DiBa berechnet für Deutschland, dass »Bürokräfte und verwandte Berufe« mittelfristig mit einer Wahrscheinlichkeit von 89 Prozent durch Roboter bzw. automatisierte Prozesse ersetzt werden, »Anlagen- und Maschinenbediener, Montageberufe« immerhin noch mit einer satten Wahrscheinlichkeit von 69 Prozent. Egal, ob diese hohen Zahlen tatsächlich erreicht werden: Die Stoßrichtung ist klar. Was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Nicht automatisiert werden können bislang »unkopierbare« menschliche Fähigkeiten, etwa Kreativität, Wärme und Mitgefühl, Improvisationsgeschick, zum Teil auch komplizierte handwerkliche Tätigkeiten. Weil sich solche menschlichen Fähigkeiten auf absehbare Zeit eben nicht künstlich erzeugen und damit durch Digitalisierung und Automation ersetzen lassen, haben Akademiker und Führungskräfte, eben Kopfarbeiter, laut der ING-DiBa-Studie auch nur eine »Ersetzungswahrscheinlichkeit« von zwölf Prozent. Dafür sind diese Berufsgruppen besonderen mentalen Belastungen ausgesetzt – ein reichhaltiges Tätigkeitsfeld für medizinische Anbieter wie Neurologen, Psychiater und Pharmavertreter.
Eine Überlastung des menschlichen Gehirns und damit ein permanenter neuropsychologischer Ausnahmezustand sind für viele arbeitende Menschen heute Alltag. Arbeitsverdichtung, ständige Erreichbarkeit und Hyperkommunikation fordern vom Einzelnen darüber hinaus ein hohes Maß an Selbststeuerung und geistiger Disziplin. Führungskräfte finden es bequem oder schick, ihren Mitarbeitern möglichst wenig Vorgaben zu machen, allein ein Arbeitsergebnis zu vereinbaren und dann auf dessen Präsentation zu warten. Das verkauft man als Freiheit und Selbstbestimmung, als das Ende von manipulativer, kleinteiliger Kontrolle. Diese als »Kontrolle durch Autonomie« bekannte Mogelpackung setzt lediglich Rahmenbedingungen des Arbeitsprozesses und lässt den Mitarbeiter allein. Psychologisch gesehen, brauchen diese ungeführten Mitarbeiter ein hohes Maß an Selbstorganisation, Überblick, Widerstandsfähigkeit gegen Stress und eine hohe Toleranz gegenüber Unsicherheit.
Das bringt nicht jeder mit. Schlimmer noch: Ebendiese Fähigkeiten verlieren wir immer mehr. Beispiel Konzentration: Einer Auswertung der App »Menthal« zufolge »nutzen Menschen ihr Smartphone drei Stunden täglich und nehmen es im Schnitt alle 15 Minuten zur Hand, mal für ein paar Sekunden, meistens länger. Viel Zeit und Aufmerksamkeit für das Leben jenseits des Maschinchens bleibt da nicht mehr.« Amerikanische Untersuchungen bringen Ähnliches an den Tag: Wir werden immer impulsiver, ablenkbarer, ignorieren teilweise anwesende Menschen zugunsten virtueller Chats und Likes. Neue Technologien haben in 20 Jahren die anspruchsvollsten Funktionen unserer Großhirnrinde erheblich beeinträchtigt: Impulskontrolle, Konzentration, Planung. Neuropsychologische Forschungen zeigen, dass unser Geist für die Anforderungen der postmodernen Arbeitswelt schlecht gerüstet ist. Unser 100.000 Jahre altes Gehirn mit seiner bis heute bewährten Konstruktion muss manchmal vor den Gegebenheiten der Arbeitswelt kapitulieren, die den Wirkprinzipien des menschlichen Denkens und Erlebens zuwiderlaufen. Dabei geht es nicht um Kulturpessimismus, sondern um Evolution. Nicht um Esoterik, sondern um biologische Notwendigkeiten:
▪ Multitasking reduziert die Produktivität und erhöht die Fehlerraten – geschlechterübergreifend.
▪ Chronischer Stress erhöht den Cortisolspiegel im Gehirn, lässt es schrumpfen und beeinträchtigt die höheren Hirnfunktionen wie Kreativität, Planung und Problemlösung.
▪ Ständige Erreichbarkeit versetzt uns in einen permanenten Alarmzustand, selbst wenn wir das nicht bewusst wahrnehmen.
▪ Arbeitsverdichtung und Termindruck lassen keine Zeit für Pausen – die wiederum Voraussetzung sind für hohe Produktivität in den Stoßzeiten.
▪ Kleinteiliges Spezialistentum verwehrt uns den Blick aufs »große Ganze« unserer Aufgabe. Geringere Motivation und subjektive Sinnlosigkeit des eigenen Tuns sind die Folge.
Das sind nur einige Phänomene, die unseren Arbeitsalltag prägen, die aber große Auswirkungen haben auf unser Wohlbefinden und unsere geistige Gesundheit. So schreibt die Bundespsychotherapeutenkammer bereits 2013: »Knapp 14 % aller betrieblichen Fehltage gingen 2012 auf psychische Erkrankungen zurück. Damit hat sich der Anteil von betrieblichen Fehltagen, die durch psychische Erkrankungen bedingt sind, seit 2000 fast verdoppelt. Diese Zunahme läuft der allgemeinen Entwicklung entgegen, dass der Anteil betrieblicher Fehlzeiten aufgrund körperlicher Erkrankungen seit Jahren stetig abnimmt. 2012 waren psychische Erkrankungen die zweithäufigste Ursache für Arbeitsunfähigkeitstage.«
Belastungen, Stress und Neuropsychologie hin oder her: Will unser Geist nicht geprüft werden? Menschen lieben doch die Herausforderung, das Problemlösen! Ewige Entspannung wäre doch eine Qual! Genau hier liegt in der Tat auch die Chance von Arbeit als glückspendendem Element des Lebens. Herausforderungen meistern, Probleme lösen, immer weiter gehen – auch das ist Menschsein. Auch das können wir in der Arbeit verwirklichen. Nur darf man einen Aspekt nicht vergessen: den Faktor Zeit.
Man stelle sich einen uralten, klapprigen Opel Kadett vor. Auf der Autobahn kann man damit in der Regel nur 100 km/h fahren (außer es geht bergab), und wenn man einen LKW überholt, hat man sofort jemanden hinter sich, dem es nicht schnell genug geht. Was tun? Man tritt das Gaspedal durch, schickt ein Stoßgebet an den Schutzengel der Gebrauchtwagenfahrer und versucht, so schnell wie möglich wieder einzuscheren. Einmal zu überholen, ist okay. Zweimal bereits ein Wagnis, und ständig auf der linken Spur zu bleiben, würde einer Todessehnsucht wohl ziemlich nahe kommen. Übertragen auf unsere Arbeitsleistung bedeutet das: Die Arbeitswelt zwingt unser Gehirn, nicht nur einmal oder zweimal zu überholen, sondern permanent auf der linken Spur zu bleiben. Und das Tage, Wochen, Monate, Jahre. Kein Gehirn, kein Motor macht so etwas lange mit.
Wenn man bei sich selbst überprüfen will, ob der »mentale Motor« bereits heiß läuft, geht das ganz einfach: Machen Sie Urlaub. Ihr Körper wird Ihnen sehr schnell zeigen, wo Sie stehen. Leisure sickness (»Freizeitkrankheit«) nennt sich dieses Phänomen. Viele Menschen wundern sich, dass sie gerade dann krank werden, wenn der Urlaub beginnt. Nach ihrer Logik müsste die Auszeit den Organismus entlasten. Man sollte nicht müde werden oder krank, sondern im Gegenteil frischer, vitaler, ausgeruhter. Aber so funktioniert unser Organismus nicht. Der Körper merkt bei Urlaubsbeginn: Ich kann loslassen, muss nicht mehr brutal funktionieren. Die Folge: Das Immunsystem fährt herunter, die Anspannung lässt nach, man fühlt sich schwach, bekommt Schnupfen oder Kopfschmerzen. Auch die mentale Unruhe, das Getriebensein legt sich erst nach einer Weile. In der Regel brauchen Menschen vier bis zehn Tage, um geistig in den Urlaubsmodus zu schalten. Doch dann ist der Urlaub meist schon wieder vorbei und die Anspannung fängt von vorne an. In diesem Zyklus aus ständiger Anspannung in der Arbeit und zu kurzer Ruhephase im Urlaub ermüdet und verschleißt unser Gehirn immer mehr. Das Ende vom Lied ist dann manchmal ein handfestes Burn-out, das eine längere Pause buchstäblich erzwingt. Der Organismus wählt das (vorläufige) Ende mit Schrecken statt des Schreckens ohne Ende. Dieser Schrecken ist mittlerweile in vielen Bereichen gut dokumentiert, beispielsweise in der Zahl von Frühverrentungen aufgrund von Depression, in den immer längeren Wartezeiten bei Psychiatern und Psychotherapeuten, im erhöhten Gebrauch von Psychopharmaka oder dem Phänomen des Neurodopings.
In unserem Leben verbringen wir sehr viel Zeit mit Arbeit. Das kann beglückend sein, aber auch belastend. Wenngleich jeder von uns mit Belastungen anders umgeht: Den negativen Einfluss der Arbeitswelt und ihrer Bedingungen insgesamt können wir nicht mehr ignorieren. Die Unkontrollierbarkeit von Arbeitsbedingungen, das Gehirn als zentrales Leidensorgan und Stress durch Arbeitsverdichtung, Termindruck und Hyperkommunikation lassen Dinge wie Glück, Freude an der Arbeit oder gar ein Flow-Erleben sehr schwer aufkommen. Unser Geist kapituliert und reagiert mit Burn-out, körperlichen Krankheiten, Depression, Rückzug oder einer ganz anderen, individuellen »Lösung«. Wären all diese Probleme nur auf die Arbeitswelt beschränkt, könnten wir eine Kompensation aufbauen, zum Beispiel mit einem erfüllten Familienleben. Doch hier deutet sich das zweite Konfliktfeld an. Denn die viel zitierte und viel geforderte Vereinbarkeit von Beruf und Familie lässt sich in unserer Arbeitswelt nur schwer verwirklichen. Man könnte auch sagen: Sie ist eine Lüge.
![]()
Kinder, Kino, Karriere – Das Ende der Work-Life-Balance
Stechuhren sind die Scharfrichter der Arbeitsgesellschaft. Jedenfalls waren sie das. Sie urteilten über Arbeit und Freizeit, drinnen und draußen, Werkhalle oder Fußballfeld. Mit einem kalten, klaren Druck protokollierten sie die Anwesenheit eines Arbeitnehmers und damit seine Berechtigung, in den Feierabend zu gehen oder eben nicht. Auch kulturell war der Rhythmus aus Arbeit und Feierabend fest verankert. So sang Sheena Easton im Jahr 1980: »My baby takes the morning train, he works from nine till five and then he takes another home again to find me waitin’ for him.« Der Song »9 to 5« über den festen Bürojob ihres Geliebten wurde ihr größter Hit und zum musikalischen Symbol des industriellen Taktes. Bis in die Mitte der 1990er-Jahre hinein dominierte dieser feste Arbeitsrhythmus und bildete mit der Vollzeitstelle und der Tarifbindung den harmonischen Dreiklang sozialer Marktwirtschaft. Doch spätestens mit Beginn der 2000er-Jahre klang der Dreiklang schief, disharmonisch. Das Gefüge von Arbeit und Privatleben lockerte sich, wurde kräftig durcheinandergewirbelt und setzte sich anders wieder zusammen.
Verantwortlich hierfür ist eine einzigartige Kombination mehrerer Faktoren: Globalisierung, Digitalisierung, Subjektivierung und Emanzipation. Ein Faktor allein wäre womöglich schon stark genug, eine Gesellschaft umzuwälzen. Doch diese vier Trends verstärken sich gegenseitig und höhlen – als eine von vielen Folgen – unser Verständnis von Work-Life-Balance aus. Die allgemein akzeptierte Entgrenzung der Arbeitswelt in ihrer zeitlichen, räumlichen und funktionalen Dimension bedeutet im Ergebnis, dass die strikte Trennung von Arbeit und Privatleben Geschichte ist, ein abgeschlossenes Kapitel der Managementliteratur, Abteilung »Relikte des 20. Jahrhunderts«.
Zunächst sorgt die Globalisierung dafür, dass zeitzonenübergreifend gearbeitet wird. Egal, ob Indien oder Hamburg, irgendwer arbeitet immer. Die Arbeitsteiligkeit der Prozesse, das Outsourcing über Länder- und kontinentale Grenzen hinweg und Konzepte wie Lean Production sorgen dafür, dass der Einzelne immer flexibler verfügbar sein muss. War schon die normale Schichtarbeit nicht gerade gesundheitsförderlich, doch immerhin berechenbar, lösen sich die Ruhezeiten mehr und mehr in nichts auf. 22 Uhr in München? Egal, in New York ist es gerade 16 Uhr, das Meeting ist wichtig, also geht da noch was. Globalisierte Prozesse wurden nicht nur ein fester Bestandteil des organisatorischen Alltags, sondern zum Lackmustest für die soziale Einstellung der Unternehmen. Der Mensch bleibt nur noch so lange »im Mittelpunkt«, wie er dem globalisierten, örtlich und zeitlich entgrenzten Produktionsrhythmus ohne Murren folgt. Wer in den globalisierungseuphorischen 1990er-Jahren nicht recht einsah, warum er seinen Nachtschlaf für ein Telefonat mit Hongkong unterbrechen sollte, konnte sich ja etwas anderes suchen. Es standen genug andere vor der Tür, die bereitwillig den Job übernahmen. Anders als heute, wo sich Diskussionen über Fachkräftemangel, über den »Krieg um Talente« oder das Schlagwort der Caring Company bei den Unternehmertagungen die Klinke in die Hand geben. Die Segnungen der Globalisierung – die zweifellos vorhanden sind – haben ihren Preis. Der Wohlstand der Weltgemeinschaft wird zumindest in den Industrieländern mit einem Übergreifen der Arbeit in die Privatsphäre bezahlt, mit Überstunden, Burn-out und schlechtem Gewissen gegenüber der Familie.
Parallel zur enthemmten Globalisierung entfaltete die Digitalisierung in praktisch allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen einen enormen weltweiten Produktivit...