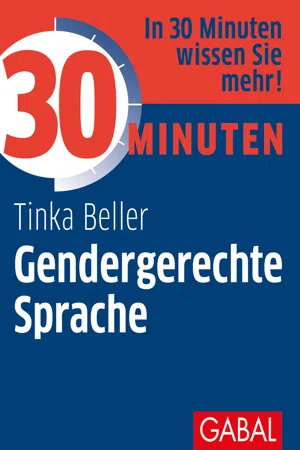
- 96 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
30 Minuten Gendergerechte Sprache
Über dieses Buch
Der Begriff "gender" ist in den letzten Jahren zum Reizwort mutiert, das in privaten und öffentlichen Diskussionen regelmäßig Menschen in Rage versetzt. Doch zwischen "gendergap" und "generischem Maskulinum" geht oftmals der eigentliche Beweggrund der Gender-Debatte verloren: die Gleichbehandlung und Gleichberechtigung aller Menschen unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht.
Erfahren Sie in diesem Ratgeber, wie Sie in Alltag und Beruf gendergerecht kommunizieren, dadurch Diskriminierungen in Ihrer Wortwahl vermeiden und so letztendlich die Gleichstellung der Geschlechter fördern können.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu 30 Minuten Gendergerechte Sprache von Tinka Beller im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sprachen & Linguistik & Rhetorik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1.Gleichberechtigung und Sprache – wie hängt dies zusammen?
Für den jetzigen Stand der Gleichberechtigung war die sogenannte „erste Frauenbewegung“ unverzichtbar. Errungenschaften wie zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen sind weder von allein entstanden noch kamen Männer auf die Idee, dass sich da etwas ändern müsste. Frauen sind für diese Rechte, teilweise gegen große Widerstände, aktiv geworden und haben sich letztlich durchgesetzt. Welchen Einfluss Sprache auf Wahrnehmung hat, lässt sich in diesem Zusammenhang gut am Wahlrecht der Schweiz erkennen: Erst 1971, also vor weniger als 50 Jahren, wurde es Frauen dort ermöglicht, zu wählen. Begründet wurde die Ablehnung des Frauenwahlrechts bis dahin mit folgender Formulierung in der Verfassung: „Stimmberechtigt ist jeder Schweizer, der das zwanzigste Altersjahr zurückgelegt hat (…).“ Demnach war es nur folgerichtig und konsequent, dass nur „Schweizer“ wählen durften, aber keine „Schweizerinnen“. Schon hier ist die Relevanz gendergerechter Sprache abzusehen.
1.1Hegemoniale Männlichkeit und ihre Folgen
Für die jüngere Generation, das heißt für all diejenigen, die mit „Selbstverständlichkeiten“ aufgewachsen sind wie dem Frauenwahlrecht oder der Tatsache, dass Frauen autonom ein Bankkonto eröffnen oder einen Arbeitsvertrag unterzeichnen dürfen (ohne die bis 1977 in Deutschland nötige Unterschrift des Ehemannes), mag sich der Wunsch nach einer gleichberechtigten Sprache „gestrig“ oder „total übertrieben“ anhören. Vielleicht hilft hier ein Blick auf die Realität: Frauen sind – auch in Deutschland – noch weit davon entfernt, Männern gegenüber gleichberechtigt zu sein.
Gleichberechtigung bezieht sich definitiv auf mehr Bereiche als nur auf die Themen Berufstätigkeit und Gehalt. Doch gerade hier gibt es besonders viel Handlungsbedarf. Das macht eine Studie der AllBright Stiftung, die sich für mehr Diversität einsetzt, deutlich: Demnach gab es 2017 in deutschen Aufsichtsräten mehr Männer, die Thomas oder Michael heißen (49 Personen), als Frauen insgesamt (46 Personen). Aufsichtsräte waren zum Zeitpunkt der Studie zu 93 Prozent männlich und ähnelten sich auch im Hinblick auf das Alter (im Durchschnitt 53 Jahre), die Herkunft (Westdeutschland) und die Ausbildung (71 Prozent Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieure). Hier sind Frauen in keiner Weise präsent, weder optisch noch sprachlich.
Was ist hegemoniale Männlichkeit?
„Hegemonie“ bedeutet Vorherrschaft oder Überlegenheit, „hegemoniale Männlichkeit“ bezeichnet also die Überlegenheit des Männlichen bzw. der Männer. Hier geht es nicht darum, ob Männer tatsächlich das überlegene Geschlecht sind, sondern um die Tatsache, dass sie aktuell eine dominante soziale Position innehaben. Die hegemoniale Männlichkeit ist aktuell noch die Norm in der Gesellschaft.
Im Vergleich zu einem Hegemonen, hier der Gruppe der weißen, heterosexuellen Männer, werden „die anderen“ viel weniger wahrgenommen. Grundlegend sind hierfür die verschiedenen Formen der Privilegierung. In der patriarchalischen, hegemonial männlichen und eurozentrischen Welt ist die Gruppe weißer, heterosexueller Cis-Männer am meisten privilegiert. (Unter „Cis-Mann“ bzw. „Cis-Frau“ werden Personen verstanden, bei denen Geschlechtsidentität und Geschlecht qua Geburt übereinstimmen. Das Gegenteil wird als „Transgender“ bezeichnet.) Das bedeutet, dass diese Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen Identität und Orientierung und ihres Geschlechts keine Diskriminierung erfahren. Letztlich lassen sich durch eine derartige Analyse Machtstrukturen aufzeigen, die durchbrochen werden sollen.
Die Einflussmöglichkeiten von Personen, die (zum Beispiel) qua Geschlecht abweichen, sind durch die dominante soziale Position von Männern sehr gering. Vereinfacht dargestellt werden alle, die dem Bild nicht entsprechen, als untergeordnet wahrgenommen.
Das Gesetz der Sympathie
Diese Prozesse laufen häufig unbewusst ab. Das, was wenn überhaupt nur als diffuses Gefühl wahrgenommen wird, lässt sich mit dem „Gesetz der Sympathie“ erklären. Ein Beispiel:
Eine Führungskraft, die eine Stellenbesetzung vorzunehmen hat, wird – wie jede andere Person auch – sehr viele Entscheidungen treffen. Neben den „harten Fakten“, wie einer geforderten Qualifikation oder Berufserfahrung, spielen viele weitere Faktoren eine Rolle, die nicht logisch zu erklären sind. Wesentlich ist zum Beispiel, ob uns unser Gegenüber sympathisch ist. Diesen Personen vertrauen wir eher, wir halten sie für kompetent und zweifeln seltener an dem, was sie uns mitteilen.
Doch was trägt dazu bei, ob uns jemand sympathisch oder unsympathisch ist? Ein wesentlicher Faktor für Sympathie ist Ähnlichkeit. Jemand, der uns ähnlich ist, kann ja nicht so verkehrt sein, suggeriert uns unser Gehirn. Ähnlichkeit kann in vielen Details erkannt werden. Sprechen Sie dieselbe Sprache wie Ihr Gegenüber? Haben Sie einen ähnlichen Bildungsstand? Oder gleiche Interessen? Während einige dieser Details sich erst später erschließen, gibt es Ähnlichkeiten, die sich auf den sprichwörtlichen ersten Blick erkennen lassen: Ist Ihr Gegenüber männlich oder weiblich? Und schon haben Sie eine Menge, was Sie miteinander verbindet – oder auch nicht.
Das, was uns bekannt ist, erscheint uns sympathischer als Unbekanntes. Unbekanntes ist eher befremdlich und wird eher als trennend wahrgenommen. So wird auch klar, warum es in bestimmten Positionen immer noch zu sogenannten „Reproduktionen“ kommt: Die Führungskraft, die eine neue Stelle besetzt, lässt – unbewusst – den Faktor Geschlecht als Sympathiemerkmal in ihre Bewertung einfließen. Das gleiche Geschlecht bedeutet viel Ähnlichkeit und damit einen Sympathievorsprung gegenüber „den anderen“, also (in den meisten Fällen) allen, die nicht männlich sind.
Wichtig ist es, zu verstehen, dass diese Prozesse nicht bewusst steuerbar sind, sondern sich im Unterbewusstsein abspielen. Assoziationen und Wahrnehmungen lassen sich nicht abschalten, das Gehirn funktioniert immer. Deswegen ist es notwendig, gendergerechte Begriffe bewusst zu verwenden, damit auch sie „normal“ werden und im Sprachgebrauch präsent sind. Dieser Prozess nimmt Zeit in Anspruch: Auch das Sprachzentrum im Gehirn präferiert Bekanntes.
Stand der Dinge: Sprache ist männlich
Das (generische) Maskulinum bzw. die Verwendung der männlichen Form in der Sprache ist aktuell die Norm (mehr zu dieser sprachlichen Problematik in Kap. 3.1). Das Weibliche ist die Abweichung von der Norm, das „Nicht-Normale“. Das bedeutet eine Asymmetrie im Sprachgebrauch. Alles, was männlich ist, ist präsenter, weil es häufiger erwähnt oder geschrieben wird. Alles, was weiblich ist, ist zunächst „anders“ und muss gegebenenfalls noch erläutert werden. Das ist problematisch, weil das, was wir häufiger hören, sehen oder lesen, unsere Gedanken stärker prägt als das, was wir seltener hören oder seltener vor Augen haben.
Es gibt viele Beispiele für diese unterschiedliche Wahrnehmung von Männern und Frauen und die Art, wie sich diese auf sprachlicher Ebene niederschlägt. Führende Politikerinnen wie Angela Merkel oder Ursula von der Leyen wurden die ersten Jahre ihrer politischen Tätigkeit in Fernsehberichten und Reportagen beispielsweise explizit als „Frau Merkel“ bzw. „Frau von der Leyen“ tituliert. Der Ursprung dieser Formulierung war keineswegs Höflichkeit, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern das Verdeutlichen ihres „Andersseins“. Niemand wäre auf die Idee gekommen, die jeweils männlichen Vorgänger als „Herr Kohl“ oder „Herr de Maizière“ zu bezeichnen. Falls den Namen etwas vorangestellt wurde, dann höchstens das jeweilige Amt, also „Kanzler Kohl“ oder „Verteidigungsminister de Maizière“, jedoch nie „Herr“ – dass es sich um Männer handelte, war einfach so selbstverständlich, dass es nicht extra erwähnt werden musste.
Eine „Mitgemeinte“ wehrt sich
Auch wenn das eben beschriebene Beispiel verdeutlicht, dass sogar Spitzenpolitikerinnen sprachlich anders behandelt werden, und die vorher genannten Zahlen, Daten und Fakten zeigen, dass Frauen generell in Führungspositionen unterrepräsentiert sind, ist die Wahrnehmung häufig eine andere. Besonders in der Diskussion um Gleichstellung in der Sprache kommt häufig das Argument: „Frauen sind gleichberechtigt, das muss man nicht extra erwähnen!“ Auf den Vorwurf, dass gendersensible Sprache unverständlich und schwer lesbar sei, folgt fast reflexartig folgende Aussage: „Diesen ganzen Gender-Terrorismus braucht man gar nicht, weil Frauen natürlich mitgemeint sind!“ Wie so oft ist hier „gut gemeint“ das Gegenteil von „gut gemacht“, denn das generische Maskulinum bzw. das „Mitmeinen“ ist definitiv keine Lösung, um die Sichtbarkeit verschiedener Personengruppen zu erreichen (vgl. Kap. 3.1).
Gegen die Tatsache, „mitgemeint“ zu werden, setzte sich Marlies Krämer, eine Kundin der Sparkasse, zur Wehr. Mit ihrer Klage im Jahr 2018 wollte sie erreichen, dass Banken ihre weibliche Kundschaft im Schriftverkehr als „Kontoinhaberin“ bzw. „Kundin“ ansprechen müssen.
Mit einem ähnlichen Ansinnen war Krämer Jahre zuvor bereits erfolgreich: Ihr bzw. ihrer Klage ist es zu verdanken, dass in den Wetterberichten die „Hochs“ nicht mehr ausschließlich männliche und die Tiefs nicht mehr ausschließlich weibliche Namen tragen. Die pragmatische Lösung: Es werden abwechselnd Frauenbzw. Männernamen verwendet, es gibt das „Hoch Maria“ ebenso wie das „Tief Britta“ oder das „Hoch Giovanni“ und das „Tief Michael“. Bei großem Interesse kann so eine Wetterfront quasi „gekauft“ werden, wobei Hochs teurer sind als Tiefs.
Noch bevor sich Krämer diesen Themen zuwandte, sorgte sie im Jahr 1990 für eine Änderung: Sie wollte in ihren Dokumenten nicht als „Inhaber dieses Ausweises“ unterschreiben, sondern gendergerecht als „Inhaberin“. Doch auch diese, heute nicht mehr wegzudenkende Formulierung musste erst auf dem Klageweg eingefordert werden.
Dass im Jahr 2018 überhaupt noch geklagt werden muss, damit Banken ihre weibliche Kundschaft gendergerecht ansprechen, scheint skurril. Noch skurriler mutet die Begründung der Ablehnung an: Das Landgericht argumentierte, dass „schwierige Texte durch die Nennung beider Geschlechter noch komplizierter“ würden und dass „die männliche Form schon seit 2000 Jahren verwendet“ werde. „Das war aber schon immer so!“ als Argument erscheint vor dem Hintergrund der zahlreichen Veränderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte etwas unglaubwürdig.
Veränderungen sind möglich
Von der Einführung der fünfstelligen Postleitzahlen über den Wechsel von der D-Mark zum Euro, der viel kritisierten Rechtschreibreform oder der erst kürzlich vorgenommenen Änderung von der achtstelligen Kontonummer zur 22-stelligen IBAN – in all diesen Fällen ist der anfängliche Widerstand innerhalb kürzester Zeit dem ...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- In 30 Minuten wissen Sie mehr!
- Inhalt
- Vorwort
- 1. Gleichberechtigung und Sprache – wie hängt dies zusammen?
- 2. Diskriminierung durch Sprache
- 3. Gendergerechte Sprache in der Praxis
- Fast Reader
- Die Autorin
- Weiterführende Literatur