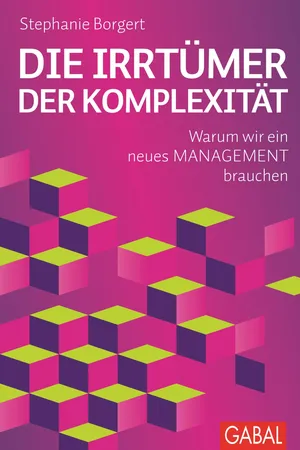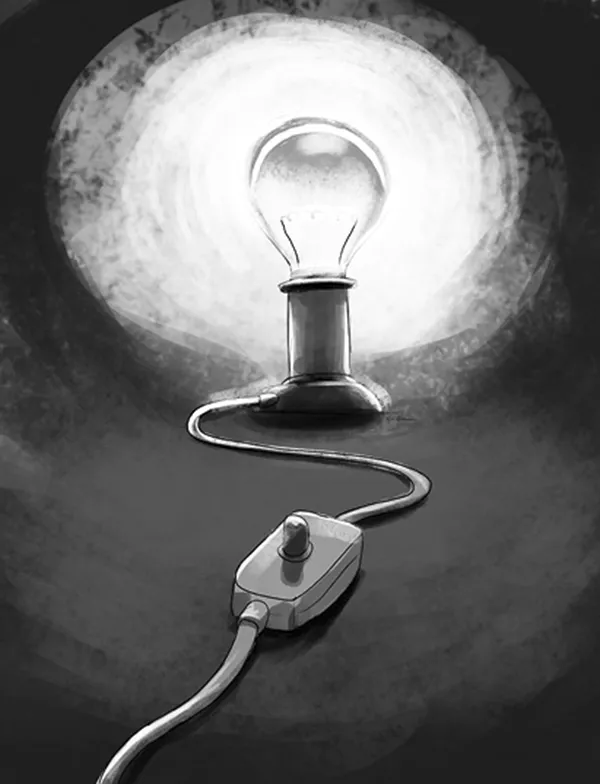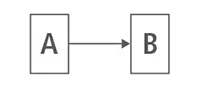![]()
Irrtum Nr. 1:
Vereinfachung führt zum Erfolg
![]()
Einfach gibt Sicherheit
Wie sieht in Ihrem Unternehmen der Prozess »Urlaubsantrag« aus? Wahrscheinlich sehr klar. Unabhängig davon, ob er manuell oder automatisch abläuft, werden Sie den gewünschten Urlaubszeitraum eintragen und zur Freigabe an Ihren Vorgesetzten schicken müssen. Der wiederum zeichnet frei und gibt den stattgegebenen Antrag an die Personalabteilung. So oder so ähnlich wird der Prozess laufen. Man hat Ihnen diesen Ablauf einmal vorgestellt, Sie mit dem Tool vertraut gemacht und schon ging es in die erste Freizeit. Das war einfach. Sie brauchen sich darum keine unnötigen Gedanken machen und bei jedem neuen Urlaubsantrag ist der Prozess identisch. Das gibt Ihnen Sicherheit.
Ob Urlaubsantrag oder andere Dinge des Lebens, wir haben es gerne sicher. Wir wissen, was zu tun ist und mit welchem Ergebnis wir rechnen können. Sicherheit ist ein tief im Menschen verankertes Bedürfnis und wir sehnen uns aus evolutionären Gründen danach. In den frühen Zeiten unserer Geschichte war Angst ein wesentliches Mittel, das uns vor Risiken bewahrt hat. Sie hat bis heute eine lebenserhaltende Schutzfunktion, auch wenn wir dabei zwischen »echten« Risiken und »subjektiv konstruierter« Angst unterscheiden müssen.
Letztendlich ist Angst natürlich immer subjektiv und damit immer wahr, auch wenn ihr kein »objektives« Risiko gegenübersteht. Sie sorgt dafür, dass wir lieber flüchten, als uns einem Risiko auszusetzen. Ging es in der grauen Vorzeit dabei noch um Leben und Tod, ist das in der modernen (Arbeits)-Gesellschaft eher selten der Fall. Trotzdem ist der Mechanismus erhalten geblieben und damit auch die latente Ablehnung des Ungewissen und Undurchsichtigen.
Unsere Vorfahren hatten angesichts eines Säbelzahntigers keine Zeit, lange zu überlegen, was sie tun sollten, sie mussten sofort reagieren. Die komplexen Probleme in unserem Arbeitsalltag sind in der Regel nicht lebensbedrohlich, sie erzeugen jedoch aus sich heraus Zeitdruck. Dieser entsteht durch die gegebenen Rahmenbedingungen. Meistens ist es der wirtschaftliche Druck, der schnelle Lösungen verlangt. Der damit verbundene Stress sowie die Stressreaktionen sind vergleichbar mit denen unserer Vorfahren. Stress führt dazu, dass wir intuitiv reagieren und unsere Entscheidungen instinktiv treffen. Dazu nutzen wir die im Stammhirn angesiedelte Amygdala, denn sie greift schnell auf unser unbewusstes Wissen zu.
Die Entscheidung lautet dann Flucht, Angriff oder Totstellen. Übertragen auf unser komplexes Problem bedeutet Flucht beispielsweise Krankmeldung, Kündigung, Versetzungsantrag oder Delegation der Aufgabe. Totstellen kennen wir in Form von Arbeitsverweigerung, endlosem Aufschieben oder ebenfalls der Krankmeldung. Wie aber sieht das Lösen eines komplexen Problems, also der Angriff, aus? Blindwütiges Agieren führt normalerweise nicht zum Erfolg. Für eine sorgfältige Analyse fehlt die Zeit, also liegt die Hoffnung in der Vereinfachung. Damit ist die Gefahr abgewehrt, glauben wir. Aber genau darin steckt der Irrtum.
Komplexe Aufgaben und Probleme lösen sich durch Vereinfachung nicht auf.
Lösen lassen sich komplexe Aufgaben dadurch schon gar nicht. An dieser Stelle müssen wir zunächst unterscheiden zwischen einfach und komplex.
Wiederholbar, nachvollziehbar und selbsterklärend
Viele der heute in Organisationen implementierten Prozesse sind gute Beispiele für einfache Kontexte. Sie haben einige Eigenschaften gemeinsam, die Einfachheit ausmachen: Ihre Ursache-Wirkungs-Relation ist eindeutig, transparent und wiederholbar. Für einfache Kontexte gibt es genau eine richtige Art und Weise, Antwort oder Lösung. Niemand kommt beispielsweise auf den Gedanken, die Funktionsweise eines Lichtschalters zu hinterfragen. Schalter auf »An«, Licht geht an, Schalter auf »Aus«, Licht geht aus. Es gibt keinen Anlass für Diskussionen, der Vorgang ist für jeden klar. Die Ursache ist das, was abläuft. Die Wirkung ist das Resultat.
Ein Beispiel: Sie haben mit Ihrem Büroartikelhersteller die Anlieferung neuer Bürostühle für den 15. März verabredet. Das ist im Kaufvertrag so festgehalten. Nun schauen Sie auf Ihren Kalender und stellen fest, dass bereits der 17. März ist. Demnach ist der Hersteller mit seiner Lieferung im Verzug. Die Kategorisierung lautet »zu spät«. Jetzt können Sie entsprechend der vertraglichen Vereinbarung (Mahnung, Stornierung et cetera) reagieren.
Der wichtige Punkt, in dem sich solch einfache Systeme von komplexen unterscheiden, ist die Vorhersagbarkeit. Genau wie komplizierte Sachverhalte gehören die einfachen zur geordneten Welt, in der es einen klaren Ursache-Wirkungs-Zusammenhang gibt. Der existiert in komplexen Systemen auch, ist für uns aber erst im Rückblick erkennbar. Ein einfaches System ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Restriktionen, die im vorherigen Kapitel dargestellt und erläutert wurden. Dadurch kann Verhalten kontrolliert und vorhergesagt werden. Jeder kann sehen, was das Richtige ist.
Entscheidungen können wir in diesen einfachen Kontexten über Kategorisierung treffen.
Einfach ist der Bereich der »Known Knowns«. Wir wissen, was wir wissen. Es herrscht Klarheit für alle Beteiligten, worum es geht und wie etwas geht. Der Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung ist für jeden nachvollziehbar und bedarf keiner Diskussion. Das erzeugt Stabilität. In einem solchen System ist ein faktenbasierter Führungsstil im Sinne von Command & Control durchaus sinnvoll und Kontrolle ein angebrachtes Steuerungselement. Aufgaben lassen sich gut delegieren und Funktionen automatisieren. Leider wenden wir die Kontrolle (aus geordneten Systemen) auch da an, wo sie keinen Sinn macht, oder wir überspannen den Bogen.
Ein Beispiel dafür sind Ausschreibungsverfahren. Die Compliance-Richtlinien vieler Unternehmen sehen vor, dass im Rahmen einer Ausschreibung mindestens drei Angebote von verschiedenen Anbietern eingeholt werden müssen. Oft genug hat der Fachbereich (oder der Einkauf) bereits eine eindeutige Präferenz, bevor der Prozess überhaupt gestartet ist. In solchen Fällen ist schon im Ausschreibungstext offensichtlich, für welchen Anbieter er geschrieben wurde. Die zwei Wettbewerber werden lediglich pro forma um ein Angebot gebeten. Die Überkontrolle dieses Prozesses bringt die Menschen dazu, einen Workaround zu finden, um den Prozess zu unterlaufen. Das bindet jede Menge Energie und verschwendet Ressourcen auf allen Seiten.
Zu viel Kontrolle bringt die Menschen dazu, einen Weg »drumherum« zu finden.
Wir neigen dazu, Zusammenhänge als einfach zu deklarieren, die es gar nicht sind. Oft glauben wir, eine klare Ursache-Wirkungs-Relation benennen zu können. Dabei übersehen wir aber, dass diese sich erst rückblickend formulieren lässt.
In dem Buch »Einfach managen: Komplexität vermeiden, reduzieren und beherrschen« (Brandes/Brandes, 2013) beschreibt der ehemalige Aldi-Manager Brandes einen seiner Beratungseinsätze bei einer türkischen Unternehmergruppe. Ein Lebensmittel-Filialunternehmen wollte 1995 nach den Prinzipien von Aldi die Türkei erobern. Die Erfolgskriterien – Standort, Sortiment und Preis – werden in einer selbstverständlichen klaren Ursache-Wirkungs-Relation beschrieben, ganz nach dem Motto: Werden diese Kriterien richtig gewählt, dann wird die Filiale ein Erfolg.
Der Autor beschreibt weiter, wie man bei der Ausstattung der ersten Filiale vorging. Bekannte wurden zum Einkaufen geschickt; sie sollten Produkte mitbringen, die sie in einem Lebensmittelladen erwarteten. Diese Produkte wurden auf dem Fußboden der Filiale ausgelegt, um durch eine geschickte Anordnung einen guten »Durchlauf« für die Kunden zu finden. Die Planer entfernten doppelte Produkte und ergänzten die noch fehlenden. Innerhalb von einer Woche stand die Filiale. »Das war ein wirklich einfaches und sehr effizientes Verfahren«, so der Autor.
Die Effizienz dieses Vorgehens will ich nicht bestreiten, aber einfach (im Sinne dieses Buches) war sie mitnichten. Sie war wohl eher pragmatisch. Natürlich gibt es Erfahrungswerte, die belegen, dass die Kriterien Preis, Sortiment und Standort eine große Bedeutung für den Erfolg eines Lebensmittelmarktes haben. Der Einzelhandel ist und bleibt jedoch ein komplexes System. Ich kann den Erfolg nicht vorhersagen. Im Rückblick ist es leicht, diese Kausalität zu benennen und als A-priori-Wissen zu vermarkten. Das hat aber nichts mit einfach zu tun – genauso wie die Umsetzung letztendlich nichts mit einfach zu tun hat. Der Autor und seine Mitstreiter haben ausprobiert, und das in mehrfachem Sinne. Zum einen haben sie Produkte zusammengetragen und die verschiedenen Vorstellungen der Mitwirkenden genutzt. Sie haben die Anordnung der Produkte ausprobiert. In Summe haben sie das Experiment »Filialerfolg« durchgeführt, bei dem niemand ernsthaft vorab garantieren konnte, dass es ein Erfolg wird.
Allein die mehrfache Wiederholung einer Kausalität gibt keine Garantie auf eine nächste Wiederholung und macht aus komplex auch nicht einfach.
![]()
Die Kausalitätsfalle
Am Morgen des 19. November 2013 sterben zwei Menschen beim Absturz eines Hubschraubers in der Nähe von Neuhausen ob Eck. Es sollte für den 48-jährigen Fluglehrer und seinen Schüler eigentlich eine ganz normale Flugstunde werden. »Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hat menschliches Versagen das Unglück ausgelöst«, titeln die Zeitungen nach der Absturzanalyse. Diese »Erkenntnis« wird dem Leser gleich im ersten Abschnitt präsentiert. Die Ermittler, so wird weiter berichtet, konnten keine Hinweise auf technische Defekte finden.
Im Klartext heißt das: Wir haben keine Ahnung, was an dem Tag in diesem Hubschrauber und drumherum passiert ist. Unser Bedürfnis, immer die Ursache zu kennen, ist so groß, dass wir gerade bei Unglücken gerne das »menschliche Versagen« nennen, auch wenn wir es eigentlich nicht wissen. Damit haben wir eine Kausalität und sind beruhigt. In diesem Fall ist die Kausalitätsfalle besonders kritisch, weil mit ihr eine moralische Bewertung und Schuldzuweisung einhergehen.
Klare Ursache, klare Wirkung
Der Untersuchungsausschuss zur Atomkatastrophe in Fukushima kam zu dem Ergebnis, dass menschliches Versagen der Grund für das angeblich vermeidbare Unglück war. Man muss sicher kein Komplexitätsforscher sein, um sich vorzustellen, dass das »System Fukushima« hochkomplex ist, und das auch schon, ohne den Faktor Mensch zu berücksichtigen. Sicher gab es Fehlentscheidungen, Versäumnisse und Fehler aufseiten der Firma Tepco, der Aufsichtsbehörden und der Regierung. Das soll hier nicht in Abrede gestellt werden. Damit ergibt sich aber keine Verkettung von Ursachen und Wirkungen, die linear und direkt zum Unglück führen.
Als am 11. März 2011 gegen 14:46 Uhr (Ortszeit) die Primärwellen des Tohaken-Erdbebens das Kernkraftwerk erreichen, löst das die Schnellabschaltung der Reaktoren 1 bis 3 aus. Wegen Wartungsarbeiten sind die weiteren Reaktoren nicht in Betrieb. Um 14:48 Uhr sind die Turbinen der Reaktoren heruntergefahren. Rohrleitungen sind durch das Beben beschädigt, Wasser tritt aus, möglicherweise sind zu diesem Zeitpunkt Kühlkreisläufe bereits unterbrochen. Fukushima 1, das älteste und mit seinen sechs Kraftwerkblöcken das leistungsstärkste Atomkraftwerk Japans, ist nicht an das Tsunami-Warnsystem angeschlossen.
Um 15:27 Uhr trifft die erste Tsunami-Welle mit einer Höhe von vier Metern auf das Kraftwerk. Die Schutzmauern haben eine Höhe von 5,7 Meter, trotzdem werden die dahinter liegenden Meerwasserpumpen zerstört. Die noch folgenden Wellen erreichen Höhen von bis zu 15 Metern und »fluten« die Reaktoren. Sie stehen anschließend bis zu fünf Meter unter Wasser. Die Notstromversorgung bricht kurze Zeit später zusammen. Der Druck in den Reaktoren steigt. Die Anlieferung von Stromgeneratoren verzögert sich wegen des starken Verkehrs, sie stehen im Stau. Über viele Wochen werden die Reaktoren behelfsmäßig gekühlt.
Was hier auszugsweise und in kurzen Stichpunkten skizziert wurde, ist eine nukleare Katastrophe unfassbaren Ausmaßes. Eine der ersten Fragen, die nach dem Unglück gestellt wurde, wa...