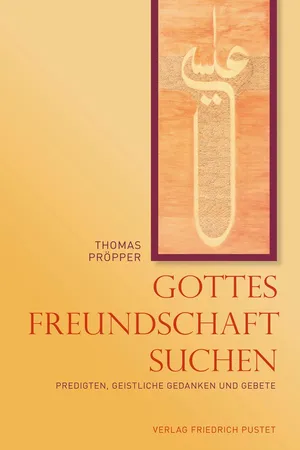
- 400 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Gottes Freundschaft - das ist eines der Schlüsselworte in Thomas Pröppers Denken. Er hat diesen Gedanken nicht nur in seiner theologischen Arbeit verfolgt, sondern auch zum Kern seiner Predigten gemacht, indem er "die so menschliche Sehnsucht nach Freundschaft, welche diesen Namen verdient, auch als die so menschliche Sehnsucht nach einem Gott, der dem Menschen Freund sein möge, ausgearbeitet hat" (Magnus Striet).
Über zehn Jahre predigte Thomas Pröpper in der Münsteraner Dominikanerkirche. Das, was ihn mehr als alles andere bewegte, war: das Evangelium glaubhaft ins Heute der Spätmoderne zu überSetzen. Dabei legte er nicht nur Wert auf die theologische Stringenz seiner Gedanken, sondern er feilte so lange an seinen Predigten, bis er, der Sohn eines Musikers, auch eine "stimmige Musikalität" des Textes erreicht hatte.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Gottes Freundschaft suchen von Thomas Pröpper im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theologie & Religion & Christliche Theologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Predigten, geistliche Gedanken und Gebete von Thomas Pröpper
Wir alle sind Geistliche
1 Kor 12,4–30
Was man gewöhnlich so Christsein, Glauben und Religion nennt, das ist für viele nur noch eine Wirklichkeit am Rand ihres Lebens – eine Anzahl traditioneller Meinungen, die man für den Notfall und für gewisse Rätsel des Daseins bereithält. Eine Reihe frommer Gewohnheiten, die irgendwie zu einem anständigen Menschen gehören und an bestimmten Stationen des Lebens immer noch zum Zweck der Verschönerung und Vertiefung in Anspruch genommen werden. Dass der Glaube eine Perspektive bedeutet, die bei wirklich relevanten Entscheidungen etwa ins Gewicht fällt, ein Geschenk sogar, durch das man sich bereichert und dann auch verpflichtet fühlt, das können nur noch wenige von sich behaupten. Und noch weniger, dass sie Verantwortung spürten für die Kirche, die ja eben dazu da ist, dass sie diesen Glauben gestaltet und ihn anderen bezeugt und vermittelt.
„Ich pflege“, so las ich einmal den Brief eines Mannes, der sich mit etwas Selbstironie, aber doch ganz offen und unverblümt darüber aussprach, „ich pflege meine Wohnung und meine geistige Inneneinrichtung etwas mit Religion zu parfümieren. So wie meine Frau ihre Abendgarderobe. Aber ein solcher Duft muss diskret sein, denn ich habe öfters die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sich zu viel mit religiösen Dingen abgeben und gar auf den Gedanken kommen, darüber zu reden und andere mit ihren diesbezüglichen Entdeckungen zu beglücken, in Gesellschaft sehr unangenehm auffallen können. Und weil dies etwas ist, was ich um jeden Preis vermeiden möchte, werde ich mich zu derartigen Peinlichkeiten erst gar nicht hinreißen lassen. Religion ist eine berufliche Angelegenheit des Klerus, ich jedenfalls werde mich hüten, klerikale Allüren anzunehmen.“
Trotz der vielbeschworenen und inzwischen auch schon wieder angestaubten Rede vom Erwachen der sogenannten Laien und ihrer Mitverantwortung für die Kirche: Für den Großteil von ihnen ist die Kirche nach wie vor nur eine Art Konsumgesellschaft, in der theologische Profis bei bestimmten Gelegenheiten ihre religiösen Bedürfnisse erfüllen. Die Mehrzahl der Gläubigen begnügt sich mit der Rolle, Adressat der sogenannten Seelsorge zu sein, die besonders Beauftragte an ihnen üben. Geistliche nennen wir diese Leute manchmal noch und haben uns daran gewöhnt, damit bloß die Amtsträger zu meinen. Eine Auffassung, die zu tief sitzt, als dass sie in wenigen Jahren überwunden werden könnte. Jahrhundertelang ist sie ja eingeübt worden.
Das begann damit, dass zu Anfang des 4. Jahrhunderts durch die Entscheidung des Kaisers Konstantin das Christentum die maßgebliche Religion im Römischen Reich wurde und sich nun das Heidentum bedrängt und verfolgt sah. Da wurde es auf einmal nützlich, Christ zu sein, und in die Kirche, die bis dahin eine Kirche der Bekenner und Märtyrer gewesen war, strömten die heidnischen Massen nur so herein. Natürlich gab es viel lasche und gedankenlose Mitläufer darunter, sodass nun diejenigen, die in alter und strenger Weise ihren Glauben bekennen und verwirklichen wollten, sich von den Lauen trennten und sich selbst die Geistlichen nannten. Sie meinten es ernst mit ihrem Versuch, im Geist Christi zu leben, und der Titel, den sie sich zulegten, gewann hohes Ansehen und einen anspruchsvollen Klang. Oft wurden diese Geistlichen Mönche und gingen aus den üppigen Städten in die Kargheit der Wüste.
In immer mehr Fällen aber übernahmen sie auch das Amt des Gemeindeleiters, des Bischofs und des Priesters. Und so kam es, dass man schließlich nur noch die Amtsträger Geistliche nannte. Für die Stabilität und Ordnung der Kirche, das muss man sehen, hatte es natürlich enorme Vorteile, wenn der Heilige Geist so ausdrücklich und fast ausschließlich an die Amtsträger gebunden war. Denn es gab von Anfang an auch Gruppen, die ebenfalls nach Vollkommenheit strebten, sich dabei aber von der übrigen Kirche absonderten und den Anspruch erhoben, allein im Besitz des Geistes zu sein. Es waren nicht die Schlechtesten, voller Leidenschaft für eine Reform der fett gewordenen Kirche und begeistert für das Ideal einer heiligen Kirche, nur eben hatten sie bei diesem Ziel vor allem sich selbst im Auge. Eine Heiligung der Kirche ohne die vielen. Und sie vergaßen dabei, dass die Kirche eben nicht nur für die Vollkommenen, sondern auch die Fußlahmen und Mittelmäßigen da ist.
Hätte es bei den Konflikten, die darüber entbrannten, nicht das kirchliche Amt gegeben, das entschied, dass alle zur Kirche gehören sollten, und damit festhielt an ihrer sichtbaren Einheit, dann wäre diese Kirche längst hoffnungslos in tausend Gruppen und Grüppchen zersplittert, vielleicht schon in der Gemeinde von Korinth oder zur Zeit Augustins oder im hohen Mittelalter und auch noch später. Dies sollte man sehen und einräumen, bevor man dann zu Recht den unerträglichen Klerikalismus verurteilt. Denn auf der anderen Seite ist ja ebenso wenig zu leugnen, zu welchen Einseitigkeiten, ja Verzerrungen diese Entwicklung geführt hat: dass der Kleriker nämlich immer mehr als der eigentliche Christ galt, im Bewusstsein vieler sogar mit der Aura des Heiligen umgeben, abgehoben und Abstand gebietend. Dass er faktisch immer mehr Aufgaben an sich zog, auch solche, die ihm eigentlich gar nicht zukamen, und damit die Aktivität der anderen erstickte. Dass er eine sublime, höchst zweideutige Macht über fast alle Lebensbereiche ausübte, über das Innere und die Gewissen der Menschen und über das Äußere vom privaten, intimsten Bereich bis hin zur Politik. Dass er vielfach als sakrosankt und unangreifbar galt und man ihm unbesehen abnahm, was er von sich gab, zumal er lange der Einzige war, der im Glauben gebildet oder überhaupt gebildet war. Schuldig an dieser Klerikalisierung der Kirche sind freilich beide Seiten zu nennen, weil sie beide sich mit dieser Verteilung ganz gut arrangierten.
Der Priester mit den Vorteilen seiner Würde, die ihn für die Verantwortung und spezifischen Entbehrungen seines Standes belohnten. Der Gläubige mit der religiösen Untertanenrolle, in der er nur die gebotenen Christenpflichten zu erfüllen hatte und dabei nicht weiter zu überlegen und zu entscheiden brauchte – im Zweifelsfalle waren ja die Priester da, die ihm Sicherheit gaben und ihm sagten, wo es langgeht. Aber diese Zeiten, so heißt es seit langem, die sind ja nun endgültig vorbei. Die neuzeitliche Bewegung zur Mündigkeit habe schließlich, wenn auch mit der üblichen Verspätung, die Kirche erreicht und zum Selbstbewusstsein der Laien geführt. Oft genug waren es zwar wiederum nur die Priester, welche die Laien aktiv machen mussten, aber das war nicht überall so. Vor allem: Was sich an neuem Leben in den Kirchen Süd- und Westeuropas, Lateinamerikas und anderswo regte, gab neuen Mut, an das Wirken des Geistes in der Kirche zu glauben.
Bei uns in Deutschland sind freilich die vielfach abgesicherten Strukturen so fest, dass neues Leben nur zähflüssig in Gang kam. Nach dem Konzil war zwar auch hierzulande viel von pfingstlicher Erneuerung die Rede, es gab die Hoffnung stiftende Würzburger Synode. Aber die folgenden Jahre machten mit Ernüchterung deutlich, wie stark Amtsträger und Gemeinden an ihrer überkommenen Rolle hängen und sich eher von Vorsicht als von Zuversicht leiten lassen. Nicht wenige erwecken den Eindruck, dass ihnen der Status quo durchaus recht ist und dass sie vor allem seine Konsolidierung anstreben. Die restriktiven Tendenzen der kirchlichen Großwetterlage – nicht wenige auch unter den Laien begrüßen sie – fordern sie sogar. Andere dagegen leiden darunter, und viele, die sich als Mitarbeiter auf zahlreichen Feldern schon engagiert hatten, haben sich inzwischen wieder zurückgezogen, sehr oft resigniert, manchmal auch bitter.
Sicher hat ihnen zuweilen der lange Atem gefehlt, die nötige Geduld für einen realistischen Umgang mit einer so traditionsreichen Institution wie eben der Kirche. Und doch hatten sie nicht ganz unrecht, wenn sie sich in ihrem guten Willen oft ausgenützt fühlten, weil sie immer nur die Lücken stopfen und die Aufgaben erfüllen sollten, welche die Priester auch bei größtem Einsatz allein nicht mehr schafften. Ohne dass sie zugleich die Anerkennung und die Rechte erhielten, die mit solchen Aufgaben nun einmal verbunden sein müssen. Viele, die sich eingesetzt haben, sind enttäuscht, dass sie nicht wirklich mitreden dürfen und die wichtigen Entscheidungen ohne sie fallen. Lang ist die Liste derjenigen, die Theologie studiert haben, vergeblich auf eine kirchliche Beauftragung warten und sich nun unerwünscht fühlen. Und die Frauen sind zwar wie immer willkommen, wenn sie in der Caritas oder anderswo helfen, in zentralen Bereichen des kirchlichen Lebens jedoch müssen sie wie eh und je schweigen.
Es ist bedrückend, in welchem Maß die Kirche gerade ihre kritischen Geister verliert. Nicht etwa nur die nörgelnd Distanzierten, sondern eben auch die, die solidarisch zu ihr gehören wollten. Die lang schon schwelende Krise schwelt weiter, und wenn die Befürchtungen, zu denen sie Anlass gibt, nicht eintreffen sollen, dann müssen sich alle besinnen. Die sogenannten Laien, damit sie ihr kirchliches Selbstbewusstsein finden, es authentisch wahrnehmen und sich nicht entmutigen lassen. Und die Amtsträger, damit sie die gegebene Situation ernst nehmen, den tiefsitzenden, oft nur freundlich kaschierten Klerikalismus in sich selbst überwinden und erneut suchen und dann auch anerkennen, was der Geist heute wirkt und wirken will. Zugleich müssen beide Seiten das Umgehen immer neu miteinander lernen. Passagen aus dem ersten Korintherbrief könnten uns dafür, meine ich, ein paar Hinweise geben.
Erstens erfahren wir da: Wir alle sind Geistliche. Denn alle haben wir den Geist Christi empfangen, und zwar ursprünglich durch Christus selbst, den Herrn der Kirche. Und jeder hat ihn empfangen auf seine besondere Weise. Die muss er entdecken und dann persönlich realisieren. Wir müssen endlich von der Vorstellung abkommen, als sei der Christ ein Mensch, den man schon von weitem erkennt. Ewig fades Abziehbild, immer der gleiche Typ. Als bestehe unser Christsein darin, durch einen feststehenden Katalog gehalten zu sein, bestimmte Dinge zu tun und andere eben lassen zu müssen. Nein, die eigentliche Aufgabe besteht darin, dass wir herausbekommen, jeder für sich, was er positiv an seiner Stelle zu tun hat, was kein anderer für ihn tun kann und was gerade seine Begabung ausmacht. Dass wir aufhören, uns gängeln zu lassen und auf Anleitung zu warten, sondern selbst hinsehen, urteilen und dann handeln. Also Initiativen entwickeln und zur eigenen Verantwortung stehen. Dazu braucht es nicht die Erlaubnis von oben. Dazu braucht es allein den eigenen Entschluss.
Zweitens ist ein Missverständnis zu beseitigen, was die Geistesgaben selber angeht. Als könnte es sich dabei nur um sensationelle Dinge handeln, die sofort in die Augen springen. Ekstatisch reden, prophezeien, Heilungen bewirken, davon spricht Paulus oft. Das scheint in den ersten Gemeinden häufig gewesen zu sein. Aber er spricht auch von den gewöhnlichen Gaben, die mindestens ebenso notwendig sind. Von der Aufgabe zu lehren, zu raten, zu erziehen, von Pflege- und Krankendiensten, Verwaltungsarbeit, technischer Arbeit. Alles, so kann man sagen, was anderen tatsächlich hilft und aus der Bereitschaft des Glaubens geschieht, ist Gabe und Auftrag des Geistes. Also kann auch das gewöhnlichste Leben sein Wirken bezeugen. Durch unbeachtete Treue zu übernommenen Pflichten, alltägliche Wahrhaftigkeit, Großzügigkeit, unaufdringliche Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit trotz eigener Überarbeitung, Eintreten für Schwächere, für Fremde, Bemühen um Verständigung unter Zerstrittenen, taktvolle Zurechtweisung, Begleitung von Niedergedrückten, Aufmerksamkeit für verschwiegene Not. Das schließt auch heute hervorstechende Gnadengaben nicht aus. Weitschauende Initiative, eindrucksvolle Rede, exemplarisches Engagement, couragierter Protest gegen Unrecht und Lüge, beispielhafte Heiligkeit. Jeder muss sehen, was er tun kann, aber er muss es auch tun. Von der Größe der Gnadengabe hängt der Wert nicht ab. Über ihn entscheidet allein, wie der Einzelne sie verwirklicht, ob es nämlich in Liebe geschieht.
Damit ist nun drittens der Maßstab genannt. Grundsätzlich kann alles Gnadengabe sein, aber Paulus wird nicht müde einzuschärfen, die schönsten und großartigsten Begabungen nützten nichts, wenn sie nicht eingesetzt werden. Geben für andere, in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit. Denn niemand hat den Geist Christi für sich selbst empfangen, und auch die Gemeinde ist nicht nur um ihrer selbst willen da. Im Grunde gibt es nur eine Gabe des Geistes, die Liebe, die, etwas altmodisch ausgedrückt, zum Dienen bereit macht, konkreter: die uns die dauernde Besorgnis um uns selbst vergessen und auf andere uns einstellen lässt. Und dann die Energie zum Entschluss und zur realen Tat gibt. Zu einem Handeln, in dem ich selbst als ich selbst dabei bin und den anderen als ihn selbst meine.
Viertens wird die richtige Physiognomie der Kirche erkennbar, sie soll eben nicht ein Mammutgebilde aus lauter Schablonen sein, eine Herde von Schafen, die den Mund nur noch zum Amen aufmachen, vielmehr denkt sie sich Paulus als eine Gemeinschaft ganz unterschiedlicher Menschen, die alle ihr Besonderes zu tun haben, ohne deshalb schon zu meinen, etwas Besonderes zu sein. Die es nicht nötig haben, sich über den anderen zu erheben, an ihm sich zu stoßen, ihn zu beneiden oder gar zu verketzern. Die nicht bloß tolerant sind, sondern sich anerkennen können und freuen über das, was ein anderer einbringt und ihm gelingt. Über die zuverlässige Mitarbeit des einen ebenso wie die freimütige Kritik des anderen, auch wenn sie wehtut. Es ist immer ein Zeichen von Schwäche, wenn die Kirche und die Gemeinden damit beginnen, einen Kritiker ins Abseits zu drängen und die Sache dann eskalieren zu lassen, statt zunächst einmal auf seine berechtigte Sache zu achten. Nur in der Lebendigkeit ihrer Glieder gibt es die Kirche des Geistes. Und nur so kann sie ihren Aufgaben treu sein, die sie über sich noch hinausführen. Dabei ist auf die Bedeutung des Amtes keineswegs zu verzichten. Es ist ja ebenfalls eine besondere Gabe, eben die der Leitung. Und es gehört zu diesem Dienst, dass er in Beauftragung und mit Vollmacht geschieht. Damit sage ich nicht, dass über seine Gestaltung und Bedingungen, auch über seine Auffächerung nicht diskutiert werden könnte und müsste. Was sich geschichtlich herausgebildet hat, bleibt auch geschichtlich veränderbar. Aber wie auch immer in Zukunft das Leitungsamt aussehen mag, es steht unter dem Gesetz der Liebe wie alle anderen. Ohne sich einzubilden, er habe die Wahrheit gepachtet und sei Fachmann für alles, hat der Amtsträger die Aufgabe, zusammenzuführen, auszugleichen, zuzuhören, anzuregen, zu ermutigen und zu verbinden und so der Einheit zu dienen.
Das Bild von der Kirche als dem einen Leib, dessen Haupt Christus ist und dessen verschiedene Glieder durch den Geist lebendig gemacht und zusammengehalten werden, das ist schon sehr alt und vielleicht auch ein bisschen erbaulich. Wie weit es für die Kirche der Zukunft noch als Modell gelten kann, wäre im Einzelnen genau zu erörtern. Ein Missverständnis wäre jedenfalls die Deutung, als sei jedem seine Stelle von Natur aus schon bestimmt und damit ein für alle Mal festgelegt. Und noch auf einen weiteren Punkt wäre zu achten: Ein Leib, solange er gesund ist, funktioniert ja sozusagen von selber. In der Gemeinschaft jedoch geht nichts ohne die Freiheit. Erst wenn jeder Einzelne erkennt, was er den anderen verdankt, und gleichzeitig einsieht und konsequent danach handelt, dass die anderen auch ihn brauchen, erst dann kann Leben in die Kirche einziehen. Karl Rahner hat in seinem Alter öfter von einer winterlichen Kirche gesprochen, und manchmal überkommt mich der Eindruck, als befänden wir uns jetzt mittendrin. Ob und wann wieder ein neuer Frühling anbrechen wird – wer kann das sagen? Er wird sich weder von oben dekretieren lassen noch etwa kann eine Predigt wie diese ihn herbeireden. Sie kann allenfalls eine Aufforderung an jeden Einzelnen sein, auf das Drängen des Geistes in sich selber zu achten.
Die Seligpreisung der Armen und Weinenden
Lk 6,17.20–26
Die Worte, die wir eben im Evangelium gehört haben, sind uns von Kindheit an vertraut. Sie gehören zur Mitte der Verkündigung Jesu, überliefert von Matthäus und Lukas. Seligpreisungen gab es allerdings auch sonst in der antiken Literatur. Da werden Menschen glücklich gepriesen, denen eine tugendsame Frau, wohlgeratene Kinder, Erfolg und ein günstiges Geschick beschieden sind. Oder auch Verstorbene, die ihren Weg glücklich und angesehen vollendet haben. Der Unterschied zur Verkündigung Jesu springt sofort in die Augen, wenn wir auf die Angeredeten achten.
Die erste Seligpreisung nennt sie, und sie schließt alle Folgenden mit ein. „Wohl euch, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.“ Die Armen und Niedrigen sind es, ganz wörtlich verstanden, diejenigen also, die von der Welt nichts zu erwarten haben und deshalb vielleicht noch am ehesten bereit sind, etwas von Gott zu erwarten. Menschen jedenfalls, die entweder durch ihr Schicksal an den Rand gedrängt wurden oder sich auch ganz bewusst mit ihrer Hoffnung auf das Kommen der neuen Welt richten. Ebenso die Weinenden, für die niemand einen Trost hat. Die Hungernden, die Not und Benachteiligung erfahren und Unrecht, das Menschen nicht wiedergutmachen und vielleicht nicht einmal wiedergutmachen können – hungernd nach Brot und menschenwürdigem Leben und nach einer Gerechtigkeit, von der niemand mehr ausgeschlossen ist.
Matthäus nennt außerdem die Demütigen, denen man jede Achtung versagt oder die auch freiwillig kein weltliches Ansehen suchen. Die Aufrichtigen reinen Herzens, die sich auf die Verschlagenheit der Erfolgreichen nicht verstehen und deren raffinierte Spiele nicht mitmachen wollen, aber auch die Barmherzigen, die um ihr eigenes Recht nicht besorgt sind und das Nächstliegende tun: ihr Herz dem anderen öffnen. Dann die Friedensstifter, die den Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt, von Hass, Verwundung und Rache durchbrechen und mit der Versöhnung anfangen. Und endlich bei Lukas und Matthäus die Verfolgten, die so unbeirrt waren in ihrer Zugehörigkeit ...
Inhaltsverzeichnis
- Buchinfo
- Haupttitel
- Impressum
- Vorwort
- Zum Geleit
- Predigten, geistliche Gedanken und Gebete von Thomas Pröpper
- Autor und Herausgeber
- Anmerkungen