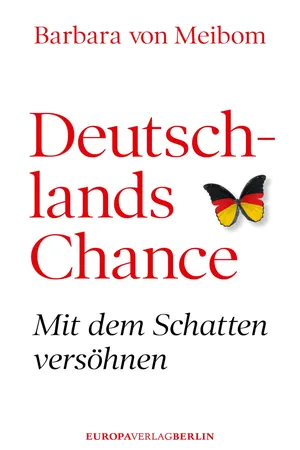
- 336 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Angesichts der europäischen Finanzkrise ist es unübersehbar geworden: Deutschland nimmt aufgrund seiner ökonomischen Potenz eine entscheidende Rolle in Europa und in der Welt ein. Doch die eigene Macht wird eher als eine wenig erwünschte Herausforderung gesehen. Wir sind gefangen zwischen der faktisch ausgeübten Macht und einer Neigung, die damit verbundene Verantwortung abzulehnen und uns nicht mit unserem eigenen Verhältnis zu Macht und Ohnmacht auseinanderzusetzen. Dies hat historische Wurzeln. Heute geht es darum, ein neues Verhältnis zur eigenen Macht zu gewinnen; als Individuen und als Kollektiv. Dies kann gelingen, wenn wir uns mit dem eigenen Schatten versöhnen und eine Haltung des 'servant leadership' entwickeln.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Deutschlands Chance von Barbara von Meibom im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Geschichte & Theorie der Politik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
eBook-ISBN:
9783944305165MIT DEM SCHATTEN VERSÖHNEN
Zur eigenen Macht und
Größe stehen?
»Macht ohne Liebe macht grausam.« Laotse
Macht macht Angst
Angela Merkel hat es noch unterstrichen: An Deutschland können weder die europäischen Nachbarn noch die Verbündeten jenseits des Atlantik, noch die aufstrebenden Nationen des Ostens vorbeigehen. Selbst wenn dieses Land militärisch bestenfalls in einer mittleren Liga spielt (sieht man von den Rüstungsexporten ab), ist es aufgrund seiner ökonomischen Potenz zu einer Bedeutung gelangt, die seine Partnerländer sicherlich nicht gewollt haben, als sie in die Wiedervereinigung einwilligten. Schwieriger noch: Unser Land erlebt das, was jetzt geschieht, eher als eine wenig erwünschte Herausforderung. »Zaudernde Führungsmacht«, überschrieb der Tagesspiegel einen entsprechenden Kommentar.3 Für dieses Zögern gibt es gute Gründe, außen wie innen. Von außen wird jeder deutsche Großmachtanspruch mit Recht kritisch beäugt, wachsam registriert und möglichst umgehend angeprangert. Die Herrscherattitüde der nationalsozialistischen Führungselite hat sich so tief in das kollektive Gedächtnis unserer Nachbarn eingebrannt, dass selbst kleinste Anlässe die alten Wunden wieder aufreißen und die entsprechenden Erinnerungen reaktivieren. Ein Land, das einst eine Schneise der Vernichtung, Unterdrückung und Ausbeutung in Europa geschlagen hat, darf – so das gemeinsame Credo aller, die je davon betroffen waren – nie wieder Macht über andere gewinnen. »Wehret den Anfängen« lautet daher die Parole. Wann immer ein Dominanz- oder Herrschaftsanspruch aufblitzt, reagiert die öffentliche Meinung in den betreffenden Ländern mit einer Referenz auf Nazi-Deutschland.
Doch auch im Inneren gibt es tief verwurzelte Gründe, warum Deutschland und die Deutschen eine führende Rolle in Europa und in der Welt vermeiden oder ablehnen. Wie gesagt: Macht macht Angst, insbesondere, wenn man sie einmal missbraucht hat und sich dies eingestehen muss. Die politische Klasse in Deutschland hat sich den Missbrauch eingestanden. Seit den 1970er-Jahren hat sie eine Erinnerungskultur geschaffen, die in der Welt einzigartig ist. Ihre Botschaft – wir haben gefehlt, und das vergessen wir nicht – ist in der politischen Kultur unseres Landes verankert. Eine solche Erinnerungskultur ist viel wert, sehr viel sogar, gerade wenn man die Situation mit anderen Ländern vergleicht, in denen ebenfalls gravierende Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. Eine Erinnerungskultur setzt Zeichen. Sie ruft auf Ähnliches, wie in der Vergangenheit geschehen, niemals wieder zuzulassen. Doch sie ist noch in der Abwehr gefangen. Ihr Impetus richtet sich gegen das Unmenschliche. Es ist keine Bewegung hin zu dem, wofür die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit befreien sollte. Erinnerungskultur bewahrt vor Vergessen. Doch sie befreit noch nicht zur Verantwortung in Freiheit. Stattdessen überwiegt die Furcht, erneut Macht zu missbrauchen.
Die Gefahr, die mit solcher Furcht vor Größe einhergeht: Sie liefert die Legitimation, die eigene Macht zu leugnen, zu verkleinern oder herunterzuspielen. Man nimmt für sich das Recht in Anspruch, sich um sich selbst zu drehen, und übersieht dabei die Wirkung des eigenen Tuns auf andere. So rückt auch die Wirkung, die Deutschland als ökonomische Großmacht und stärkste Macht in Europa für das Wohlergehen der Menschen in der Europäischen Union und weit darüber hinaus besitzt, nicht wirklich ins öffentliche Bewusstsein. Der Boden wird bereitet für eine neue Art des Hochmuts und des Sich-über-andere-Erhebens. In diesem Sinne warnte Altbundeskanzler Helmut Schmidt in der Finanzkrise vor einem »nationalegoistischen Versagen« und einem zu starken Selbstbewusstsein des wirtschaftlich starken Deutschland.4 Und der Journalist Harald Schumann kritisiert im Tagesspiegel den deutschen Irrweg in der Eurokrise, indem er fachkundig Angela Merkel und Wolfgang Schäuble einen »Wirtschaftsnationalismus« wie zu Vorkriegszeiten vorwirft – mit verheerenden Folgen für andere Staaten in Europa5. Die Herrscherattitüde kehrt als belehrender Zeigefinger zurück, der anderen zeigen will, wie sie sich zu verhalten haben.
Was fehlt, ist eine aufgeklärte Selbstermächtigung, die nach angemessenen Antworten sucht auf die faktisch ausgeübte Macht. Der Gebrauch der eigenen Macht bleibt tendenziell unbewusst und blind. Macht – eine unverzichtbare Größe in der Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und des Zusammenlebens – verliert damit an Möglichkeiten, dem Leben in einer gefährdeten Gegenwart nach innen wie nach außen zu dienen. Die Chance Deutschlands, mit seiner Macht einen wichtigen, in manchen Bereichen entscheidenden Beitrag zu leisten, um die Menschheit aus einer selbst geschaffenen Gefährdung herauszuführen, wird nicht voll genutzt, weil die Heilung im Inneren nicht vollzogen wurde.
Noch eine weitere Gruppe von Menschen in Deutschland zeigt, wie wichtig es für uns Deutsche ist, sich dem schwierigen kollektiven Vermächtnis im Umgang mit Macht zu stellen: Es sind die Neonazis, deren Anzahl in erschreckender Weise zunimmt und deren Einfluss in einzelnen östlichen Gebieten Deutschlands (aber keineswegs nur dort) unübersehbar geworden ist. Diese Tatsache ist erst nach dem Auffliegen der Zwickauer Terrorzelle allmählich im öffentlichen Bewusstsein angekommen.6 Diese Unverbesserlichen und Unbelehrbaren setzen eine unheilvolle Tradition fort, die bereits einen wichtigen Nährboden für den Nationalsozialismus bildete: das Gefühl, zu kurz zu kommen, missachtet zu sein, die eigene Würde nicht respektiert zu finden. Statt sich solche Minderwertigkeitsgefühle, die besonders in den ostdeutschen Bundesländern einen relevanten gesellschaftlichen Boden finden, einzugestehen, statt sich den eigenen Ohnmachtsgefühlen zu stellen, wird mit aller Vehemenz der Griff nach der Macht gesucht. Die Opferdynamik verwandelt sich in eine Täterdynamik, die sich der Großmachtsparolen aller Art bedient und mit Wut und Aggression die eigenen Forderungen durchsetzen will, um das reduzierte Selbstwertgefühl zu kompensieren. Größenwahn, der aus einem reduzierten Selbstwertgefühl gespeist wird, wird national aufgeladen und in altbekannte Ansprüche auf Herrschaft und Gefolgschaft übersetzt, von denen sich die Aufgeklärten im Lande mit Grausen abwenden.
Ob wir es also wollen oder nicht, es gibt gute Gründe, sich kollektiv und individuell dem eigenen Verhältnis zur Macht zu stellen – sei es, um unsere Aufgabe in der Welt angemessener wahrnehmen zu können, sei es, um im Inneren Schlimmes zu verhindern. Eine solche Aufgabe enthält eine Aufforderung, sich mit dem Unbewussten auseinanderzusetzen, sowohl mit dem biografischen als auch mit dem kollektiven Unbewussten.
Der Schatten wird sichtbar:
Sechs Momentaufnahmen
Es ist das Jahr 1992. Die Sommerolympiade wird feierlich eröffnet. Spannung und Begeisterung liegen in der Luft. Schüler und Schülerinnen des United World College in Swasiland/Afrika verfolgen am Fernseher den Einmarsch der Nationen. Aus rund fünfzig Ländern stammen die Jugendlichen, die an diesem College studieren. Sie alle finden sich in dem Eröffnungsspektakel wieder und jubeln ihren Landsleuten begeistert zu. Nur einmal breitet sich betretene Stille im Raum aus. Es ist, als die deutschen Athleten und Athletinnen das Stadion betreten.
Wir haben das Jahr 2006. »Die Welt zu Gast bei Freunden« lautet der Slogan der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Welt lernt ein neues Gesicht von Deutschland kennen: Die Menschen feiern ausgelassen, schwingen deutsche Fahnen, hängen sie aus den Fenstern, fahren sie im Auto spazieren, kleiden, tätowieren und schminken sich ungehemmt in Schwarz-Rot-Gold und geben ihrer Freude überschwänglich während des Public Viewing Ausdruck. Die Deutschen sind Gastgeber, die verlieren können, sich mit den Siegern freuen und die Welt mit ihrer strahlenden Fröhlichkeit begeistern. Ein »Sommermärchen« beglückt Gastgeber und Gäste.
November des Jahres 2011. Im sächsischen Zwickau geht ein Haus in Flammen auf. Nach kurzer Zeit wird bekannt, dass eine rechtsextremistische Gruppierung, die sogenannte Zwickauer Terrorzelle, auch »Nationalsozialistischer Untergrund – NSU« genannt, dort ihr Zentrum hatte. Zwei der drei Mitglieder sind tot, die dritte, Beate Zschäpe, wird verhaftet. Nach und nach kommt heraus, dass die Gruppe im Laufe der letzten Jahre, von Polizei und Verfassungsschutz unbemerkt, eine Mordserie begangen hat, deren Opfer vor allem Menschen mit Migrationshintergrund (vorwiegend türkisch-islamisch) waren. Mit nationalem, nationalsozialistischem Gestus wird das Deutschtum verherrlicht und Legitimität für das Töten von ausländischen Bürgern beansprucht.7 In den nachfolgenden Wochen und Monaten werden immer mehr Einzelheiten bekannt, die zeigen, dass sich die NSU auf ein Netz von Sympathisanten stützen konnte, bei dem zu vermuten ist, dass es bis in den Verfassungsschutz hineinragte. Immer deutlicher wird, dass unser Land das Wiedererstarken rechtsextremistischen Gedankenguts in einer Weise übersehen hat, die unser Zusammenleben und die demokratische Substanz gefährdet.
Es ist das Jahr 2012. Die Euro-Krise greift um sich. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel beherrscht die europäische Bühne mit einem Sparkurs und einer Fiskalpolitik nach deutschem Beispiel. Vor diesem Hintergrund werden Griechenland strenge Maßnahmen diktiert, die vor allem die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen treffen. Eine Erholung der griechischen Ökonomie ist jedoch nicht in Sicht. Es fehlen die entsprechenden Infrastrukturen und industriellen Produktionsmittel, um aus der Krise herauszukommen. Während die kleinen Leute in Griechenland ausbluten, zieht man an deutschen Stammtischen mit erhobenem Zeigefinger über die griechischen Nachbarn her. Deutsche, deren Land mehr als jedes andere europäische Land von der Eurozone profitiert hat, fühlen sich ausgenutzt. In Griechenland gehen die Menschen in wütenden Protesten auf die Straße; die deutsche Kanzlerin wird als Diktatorin mit Nazisymbolen gezeigt. Man fühlt sich in der nationalen Würde verletzt, und Deutschen schlägt in Griechenland alles entgegen – von Ablehnung bis hin zu Hass.
Im März 2013. Das ZDF strahlt eine dreiteilige Sendereihe mit dem Titel »Unsere Mütter, unsere Väter« aus. Sie zeigt die Lebensrealität von fünf jungen Erwachsenen unter dem Nationalsozialismus, einer von ihnen jüdischer Herkunft. Jeder verstrickt sich in Schuld, wird Täter und Opfer. Die Überlebenden enden unter der Last des Gewissens und des Erfahrenen im Schweigen. Die Einschaltquoten für die Sendereihe sind exorbitant, sie steigen am dritten Abend auf annähernd 25 Prozent oder 7,63 Millionen.8 Die Nation diskutiert, die Feuilletons sind voll davon. Es bewegt sich etwas in Deutschland. Tabuisierte Schichten des Bewusstseins brechen erneut auf. Es wird geredet.
Wir haben April 2013. Der erfolgreiche US-amerikanische Investor George Soros hält im Center for Financial Studies der Goethe-Universität in Frankfurt am Main einen Vortrag, in dem er in eindringlichen Worten Deutschland den Spiegel vorhält. Kanzlerin Merkel verfolge eine Fiskalpolitik, die nicht nur in Ländern wie Griechenland und Italien politische Verwerfungen hervorrufe, sondern Menschen ins Elend treibe und den Zusammenhalt des großartigen Friedensprojekts der Europäischen Union mit unabsehbaren Folgen gefährde. Ob Deutschland dies wolle oder nicht, es sitze am Lenker und müsse seine Verantwortung wahrnehmen. Eine Lösung der Krise hänge davon ab, dass Deutschland seine Haltung grundlegend korrigiere.9
Wo stehen wir heute in Deutschland, fast siebzig Jahre, nachdem die Alliierten den Zusammenbruch des »Tausendjährigen Reiches« besiegelten? Wie ist es um die Schattenkräfte im individuellen und kollektiven Unbewussten bestellt? Wie bereit sind wir, als Menschen in Deutschland individuell und als Deutschland in Europa und in der Welt, verantwortlich mit unserer Macht umzugehen?
Der kollektive Schatten
Bereits in den 1960er-Jahren hielten Alexander und Margarete Mitscherlich der deutschen Öffentlichkeit einen beeindruckend klaren Spiegel vor: Sie konstatierten eine Gesellschaft, deren Mitglieder unfähig sind zu trauern (Mitscherlich/Mitscherlich 2007). Statt sich den Geschehnissen, die in das »Tausendjährige Reich« geführt und dessen Vernichtungsmaschinerie in Gang gehalten hatten, zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und über das Schuldhafte ebenso zu trauern wie über das Erlittene, reagierten die Menschen in unserem Land überwiegend mit Verdrängung, Abspaltung, Projektionen und Leugnung. In diesem Sinne beklagten die beiden Psychoanalytiker die Lethargie und Dumpfheit, mit der die bundesrepublikanische Bevölkerung auf existenzielle Herausforderungen reagierte, sowie die Unfähigkeit, Mitgefühl zu entwickeln und das Geschenk der Demokratie libidinös zu besetzen und zu verteidigen.
Zu den gleichen Erkenntnissen kommt die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan in ihrer beeindruckenden Studie zu Politik und Schuld. Die zerstörerische Macht des Schweigens (Schwan 1997). Mit Bezug auf die Auschwitzprozesse der 1960er-Jahre, in denen die Frage der Verantwortlichkeit erstmals breite öffentliche Aufmerksamkeit erhielt, ohne dass daraus die erlösende Katharsis eines Eintritts in die Verantwortung und damit ein versöhnender Bewusstseinswandel erwuchs, stellt sie fest, dass es eher zu einem »Bekräftigen des Beschweigens« gekommen sei, »weil nicht deutlich erklärt wurde, dass die Würde der Menschen ohne individuelle Verantwortlichkeit nicht gesichert werden kann«.10
Heute, rund ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen der Studie von Alexander und Margarete Mitscherlich und rund fünfzehn Jahre nach Gesine Schwans Werk, wächst das Bewusstsein, dass die Nachwirkungen dieser Prozesse bis in die Gegenwart reichen. Inzwischen mehren sich Untersuchungen über die erste, zweite und dritte Generation der Kinder von Tätern und Opfern, 11 interessanterweise inzwischen auch von Menschen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind (Hacker et al. [Hg.] 2012).12 Wer tiefenpsychologisch arbeitet, kann sich der Einsicht nicht verschließen, dass die Lebensgeschichten vieler Klienten auch heute noch Ausdruck einer seelischen Entwicklung sind, die ihren Ursprung in Kriegserlebnissen, in nicht aufgearbeiteten Konflikten sowie in Schuld- und Schamkomplexen der Eltern- und Großelterngeneration haben, welche diese an die nachfolgenden Generationen weitergaben. Die Aufgabe der Heilung und Transformation bleibt also bestehen.
Der Gang durch den Schatten
Menschliches Leben ist ein Weg zur Erweiterung des Bewusstseins. Wir werden geboren, bringen Gaben und Potenziale mit, machen Erfahrungen, entwickeln Konzepte und Wünsche und erfahren bald, dass wir an unsere eigenen Grenzen und die von anderen stoßen. Wie gehen wir damit um? Rebellieren wir, begehren wir auf, stellen uns tot, passen uns an, verbiegen das eigene Rückgrat, verharren im Blick auf uns selbst und unsere Bedürfnisse, entwickeln Gefühle wie Zorn, Aggression, gar Rache oder Hass? Oder wählen wir einen anderen Weg? Wählen wir den Weg, die eigenen Gaben gegen alle Widerstände zu leben, eigene Fehler und Unzulänglichkeiten zu erkennen, die eigenen Interessen gegen die der anderen abzuwägen, die eigenen Wahrnehmungen vor dem Hintergrund der Wahrnehmung von anderen zu überprüfen, die eigenen Konzepte und Glaubensvorstellungen infrage zu stellen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie wir unsere Gaben zum eigenen Wohlergehen und dem von anderen einsetzen und nutzbar machen können? Solche Fragen stellen sich nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für Organisationen und Kollektive.
An der Haltung, die wir uns selbst und anderen gegenüber individuell und kollektiv entwickeln, entscheidet sich, ob wir als Individuum, Organisation oder Nation egoistisch und egozentrisch unser »eigenes Ding« machen wollen oder ob wir zu einem friedlichen Miteinander von Menschen, Organisationen, Völkern, Nationen beitragen.
Mit der Entwicklung von Bewusstsein haben sich nicht nur P...
Inhaltsverzeichnis
- Umschlag
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Zu diesem Buch
- Teil 1 MIT DEM SCHATTEN VERSÖHNEN
- Teil 2 DEM LEBEN DIENEN
- Teil 3 ZUKUNFT GESTALTEN
- Danksagung
- Literatur
- Fußnoten