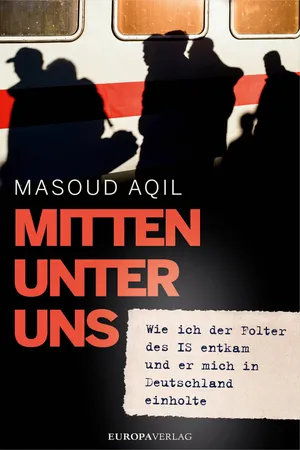![]()
TEIL I
Irgendwo westlich von Al-Raqqa wurde der Bus langsamer. Keiner der Mitfahrenden erwartete etwas Außergewöhnliches, wir hatten mehrmals an Checkpoints des Regimes angehalten, seit wir am frühen Abend in Aleppo aufgebrochen waren. Ich war müde und hatte versucht zu schlafen, aber meine Gedanken waren Karussell gefahren, während draußen das Dunkel der Nacht vorbeizog: die vergangenen Wochen in Aleppo, die vielen Toten, die Bomben, die mir zwar nicht mein Leben, aber meine Zukunft genommen hatten. Wie sollte es weitergehen? Ich blickte auf die Uhr. Es würde noch Stunden dauern, bis der Bus meine Heimatstadt Qamishlo erreichte.
Durch das Fenster sah ich in der Ferne ein Lichtsignal. Das musste der nächste Kontrollpunkt sein. Es war immer dieselbe Prozedur: Ein Soldat steigt ein, die Passagiere ziehen ihre Ausweise aus Taschen und Rucksäcken, drücken sie in eine fordernde Hand und hoffen, dass der Bewaffnete, zu dem sie gehört, nichts zu beanstanden hat.
Selbstverständlich bremste der Fahrer auch dieses Mal. Hielte er nicht, würden sie uns beschießen. Vor dem Bus baute sich ein Mann auf, den grellen Strahl einer Taschenlampe direkt auf das Gesicht des Fahrers gerichtet: die Aufforderung, die Tür zu öffnen. Ein dicker, großer Kerl mit Bart stieg ein und verlangte in barschem Ton unsere Ausweise. Sein Dialekt ließ auf eine Herkunft aus Al-Raqqa schließen wie auch die dunkle Haut, die in dieser Gegend typisch war. Er trug schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine Weste mit mehreren Reihen Patronen. In seinem Gürtel steckte eine Pistole, über Schulter und Rücken hing eine AK-47, eine Kalaschnikow. Er wirkte sehr nervös.
Während er sich Reihe für Reihe durch den Bus schob, konnte ich draußen zwei Pick-ups erkennen, auf denen Männer mit Gewehren standen. An einem der Wagen hing eine schwarze Fahne mit weißen Schriftzeichen: »Es gibt keinen Gott außer Allah, und Mohamed ist sein Prophet.« Darunter stand der Name der Gruppe: Al-Nusra-Front, damals der syrische Ableger von Al-Qaida. Das war kein normaler Kontrollpunkt. Zum ersten Mal in meinem Leben begegnete ich Dschihadisten von Angesicht zu Angesicht.
Als der Bärtige neben mir stand und meinen Ausweis studierte, roch ich Schweiß, Staub und Metall. Ich ahnte, dass es nicht lange dauern würde, bis er feststellte, woher ich stamme. Qamishlo liegt im Nordosten Syriens, im Gouvernement Al-Hasaka nahe der türkischen Grenze. Kurdengebiet. Dennoch erstarrte ich, als er wütend ausrief: »Ihr Ungläubigen! Al-Nusra wird eure Stadt angreifen und besetzen. Und dann werden wir euch alle töten.«
Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich, wie sich Panik anfühlt. Wenn er sich weiter in Rage redet, wird er mich aus dem Bus zerren und mich erschießen, dachte ich. Und niemand im Bus wird einen Finger rühren, um ihn daran zu hindern.
![]()
1. Syrien zerfällt
Noch nie hatte in meiner Gegenwart ein Mensch lauthals verkündet, er werde mich und meinesgleichen enthaupten. Meinesgleichen: Kurden, die dieser große, schwitzende Dicke mit der Kalaschnikow als »Ungläubige« bezeichnete. Es stimmt, die meisten Kurden ziehen ihr Selbstverständnis nicht aus der Zugehörigkeit zu einer Religion, sondern eher aus ihrer Zugehörigkeit zu einer Ethnie. Viele legen gar keinen Wert auf Religion, weil sie in einer Atmosphäre des Religiösen leben müssen, die sie verabscheuen. Mein Vater ist Atheist, ich bin Atheist, viele Kurden sind Atheisten. Es gibt keine radikalen Dschihadisten unter uns, und wenn jemand gläubig ist, heißt das nicht, dass er den Fundamentalisten anhängt, die den einen, rechten Glauben predigen und daraus die Legitimation ziehen, alle anderen, alle »Fehlgeleiteten«, ermorden zu dürfen.
Was wir Kurden brauchen, ist nicht eine Religion, sondern ein Stück Land. Tausende Jahre haben die Kurden auf ihrem Land gelebt, zahlreichen Besatzern trotzig widerstanden. Heute leben wir als Minderheit in vier Staaten – in der Türkei, dem Irak, dem Iran und in Syrien. Wir Kurden, verbunden durch unsere Kultur und Sprache, sind die größte Nation der Welt ohne eigenen Staat. Wirklich einig sind wir uns deshalb noch lange nicht. Damit es irgendwann zu einem unabhängigen Staat Kurdistan kommen könnte, der alle Gebiete in Syrien, im Irak, im Iran und in der Türkei einschließt, müssten in erster Linie die türkische PKK und die irakische PDK und ihre Anführer ihre politischen Differenzen überwinden.
Nur dann könnte es gelingen, unser Recht auf Selbstbestimmung mittels eines Referendums für ein unabhängiges Kurdistan durchzusetzen. Wenn wir uns wirklich als eine Nation verstünden, könnten wir eines Tages die kurdisch besiedelten Gebiete unabhängig und zu einem Staat vereint kontrollieren. Bei dieser Gelegenheit könnten wir an eine gute, alte Tradition anknüpfen: allen Ethnien ihren Platz einzuräumen und auf religiösen und politischen Pluralismus achten – anders als die Machthaber in Syrien, im Irak, in der Türkei und im Iran und anders als die radikalen islamistischen Truppen, die alles beseitigen wollen, was nicht ihresgleichen ist.
Derzeit sind wir von einem eigenen Staat weit entfernt. Zwar ist es uns gelungen, in Syrien und im Irak unsere Angelegenheiten in halb autonomen Regionen zu regeln. Doch vielerorts herrschen Unrecht und Unterdrückung. In Syrien hat das eine lange Tradition: 1962 wurden allein im Gouvernement Al-Hasaka rund 120 000 Kurden ausgebürgert und zum Teil enteignet. Sie verloren ihre Staatsbürgerschaft, ihre Rechte, ihren Besitz. Die Regierung verfolgte einen »Arabisierungskurs«, in dessen Zuge unter Assads Vater Hafiz ein »arabischer Gürtel« im Grenzgebiet geschaffen werden sollte. Vorgesehen war die Deportation von rund 140 000 Kurden, die auf einem etwa 15 Kilometer breiten und 375 Kilometer langen Streifen entlang der türkischen und irakischen Grenze lebten. Sie sollten durch arabische Siedler ersetzt werden. In die Provinz Al-Hasaka zogen in den Jahren 1975/76 rund 25 000 arabische Familien.1 Zwar kam es letztlich nicht zur geplanten Deportation, doch die enteigneten Kurden waren ihrer Existenzgrundlage beraubt und als Staatenlose entrechtet. Sie hatten kein Wahlrecht, kein Recht, Land, Immobilien oder ein Geschäft zu besitzen. Kurdische Ortsnamen wurden durch arabische ersetzt, später wurde es Familien untersagt, ihren Kindern kurdische Namen zu geben. Der Besitz kurdischer Literatur war verboten, nicht einmal zu Hause durften wir unsere Sprache benutzen.
Die systematische Diskriminierung der Kurden in Syrien verstieß und verstößt gegen zahlreiche internationale Abkommen, allen voran gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Zwei- bis dreihunderttausend Kurden lebten vor dem Krieg als Staatenlose in Syrien, ein Status, der automatisch auf ihre Kinder übergeht. Sie haben kein einklagbares Recht auf Krankenversorgung oder Sozialleistungen, als »Nichtregistrierte« haben sie noch nicht einmal einen Rechtsanspruch auf den Schulbesuch.
Um solche gravierenden Nachteile zu vermeiden, hat sich ein Großteil der vier Millionen Kurden in Syrien als dem muslimischen Glauben angehörend registrieren lassen. Aber deswegen waren und sind sie noch lange keine Muslime. Das beweist schon allein die Tatsache, dass die kurdischen Jesiden im Nordirak in den vom schiitischen Iran und der sunnitischen Türkei umgebenen Bergen seit tausend Jahren unzählige Male von muslimischen und osmanischen Armeen und seit 2014 vom IS angegriffen und viele von ihnen getötet worden sind, weil sie nicht als Muslime gelten. Die meisten der Kurden haben – trotz des arabischen Ausweises – ihre Geisteshaltung und ihre Weltsicht bewahrt. Das ist auch der Grund dafür, dass unter den Kurden keine radikalen islamistischen Gruppen entstanden sind. Die Muslime beten, wir nicht, sie gehen in Moscheen, wir nicht, sie lesen den Koran, wir nicht. Das ändert sich auch im Ausland nicht, der Gegensatz verschärft sich vielmehr. Muslimische Flüchtlinge, das habe ich in Deutschland beobachtet, kleben am Koran und am Islam und laufen scharenweise zur Moschee, wo sie unter sich bleiben können. Alles, was sie interessiert, ist die Frage: Glaubst du oder glaubst du nicht?
Ganz anders die Kurden: Selbst jene, die an Allah glauben, lassen nicht zu, dass die Religion ihr Leben bestimmt, und sie versuchen auch nicht, das Leben anderer mittels der Religion zu bestimmen. In vielen arabischen Ländern dagegen sind Glaube und Politik auf unselige Weise miteinander verbunden. Der (falsche) Glaube oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie liefert immer wieder die Grundlage für Gewalt und Unterdrückung.
In Syrien zum Beispiel kujonierte das Regime auch Angehörige anderer Minderheiten. Begünstigt wurde das durch die 1963 in Kraft getretenen Notstandsgesetze. Sie erlaubten Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, willkürliche Festnahmen, Zensur der Medien, sie verboten Parteien außer der sozialistischen Baath-Partei, die eine ungeteilte arabische Nation anstrebt. Dissidenten und Oppositionelle wurden festgenommen und in Haftanstalten wie dem berüchtigten Sednaya-Gefängnis gefoltert.2
Baschar al-Assad, den wir nur »Stû dirêjo« nennen, den »Mann mit dem langen Hals«, setzte die Politik seines Vaters konsequent fort. Die Hoffnungen, er würde einen reformorientierten Kurs einschlagen, zerstoben in dem Maße, in dem der Ruf der Bevölkerung nach ebensolchen Reformen lauter wurde. Seit dem »Damaszener Winter«, mit dem die kurze Phase der Liberalisierung 2002 endete und die bürgerlichen Freiheiten wieder massiv eingeschränkt wurden, verfolgte Assad einen harten Kurs. Sein diktatorisches Regime unterdrückte nicht nur die Kurden, sondern große Teile der in Syrien lebenden Bevölkerung. Was in den vergangenen Jahren in Syrien geschehen ist und auch mein Leben völlig auf den Kopf stellen sollte, geht in erster Linie auf sein Konto.
2004 kam es in meiner Heimatstadt Qamishlo zu einem folgenschweren Vorfall während eines Fußballspiels. Gewaltbereite Fans des Teams aus Deir ez-Zor attackierten einheimische Zuschauer mit Steinen und Flaschen, sie grölten antikurdische Parolen. Aber nicht sie wurden aus dem Stadion entfernt, sondern die Fans aus Qamishlo. Vor dem Stadion kam es deswegen zu Protesten, Sicherheitskräfte erschossen neun unbewaffnete Kurden. An der Trauerfeier am nächsten Tag nahmen mehrere Zehntausend Menschen teil, darunter auch Christen und Araber. Als einige Teilnehmer Steine auf eine Assad-Statue warfen, griffen Sicherheitskräfte und Zivilbeamte hart durch, erneut gab es Tote.
In den folgenden zwei Tagen kam es in anderen Städten zu Solidaritätsprotesten, mehr als 30 Menschen wurden erschossen, rund 160 verletzt. Assads Armee rückte in Qamishlo ein, das Telefonnetz wurde gekappt, der Strom abgestellt. Wir lebten damals in Damaskus, wo das kurdische Viertel ebenfalls abgeriegelt worden war, und konnten niemanden erreichen. Im ganzen Land nahmen Assads »Sicherheitskräfte« 100 Menschen fest, 25 Kurden wurden getötet, zahllose kurdische Studenten exmatrikuliert.
Einige Jahre später zeigten uns die Menschen in Tunesien, Libyen und Ägypten, dass es möglich ist, einen Tyrannen zu stürzen. Und so fassten auch die Syrer Mut, auf die Straße zu gehen, um Freiheit einzufordern. Assad antwortete mit Gewalt, zuerst in Daraa im Südwesten, wo sein Cousin Atef Najib als Geheimdienstchef Kinder einsperren und foltern und auf Demonstranten schießen ließ. Als der Aufstand eskalierte und das Volk auch in anderen Städten demonstrierte, ließ Assad prügeln, verhaften und schießen – in Hama sogar auf Kinder.
Wo immer Assads Armee Zivilisten terrorisiert hatte, hinterließ sie an Mauern und Hauswänden Parolen in roter oder schwarzer Farbe: »Assad, oder wir werden das Land niederbrennen.« Das ist ihnen ja inzwischen gelungen. Offenbar glaubte Assad, so Angst verbreiten und den Aufstand mit Gewalt ersticken zu können. Stattdessen entwickelte sich ein Bürgerkrieg.
Der »syrische Frühling« 2011 war eine Revolution gegen all das, was die Assads, Vater und Sohn, der Bevölkerung in den vergangenen Jahrzehnten angetan hatten. Auch wenn ich mit vielem nicht einverstanden war, was die Aufständischen taten, war auch ich überzeugt davon, dass es notwendig war, der Welt zu zeigen, dass Syrien von einem Diktator regiert wird. Aber Assad, das sagte ich oft zu meinen Freunden, wird nicht verschwinden, nur weil wir rufen: »Assad, hau ab«, oder an eine Wand schreiben: »Jetzt bist du dran, Doktor.« Ein Gewaltregime weicht nicht freiwillig, nirgendwo auf der Welt. Um ihre Haut zu retten, ruinieren solche Herrscher eher das ganze Land. Deshalb mussten aus meiner Sicht die großen Nationen der Welt den Aufstand stützen und Assad dazu bewegen, die Menschenrechte zu achten – oder am besten gleich die Macht in andere Hände zu übergeben, in demokratische. Meine größten Hoffnungen ruhten dabei auf den Vereinigten Staaten von Amerika.
Ich beteiligte mich damals nur an einer Demonstration gegen das Regime, am 21. März 2012 in Qamishlo. An jenem Tag, dem kurdischen Neujahrsfest Newroz, verlangten junge Männer und Frauen Freiheit, forderten den Rücktritt von Assad und ein Ende der korrupten Dynastie, in der Baschar al-Assads Cousin Rami Machlouf (wir Studenten nannten ihn »Dieb«) große Geschäfte machte; in der sein jüngster Bruder Mahir, Leiter einer alawitischen Elitetruppe, der »Republikanischen Garde«, und der Vierten Division der Armee bald seine Schläger und Mörder auf die Protestierer hetzen sollte; und in der sein Schwager Asif Schaukat, lange Chef des Geheimdienstes, inzwischen dem Generalstab angehörte.3
Auf den Kundgebungen waren vereinzelt »Allahu Akbar«- Rufe zu hören. Der Ruf nach Freiheit und das Preisen von Gott passen aber nicht zusammen. Man kann sich entweder Freiheit wünschen oder sich einem Gott unterordnen. Beides zugleich geht nicht. Und so endete die Freiheit, auch unter den Aufständischen. Die Stimmen derer, die für wahre Freiheit und Demokratie warben, verstummten nach und nach. Die wahren Streiter für eine Öffnung verschwanden. Heute opponieren in Syrien längst nicht mehr unzufriedene Bürger und Studenten. Was in Europa und in den USA heute als »Opposition« bezeichnet wird, mit der man gemeinsam gegen Assad agiert, schließt auch mehr oder weniger radikale Islamisten ein.
Assads Krieg gegen das eigene Volk hat das ganze Land in Chaos gestürzt. Er ist die Ursache, die Dschihadisten sind nur das Symptom. Sie haben von diesem Chaos profitiert, sie konnten ihre Einflusssphäre vom Irak auf Syrien ausweiten. Der IS erlangte schnell die Kontrolle über das rebellierende Volk und die Gebiete im Osten Syriens, aus denen sich die Armee des Regimes weitgehend zurückgezogen hatte, um sich auf die alawitischen Gebiete und die fruchtbaren Landesteile zu konzentrieren.
Die Vereinigten Staaten von Amerika, in die nicht nur ich so große Hoffnungen gesetzt hatte, legten die Hände in den Schoß und sahen lange tatenlos zu. Es schien, als wünschten sie sich sogar, der Diktator bliebe an der Macht. Baschar al-Assad konnte seinen Terror gegen das Volk fortsetzen, leer gebombte Städte einnehmen und Araber, Kurden, Assyrier und Armenier, Christen und Muslime, die einst friedlich zusammenlebten, gegeneinander aufhetzen. Erst als der IS immer größere Teile des Landes unter seine Kontrolle brachte, wachte die Weltgemeinschaft langsam auf.
Dass die Ausweitung ihres Machtbereichs so schnell ging, liegt an weiteren Schuldigen für die Vernichtung ganzer Städte, den Tod Hunderttausender und die Flucht von mehr als fünf Millionen Syrern: Es liegt an Katar, Saudi-Arabien und der Türkei. Sie unterstützten direkt und indirekt Organisationen, die nicht die Freiheit wollten, sondern einen islamistischen Staat, in dem die Scharia Gesetz ist und Frauen ihren Körper unter Stoff verbergen müssen. Dass solche Terrororganisationen wie der IS oder Al-Qaida überhaupt entstehen konnten, daran sind die USA nicht unschuldig. Mit ihrer Invasion im März 2003 wurde im Irak ein über 1400 Jahre gewachsenes Gleichgewicht beseitigt. Natürlich war Saddam Husseins Staat eine Diktatur, natürlich hat Hussein ähnlich wie Assad vor allem gegen die Kurden agiert, 1988 selbst den Einsatz von Chemiewaffen im Nordirak befohlen. Trotzdem konnten damals die verschiedenen Ethnien und Religionen einigermaßen friedlich zusammenleben, sofern die Menschen das Regime grundsätzlich akzeptierten. Im Irak war das Miteinander sehr viel friedlicher als das, was wir seit 2003 erleben.
Dieser Krieg und die bis 2011 andauernde Besatzung durch die USA und ihre Verbündeten hat nicht nur mehrere Hunderttausend Menschenleben gekostet, die nachfolgende »Ordnung« hat auch die Machtverhältnisse im Irak auf den Kopf gestellt. Wie schon in anderen Staaten – beginnend in Korea und Vietnam, über Somalia und Afghanistan, schließlich in der Folge des »arabischen Frühlings« in Libyen und im Jemen – hat das Eingreifen der USA die Verhältnisse nicht verbessert.
Im Irak hat es die westliche Koalition versäumt, dafür zu sorgen, dass Minderheiten, insbesondere die bis dahin regierenden Sunniten, in die Politikgeschäfte eingebunden blieben. US-Zivilverwalter Paul Bremer verbot die arabisch-sozialistische Baath-Partei, die Mehrheitsbevölkerung der Schiiten übernahm die politische Macht, was die Balance in der Region zugunsten des Iran und des schiitischen Islam verschob. Der schiitische Ministerpräsident Nuri al-Maliki (im Amt von 2006 bis 2014) verfolgte sunnitische und säkulare Politiker sowie sonstige Gegner seiner Regierung mit aller Härte. Die Amerikaner lösten außerdem das Militär auf, wodurch vorwiegend Sunniten ihre Existenzgrundlage verloren, zahlreiche ehemalige Generäle, Offiziere und Soldaten schlossen sich dem Widerstand gegen die Besatzer an.
Auch die aus Afghanistan vertriebene Al-Qaida (»Die Basis«) fand im Irak ein neues Betätigungsfeld. Entstanden war sie einst unter Mithilfe der USA: Amerika hatte dschihadistische Kämpfer rekrutieren und gegen die sowjetischen Soldaten und die gewählte Regierung in Afghanistan in Stellung bringen wollen. Im Irak begann der Dschihad im August 2003 mit einem Anschlag auf die UN-Vertretung in Bagdad. Es folgten Sprengstoffattentate auf die Imam-Ali-Moschee, Menschen wurden entführt und verschleppt.
Im Mai 2004 wurde der Anfüh...