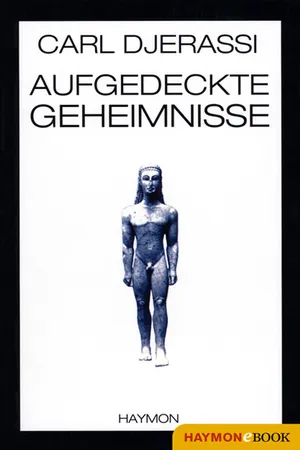![]() NO
NO![]()
1
„‚Was machen Sie denn nun an der Brandeis-Universität, um steife Schwänze zu bekommen?‘“ Felix Frankenthaler ahmte eine hohe Fistelstimme nach. „Das Ganze war ein glatter Reinfall“, seufzte er eine Oktave tiefer und ließ sich erschöpft in seinen Lieblingssessel sinken. „Mir war überhaupt nicht klar gewesen, dass zu meiner Tätigkeitsbeschreibung auch Katzbuckeln gehört. Man nennt dergleichen ‚Spendenbeschaffung‘; um taktlose, unkultivierte Matronen herumscharwenzeln wäre eine wesentlich passendere Bezeichnung. Als ich den Ruf als ordentlicher Professor an die Brandeis-Universität annahm, dachte ich, man wolle mich wegen meiner Genialität in der Forschung, meiner Einfühlsamkeit in der Lehre, wegen meines rücksichtsvollen Teamgeistes –“
„Hör schon auf, Felix“, unterbrach ihn Shelly, die sich instinktiv den Mund zugehalten hatte, um das in ihr aufsteigende Lachen zu verbergen. „Wir beide kennen deine Tugenden. Was ärgert dich denn so? Was ist auf dem Bankett vorgefallen? Und von wem sprichst du eigentlich?“, hakte sie sanft nach.
„‚Steife Schwänze‘ hat sie gesagt!“ Frankenthaler sprach wieder mit normaler Stimme. „Ich hatte versucht, meinen Tischpartnern unser derzeitiges Forschungsprojekt nahe zu bringen – du weißt schon, diese Stickoxid-Sache. ‚Machen Sie es kurz und spannend‘, hatte uns Arthur eingeschärft – der für Baumaßnahmen zuständige Großmufti, der Korpulente mit den Ripskrawatten –, bevor er uns auf die betuchten Ehemaligen losließ. Und schau dir an, was passiert ist. Das hat er davon, wenn er die Leute aus der Forschung seine Arbeit machen lässt. ‚Stars‘ hat er uns genannt, kannst du dir das vorstellen? Bildet er sich vielleicht ein, dass wir uns damit kaufen lassen? Und dann dieses Weib!“ Frankenthaler japste entrüstet und rang nach Luft.
„Was du brauchst, ist dein üblicher Schlummertrunk“, sagte seine Frau, schon auf dem Weg in die Küche. „Dann kannst du mir alles erzählen.“
„Ah“, sagte er, vorsichtig an der geschäumten Milch nippend, die mit genau der richtigen Menge Zimt und exakt drei Tropfen Vanille-Essenz gewürzt war – eine Mischung, von der Shelly Frankenthaler aufgrund jahrelanger Erfahrung wusste, dass sie das wirksamste Schlafmittel für ihren Mann war. Doch als er den Blick von der Tasse hob und den Kopf schüttelte, hatte sein Gesicht noch den gleichen gereizten Ausdruck. „Ich weiß nach wie vor nicht, was ich falsch gemacht habe. Zumindest habe ich nicht den nahe liegenden Fehler begangen. Ich hätte ihnen sagen können, dass Stickoxid – NO für den Chemiker – ein industrieller Schadstoff globalen Ausmaßes ist.“ Seine Stimme hatte einen parodistischen Ton angenommen, der zwischen bedächtigem Vortragsstil und übereifriger Verkaufsgewandtheit schwankte. „Dass aber, hier am Rosenstiel Basic Medical Sciences Research Center der Brandeis-Universität, geniale Geistesleuchten wie meine Wenigkeit entdeckt haben, dass unsere Körperzellen mittels exakt getimter winziger Mengen von NO miteinander kommunizieren. Des Weiteren hätte ich ihnen mitteilen können, dass NO in drei verschiedenen Redoxformen auftritt – positiv geladen, negativ oder neutral –“
„Wobei die meisten deiner Zuhörer dir längst nicht mehr hätten folgen können.“ Shelly lächelte ihren Mann gutmütig an. „Genau! Stattdessen wollte ich es einfach machen. Ich habe daher lediglich erläutert, dass man NO, also Stickoxid, genauer gesagt Stickstoffmonoxid, nicht mit N2O, also Distickstoffmonoxid, verwechseln darf, was gewöhnliches Lachgas ist. Aber ich konnte es ja einfach nicht dabei bewenden lassen!“
Shelly schüttelte mitfühlend den Kopf.
„Denn dann habe ich wohl einen Fehler gemacht. Vermutlich sind meine pädagogischen Instinkte mit mir durchgegangen. Ich erläuterte ihnen nämlich, dass diese winzigen Mengen von NO eine außergewöhnliche Palette von biologischen Eigenschaften vermitteln, von der Zerstörung von Tumorzellen bis …“ Er hielt inne und lächelte trübsinnig.
„‚Bis hin zur Regulierung des Blutdrucks‘, hätte ich sagen können und es gut sein lassen sollen. Statt dessen sagte ich ‚bis hin zum Auslösen einer penilen Erektion‘. Schließlich hatten uns unsere Spendeneintreiber geraten, unsere Forschungsprojekte aufregend klingen zu lassen, und eine Erektion ist zweifellos etwas Aufregendes. Aber die Worte ‚steife Schwänze‘ sind notabene nicht über meine professoralen Lippen gekommen!“ Frankenthaler lehnte sich zurück und trank einige Schlucke Milch. „Ich war im Begriff, eine politisch korrekte Bemerkung anzufügen, nämlich dass daran eine Postdoktorandin arbeitet, noch dazu eine Inderin, aber die blöde Kuh –“
„Felix!“
„Entschuldige“, sagte er und kaschierte seine Zerknirschung, indem er seine Tasse leerte, „aber das Weib hat mich wirklich zur Weißglut gereizt. Also habe ich einfach den Mund gehalten. Das Ganze war schließlich Arthurs Idee, sollte doch er die Kastanien aus dem Feuer holen. Wieso sollte ich denen etwas über Renu Krishnan erzählen? Dass ich vorhabe, sie für ein paar Monate nach Jerusalem zu schicken, um mit Davidson am Hadassah-Klinikum zu arbeiten?“ Er kniff die Augen zusammen. „Entdecke ich in den Augen meiner Angetrauten etwa eine Spur von Missbilligung?“
Die leichte Schärfe hinter dem Geplänkel entging seiner Frau nicht. „Missbilligung? Ganz und gar nicht. Natürlich hättest du etwas diplomatischer sein können und sie nicht mit deiner Erektion überfallen –“
„Shelly! Ich muss doch bitten!“
Sie hob abwehrend die Hand. „Du bist heute Abend viel zu ungeduldig. Lass mich ausreden. Ich wollte sagen, dass du deine Zuhörer darauf hättest vorbereiten können, statt sie aus heiterem Himmel mit deiner Erektion zu konfrontieren.“
„Sehr geistreich.“ Frankenthaler bemühte sich nicht, seinen Sarkasmus zu verbergen. „Auf welch zugeknöpfte Weise hättest du es denn gemacht?“
„Ach“, sagte sie mit einer vagen Handbwegung, „ich hätte mit dem retraktilen Penismuskel des Stiers angefangen. Offen gestanden ist das Wort ‚retraktil‘ weniger aggressiv – auch weniger aufregend, zugegeben – als das, was du da bei deinem Bankett aus dem Hut gezogen hast.“ Sie beugte sich vor, um ihrem Mann die Hand zu tätscheln. „Ich hätte mit Gillespies Arbeit auf dem Gebiet der Nanc-Nerven und der Neurotransmission begonnen. Danach hätte man erwähnen können, dass er diesen Muskel im Penis des Stiers nur deshalb ausgewählt hat, weil er besonders reich an derartigen Nerven ist.“
„Nicht zu glauben!“ Es war bewundernd gemeint, und Shelly, die ihren Mann nur zu gut kannte, fasste seinen Ausruf als Kompliment auf. Frankenthaler war erstaunt, dass seine Frau – eine eingefleischte Nicht-Wissenschaftlerin – sich noch daran erinnerte, was er ihr über den Ursprung seines eigenen Interesses an der NO-Forschung erzählt hatte. Es hatte damit begonnen, dass er etwas über „Nanc“-Nerven gelesen hatte. Lag es daran, dass er ihr erklärt hatte – aber das war schon eine Ewigkeit her! –, dass es für „nichtadrenerg, nicht-cholinerg“ stand und dass Gillespie in Schottland dem unbekannten Neurotransmitter in diesen Nerven – dem Nanc-Signal – nachgegangen war und feststellte, dass es sich dabei um den gleichen instabilen rätselhaften Stoff handelte, den Furchgott in New York in den Endothelzellen von Blutgefäßen entdeckt hatte? Furchgott hatte seinem fundamentalen und bis dahin unbekannten körpereigenen Mediator zur Blutdruckregulierung den Namen endotheler Relaxationsfaktor (EDRF) gegeben. Als ursächlicher Faktor beider Phänomene stellte sich schließlich das simple zweiatomige Molekül Stickoxid heraus. Und genau da kam Frankenthaler ins Spiel: Blutzufluss ist auch bei der Erektion des Penis unerlässlich, und auch hier erweist sich NO als der Schlüssel. Wie NO im Körper gebildet und wie es übermittelt wird, das sollte seine indische Postdoktorandin herausfinden. Renu Krishnans Aufgabe war es, den Weg für klinische Anwendungen zu ebnen.
„Gewiss“, sagte er. Sein Stolz auf seine Frau hatte seinen Ärger beschwichtigt. „Aber wenn ich deinen behutsamen, diplomatischen Kurs eingeschlagen hätte, wäre weder dieses grässliche Weib noch sonst einer der Anwesenden mehr bei der Sache gewesen, wenn ich endlich auf unsere Arbeit und die Erektion zu sprechen gekommen wäre. Außerdem, meine Liebe, war ich auf dem Bankett, um Geldgeber für Brandeis zu gewinnen – und nicht für jemanden in Glasgow oder New York. Aber genug davon. Ich habe morgen einen langen Tag, und es ist Zeit, schlafen zu gehen. Für uns beide.“
![]()
2
Hier sitze ich und denke nach, was gewöhnlich bedeutet, dass ich Selbstgespräche führe. Natürlich ist daran nichts auszusetzen. Einem berühmten Russen zufolge tun das fast alle Menschen. „Beim Denken handelt es sich um nichts anderes als um einen inneren Monolog oder um Unterhaltungen, die wir in unseren Köpfen zu führen gelernt haben.“ Das habe ich von meiner Zimmergenossin am Wellesley College, die, unter anderem, gern Michail Bachtin zitierte.
Ich mag zwar eine allgemein bildende Erziehung genossen haben, aber ich komme mir dennoch wie ein Trottel vor. Da bin ich, 26 Jahre alt, Postdoktorandin der Chemie an der Brandeis-Universität und, wie man meinen sollte, eine erwachsene Frau. Und doch kann ich mir das Kichern nicht verkneifen, als mich mein Professor fragt, ob ich einige Monate in Jerusalem verbringen möchte.
Wie sollte ich es ihm auch erklären? „Professor Frankenthaler, vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief von Ashok.“ Verständnisloser Blick. Der Name würde ihm gar nichts sagen. Immer muss man so viel erklären. „Ashok ist mein Bruder und Computerspezialist in Bangalore.“ Und dann müsste ich wohl hinzufügen, dass Bangalore das Silicon Valley Indiens ist und dass Ashok derjenige war, der, gegen Ende seiner Studienzeit am MIT, Mammi dazu bewegte, mich in Amerika aufs College gehen zu lassen. „Aber Renu ist doch erst siebzehn!“, hatte unsere Mutter ausgerufen, doch Ashok hatte geahnt, dass sie das sagen würde, unsere wunderbare, aber sehr indische Mammi. „Du weißt, dass Vater es billigen würde“, fügte er in einem Ton hinzu, als hätte er gerade eben mit Papaji darüber gesprochen. „Sie wird nach Wellesley gehen, an eine reine Mädchenschule“ (natürlich benutzte er das Wort Mädchenschule und nicht das Wort Frauencollege ), „die praktisch gleich neben dem MIT liegt, sodass ich ein Auge auf sie haben kann“, sagte er. Er ließ kein Wort davon verlauten, dass er mir die Anmeldeformulare bereits zugesteckt hatte, dass ich sie ausgefüllt ans Wellesley College zurückgeschickt hatte und dass ich beim TOEFL-Test hervorragend abgeschnitten hatte. Letzteres hätte meine Mutter natürlich nicht überrascht, die – schon lange vor dem Tod meines Vaters – der Meinung war, dass erstklassiges Englisch eine Grundvoraussetzung für die Art von Heirat war, die ihr für ihre Tochter vorschwebte.
Wenn ich versucht hätte, Professor Frankenthaler all das zu erklären, hätte er mich schon unterbrochen, lange bevor ich bei der arrangierten Heirat angelangt gewesen wäre. „Kommen Sie zur Sache, Renu“, hätte er, durchaus höflich, gesagt, denn er ist ein höflicher Mensch. Aber ich wäre auf der Stelle verstummt. Den Rest hätte ich ihm nicht erzählt. Nicht dass der Prof es nicht verstanden hätte. Er rühmt sich seiner „ethnischen“ Sensibilität, die an einem Ort wie Brandeis ganz besonders kultiviert wird. Aber ich wäre viel zu verlegen gewesen. Nicht weil ich Inderin bin, sondern weil ich seit neun Jahren in den Vereinigten Staaten lebe. Ich fühle mich nicht mehr als Inderin. Ich bin nicht sicher, ob ich noch weiß, was das eigentlich ist. Oder was ich sonst noch alles erklären müsste, bevor er verstehen würde, warum die Aussicht auf eine Reise nach Jerusalem mich zum Kichern bringt.
Wenn es nicht schon die späten Sechzigerjahre am Wellesley getan hatten, hätte mich spätestens die Doktorandenzeit an der Stanford-Universität Anfang der Siebzigerjahre ohnehin verändert. Meine erste Zimmergenossin in Palo Alto beschleunigte den Vorgang. Megan Reed war Studentin der Betriebswirtschaft und sehr weltgewandt. In Bars bestellte sie Kir, in Restaurants Ceviche, Blätterteig-Kanapees, Lollo rosso und niemals Kopfsalat. Sie wusste sich zu kleiden (eine ihrer Eigenarten war eine Vorliebe für halterlose Strümpfe an Stelle von Strumpfhosen), und sie zog interessante Männer in solchen Scharen an, dass ich unwillkürlich zur Nutznießerin des Überschusses wurde. Gott sei Dank war Ashok zu der Zeit bereits nach Indien zurückgekehrt. Mein Bruder ist zwar modern, aber so modern nun auch wieder nicht. Ashok hätte vermutlich nicht einmal meinen Doktorvater in Stanford gebilligt – einen Mann, der auf einer frisierten Harley-Davidson an die Uni gebraust kam.
Ich höre alle paar Wochen von Ashok und seine Briefe sind immer voller Neuigkeiten und Fotos und allen möglichen Zeitungsausschnitten. Als ich die Seite aus dem Indian Express mit der Überschrift Heiraten sah, musste ich lachen, während ich die Anzeigen überflog. In Indien pflegte ich diese Seite früher jeden Tag zu lesen, damals, als ich noch ein indischer indischer Teenager war, obwohl ich mich schon damals darüber amüsierte. Es hatte sich wenig verändert. Noch immer war da Stattlicher, gottesfürchtiger, solider, unkomplizierter junger Mann, schuldlos geschieden, wünscht nähere Angaben von Malayali-Damen ähnlichen Charakters und Standes. Gerne auch Damen, die nicht mehr empfangen wollen. Und weiter unten in der Spalte wurde ein aufgeschlossener männlicher Partner gesucht, vorzugsweise mit starkem Interesse für Kosmologie, Metaphysik, Philosophie und Raja-Yoga; mit festem Glauben an das Gute und Edle und dem Drang, die Geheimnisse des Universums und des Lebens zu erkunden.
Erst da bemerkte ich die mit gelbem Leuchtstift markierte Anzeige:
Verbindung gewünscht mit gut situiertem brahmanischem Jüngling, Akademiker, 28–33/180 oder größer, US-Beziehung oder Green Card bevorzugt, für Mädchen, 26/152, hell, attraktiv, US-Abschluss Dr. rer. nat. Zuschriften mit Horoskop an Chiffre 1501-C, Indian Express, Madras-2. Es stimmt zwar, dass ich 152 Zentimeter groß und 26 Jahre alt bin und dass „hell“ eine höfliche Umschreibung für „hellhäutig“ ist, aber das trifft bestimmt auf abertausend indische „Mädchen“ zu. (Ich hasse dieses Wort. Und was ist mit „Jüngling“? Wenn ich heirate, will ich ...