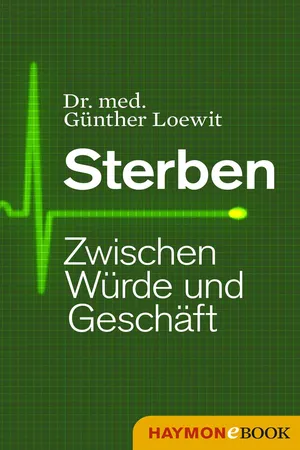![]()
Sterben und Tod III:
Die Medizin
Woran sterben wir?
Der Tod hat viele Facetten: individuelle, gesellschaftliche, philosophische und ökonomische – und heute mehr denn je ist der Tod auch ein medizinisches Thema. Wenn man sich mit dem medizinischen Blickwinkel auf den Tod beschäftigt, rücken mehrere Fragen in den Vordergrund: Warum oder woran stirbt ein Mensch? Wann soll die Medizin den Tod hinauszögern und wie kann sie ihn erleichtern? Ist der Tod ein ausschließlich medizinischer Belang? Ist die Medizin gar zur Universalinstitution für Beginn und Ende des Lebens geworden?
Zwei grundsätzlich verschiedene Arten des Lebensendes lassen sich beschreiben. Entweder stirbt ein Mensch einen „natürlichen“ Tod zu jenem Zeitpunkt seines Lebens, an dem die lebensnotwendigen Organe ohne Einfluss von außen nicht mehr in der Lage sind, die Vitalfunktionen Herzschlag und Atmung aufrechtzuerhalten. Als Ursachen für diese Todesart kommen sowohl Krankheit als auch Altersschwäche in Frage.
Oder ein Mensch stirbt durch äußere Gewalt und damit einen vorzeitig ausgelösten Tod – sei es infolge von Naturereignissen wie Hungersnöten oder Katastrophen, von Unfällen oder von zwischenmenschlicher Gewalt.
Während wir gelernt haben, natürliche Todesfälle oder den Tod als Folge von Unfall oder Naturereignissen als „normal“ zu akzeptieren, ist der Tod als Folge zwischenmenschlicher Gewalt – sei sie nun krimineller oder vom Staat geduldeter Natur – gewissermaßen ein Sonderfall. Ein Blick auf die Geschichte zeigt, dass jede Zeit spezielle Formen des Tötens bevorzugt und erlaubt bzw. in unterschiedlicher Weise sanktioniert hat. Je nach gesellschaftlicher Entwicklungsstufe, historischer Epoche oder religiöser Ausrichtung einer Gesellschaft trifft man auf unterschiedliche Arten des Tötens. So ist das Erschießen eines Gegners im Krieg völlig legal, während das Erschießen eines Räubers durch das Opfer eines Überfalls in Friedenszeiten ein Gerichtsverfahren nach sich zieht. Im Namen Gottes sind vermutlich mehr Menschen legal getötet und auf bestialische Weise hingemetzelt worden als im Namen irgendeiner anderen Institution. Diese Aussage gewinnt an Bedeutung, wenn man das blinde Auge der römisch-katholischen Kirche mit einbezieht, mit dem diese z.B. Pogrome und den Antisemitismus betrachtet bzw. ignoriert hat. Die Institution Kirche unterscheidet in ihrem Umgang mit dem Tod offensichtlich sehr genau, ob es um den Tod eines Gläubigen bzw. um den Erhalt kirchlicher Macht geht. Der Tod eines Mitglieds der Kirche wird durch Fürsorge, den Hospizgedanken, durch Sakramente und geistlichen Beistand erleichtert, während der Tod im Namen Gottes nicht weniger brutal und unmenschlich gehandhabt wurde als der säkulare Gewalttod, wie etwa ein Blick auf die Zeit der Kreuzzüge zeigt. Aber auch viele Staaten töten bis heute mit dem Instrument der Todesstrafe ganz legal. Erwähnt werden muss auch jener Graubereich, in dem zum Beispiel die Menschen in belagerten Städten durch Seuchen und künstlich herbeigeführte Hungersnöte zugrunde gegangen sind.
Es gibt keine Studien darüber, in welchem Verhältnis die Zahl von auf natürlichem Weg verstorbenen Menschen zur Zahl der getöteten Individuen steht. Humanethnologische Forschungen zeigen jedoch, dass im Vergleich zu früheren Stammeskulturen die zwischenmenschliche Tötungsrate im heutigen Europa in etwa auf ein Hundertstel gesunken ist. In kriegerischen Stammeskulturen starb immerhin ein Viertel der Männer eines gewaltsamen Todes.
Wie man also stirbt, hat ganz wesentlich mit den kulturellen und gesellschaftlichen Umgebungsbedingungen zu tun. War zum Beispiel im Wien der vorletzten Jahrhundertwende die Tuberkulose, die auch die „Wiener Krankheit“ genannt wurde, die Todesursache Nummer eins, so sind es heute Herz-Kreislauf-Erkrankungen, unmittelbare Folgen des materiellen Wohlstandes.
Immer wieder wird betont, dass die moderne Medizin Krankheiten heilen könne, die in früheren Zeiten als unheilbar gegolten haben. Diesem an sich korrekten Satz muss aber die Behauptung gegenübergestellt werden, dass die moderne Medizin gleichzeitig mehr Menschenleben auslöscht, als irgendeine Form von praktizierter Medizin das bisher getan hat – trotz der zahlreichen Patienten, die in früheren Jahrhunderten z.B. infolge eines vom Arzt durchgeführten Aderlasses verblutet sind. Der Tod durch die angewandte moderne Medizin hat sich mit zunehmender Bedeutung der Medizin in unseren Breitengraden vervielfacht – Intensivstationen voll mit septischen Patienten nach an und für sich harmlosen Eingriffen geben ein beredtes Zeugnis von diesem Sachverhalt.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Beobachtung, dass Todesfälle, die im Rahmen einer staatlich sanktionierten, qualitätsgesicherten und gesellschaftlich anerkannten Schulmedizin auftreten, in der medialen Öffentlichkeit als legale, wenn auch bedauerliche Zwischenfälle dargestellt werden – Todesfälle, die als Folge von Heilverfahren außerhalb dieser anerkannten Medizin eintreten, werden dagegen als Kriminalfälle eingestuft.
Sterben in der Besenkammer
Krankenhäuser werden in der öffentlichen Wahrnehmung zunächst als Orte der Heilung und der Wiederherstellung gesehen – dass sie auch regelmäßig Schauplatz des Sterbens sind, spielt in dieser Sichtweise so gut wie keine Rolle. 90 % der Menschen wollen laut Umfragen zu Hause sterben, und doch stirbt letztlich die Hälfte von ihnen im Krankenhaus.
So gleichen die letzten Lebensjahre alter und pflegebedürftiger Menschen immer wieder einem „Schwarzer Peter“-Spiel. Moribunde, greise Patienten werden zwischen Alters- und Pflegeheim, zwischen Zuhause und dem Krankenhaus hin- und hergeschoben, weil niemand die Verantwortung für den Tod übernehmen will. Weil jeder Betreiber die eigene Institution frei vom Geruch des Todes und des Sterbens halten will. Aus Sicht der diversen Anstaltserhalter, so hat es zumindest den Anschein, stirbt der Patient im Idealfall im Rettungsauto. Denn immer spielt im Hinterkopf die Schuldfrage mit. Irgendwer muss ja am Tod eines Menschen schuld sein, und der Tod im Rettungswagen hat für niedergelassene Ärzte wie für Spitalsärzte die wenigsten Nebenwirkungen.
Oft werden auch offensichtlich sterbende Menschen noch schnell mit dem Sanitätskraftwagen irgendwohin gebracht. Von zu Hause in ein Krankenhaus, von einem stationären Spitalsaufenthalt zurück ins Heim, vom Alters- ins Pflegeheim, vom Pflegeheim ins Krankenhaus und von dort ins Hospiz. Weil Angehörigen, Ärzten, Altenpflegern oder Pflegeverantwortlichen der Mut und damit auch die Demut fehlt, das nahende Ende des Lebens zu akzeptieren.
„Herr Doktor, schicken Sie die Mutter nicht mehr ins Spital? Da muss man doch noch was machen. Wir können die arme Frau ja nicht einfach so zu Hause sterben lassen, oder?“
Der so angesprochene Arzt steht am Krankenbett einer 90-jährigen Frau, deren linker Unterschenkel plötzlich blau und kalt geworden ist. Die Patientin selbst hat keine Beschwerden. Sie liegt seit fast zwei Jahren im Bett, wird durch eine Magensonde ernährt und mit starken Schmerzmitteln behandelt. Der Mediziner hat vergeblich versucht, den Angehörigen die Durchblutungsstörung im Bein als Endpunkt im Leben der dementen Patientin darzustellen. „Wenn ich Ihre Mutter ins Spital schicke, wird man ihr dort das Bein amputieren. Möchten Sie der alten Frau das in ihrem Zustand wirklich noch antun?“
„Ja, Herr Doktor, wenn Sie die Verantwortung übernehmen können, dann lassen Sie die Mutter einfach zu Hause sterben. Aber vielleicht könnte man ihr im Spital doch noch helfen. Aber wie Sie wollen, ich überlasse die Entscheidung Ihnen.“
Der junge Arzt fühlt sich angegriffen und überfordert. Und stimmt schließlich der Spitalseinweisung zu. In einem Tragetuch muss die Patientin samt Magensonde, Harnkatheter und Urinbeutel durch das Stiegenhaus aus dem vierten Stockwerk zum wartenden Sanitätskraftwagen transportiert werden. Ein unwirklicher Anblick.
Im Krankenhaus entsteht dann ein skurriler akademischer Streit um die neue Patientin. Die Internisten lehnen die Aufnahme mit der Begründung ab, dass nur eine chirurgische Amputation des nicht mehr durchbluteten Beines das Leben der Patientin vorübergehend retten könne. Die Chirurgen schließen den geforderten Eingriff als zu riskant aus: „In diesem Zustand können wir die Frau auf keinen Fall auflegen, aber vielleicht können die Gefäßchirurgen noch was machen“, sagt der chirurgische Oberarzt. Also wird ein Gefäßchirurg angefordert. Nach einer kurzen Untersuchung der Patientin schreibt der Facharzt einen Konsiliarbrief, in dem unter anderem zu lesen steht, dass man in Anbetracht der Krankengeschichte, des stark reduzierten Zustandes der Patientin und ihres hohen Alters weitere diagnostische und therapeutische Schritte derzeit als nicht sinnvoll erachtet.
Obwohl der internistische Aufnahmearzt darauf hinweist, dass er keine freien Betten mehr habe und schon neun Gangbetten aufgestellt werden mussten, bleibt die bettlägrige Patientin nach zwei Stunden auf der interdisziplinären Aufnahmestation dem Internisten zur weiteren Behandlung übrig. Übermüdet, erschöpft und verärgert lässt er der alten Dame eine Infusion anhängen und gibt der Stationsschwester zu verstehen, dass sie die Patientin irgendwo, entweder hinter einem Paravent oder in einer Besenkammer, unterbringen solle. „Ich hab so das Gefühl, die macht’s nicht mehr lange.“
Als die Tochter später am Nachmittag ins Krankenhaus kommt und sieht, wie und wo die Mutter untergebracht ist, fordert sie ein sofortiges Gespräch mit dem Stationsarzt. Der versucht zu erklären, dass er medizinisch nichts mehr für die Mutter tun könne. „Und weil wir überhaupt keine freien Betten mehr haben, müssen wir Ihre Mutter zumindest für die heutige Nacht hier unterbringen. Ich versichere Ihnen aber, dass sie die beste medizinische Versorgung bekommt.“
Verzweifelt fordert die Tochter den sofortigen Rücktransport nach Hause. „Sterben kann meine Mutter auch zu Hause“, äußert sie sich entrüstet. Und erleichtert sagt der Arzt: „Ja, vermutlich ist es das Beste für die Patientin, wenn sie ihre letzten Tage zu Hause verbringen darf.“
Die Patientin verstirbt am Rücktransport, spät am Abend desselben Tages, in einem Tragetuch zwischen dem zweiten und dem dritten Stockwerk eines Wiener Zinshauses.
Auf den verschiedenen Stationen eines Krankenhauses ist die Wahrscheinlichkeit, ebendort zu versterben, für den Patienten sehr unterschiedlich. Dementsprechend gut oder schlecht sind die jeweiligen Abteilungen auch auf den Umgang mit sterbenden Patienten eingestellt.
So sind chirurgische Stationen im Allgemeinen am wenigsten mit dem Tod konfrontiert. Chirurgische Eingriffe sind meist geplant und können durch die präoperative Befunderhebung und entsprechende Vorbereitung des Patienten abgesichert werden. Wenn das Sterben auf einer chirurgischen Abteilung stattfindet, dann in unmittelbarer zeitlicher Nähe, vor oder nach einem geplanten Eingriff. Dieser Tod wird dann mit dem gut klingenden Begriff der „perioperativen Mortalität“ beschrieben.
Am besten auf das Sterben ihrer Patienten sind onkologische Abteilungen, die auf Behandlung von krebskranken Patienten spezialisiert sind, vorbereitet. Krebskranke, die im Spital behandelt werden müssen, sind dem Tod stets näher als Patienten, die zu Routineeingriffen stationäre Hilfe in Anspruch nehm...