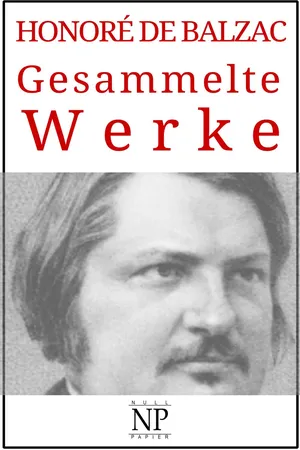![]() Lebensbilder - Band 1
Lebensbilder - Band 1![]()
Widmung
Dem Verfasser des letzten Chouan, oder die Bretagne im Jahre 1800.
Aus dem Französischen übersetzt vom Dr. Schiff
Drei Teile in zwei Bänden
Mit einer Geschichte des Werkes und einer Biographie Schiffs herausgegeben von Friedrich Hirth
![]()
Geschichte des Werkes
Ein schwerer bleierner Sargdeckel wurde gesprengt, und eine reiche Fülle gebundener geistigen Energie, die sich seit langem gesammelt hatte und der Entladung zudrängte, wurde frei. Mit seiner ungebändigten Überkraft und seinem ungeberdigen Wollen hatte einer die intellektuelle Kapazität großer Völker in den engen Pferch des Sarges gepreßt und achtete nicht des dumpfdröhnenden Grollens, das immer wieder aus dem Sarginnern herauftönte. Denn der eine wußte nur zu gut, daß er vom Wüten des Geistes, den er in starre Fesseln geschlagen hatte, so gut wie nichts befürchten müsse, daß ihn nur rohe physische Gewalt verderben könne.
Ihr erlag er endlich. Und nun schlug auch für den lebendig Eingemauerten die Befreiungsstunde. Voll ewiger Jugend und Tatkraft, der selbst die vieljährige Einkerkerung nichts hatte anhaben können, entfloh er seiner engen Haft und stürmte in das neugefundene Leben hinaus. –
Von Waterloo und der Beseitigung des geistigen Despotismus, den Napoleon Europa als schlimmste Kontribution auferlegt hatte, und der mit des Korsen Sturze zusammenbrach, ist die Rede. Man feiert Wellingtons und Blüchers Sieg immer nur als politisches Ereignis, womit dessen historische Bedeutung gewiß nicht unterschätzt ist. Aber man sollte nicht übersehen, von welchen nachhaltigen Folgen die Überwindung des Unüberwindlichen für das Wiedererwachen aller erstarrten schönwissenschaftlichen Bestrebungen der Nationen begleitet war. Am sichtlichsten zunächst vielleicht nur in Frankreich, dann aber im übrigen Europa. Alle solange gehemmt gewesenen künstlerischen Regungen brachen sich Bahn und forderten Daseinsberechtigung für sich. Nun konnte man aber auch daran denken, alles morsch und überlebt Gewordene über Bord zu werfen und neue Formen und Gestalten erstehen zu lassen.
Die Invasion der »Vandalen« habe nach Napoleons Sturze in Frankreich begonnen, riefen damals die intellektuellen Konservativen, die nur übersahen, daß von diesen »Vandalen« Frankreich seine neue Kritik, seine neue Philosophie, seine neue Dichtkunst bekommen habe.
Goethe und Schiller erschienen jetzt in der französischen Hauptstadt, geführt von der feinsten Geistigkeit des neueren Frankreich, der Frau von Staël. Sie setzte den drei Klassikern der französischen Bühne Lorbeerkränze auf und schickte sie dann über die Grenze. Und nun begann die Fehde zwischen Klassik und Romantik. Lamartine gab seine »Méditations«. Mit Staunen sah man zu seiner Poesie auf, die kühn und gewaltig in düsterer Majestät himmelan strebte, von wundersamen Melodien ertönend wie eine gotische Kathedrale, in der alle Glocken durch den stillen Abend läuten. Dann erschien »Éloa« von Alfred de Vigny, ein Gedicht voll schauerlicher Anmut wie die Morgenröte in den Flammen eines Gewitters. Hierauf kamen die »Odes et ballades« von Victor Hugo, die »Poësies« von J. Delorme, »Henri III.« von Dumas und endlich »Hernani«. Es war eine völlige Revolution im Reiche des Schönen. Der Spiritualismus wehte wie ein geistiger Frühling über dem alten Paris, in dem es glühte und grünte und blühte und sang, wie nie zuvor. Das kritische Gerüste der alten Schule stürzte zusammen, die Fesseln der drei Einheiten wurden gesprengt, der Alexandriner stieg von seiner Rosinante und schnallte die klassische Rüstung ab, bewegte sich leicht und behend und änderte die Tracht, je nachdem es Zeit und Sitte geboten. Mit der regelrechten Literatur war es vorbei. Vom Publikum und vom »Globe« aus dem Felde geschlagen, von den kleinen Blättern gehöhnt, vom »Théâtre français« verwünscht, das sich an ihren Trauerspielen arm gespielt, suchten die Klassiker Schutz bei der Regierung, die den Romantikern das Nationaltheater verbieten sollte. Ein solches Gelächter hatte Paris noch nicht gehört, und das Verbot wurde nicht erlassen. »Hernani« wurde in der comédie française aufgeführt, unter dem ungeheueren Beifalls- und Mißfallens-Tumulte. Es war die Schlacht zwischen Vandalen und Perücken – die Vandalen siegten. Aber jeden Abend wurde dieser Kampf erneuert. Bei »Lucrezia Borgia« und »Maria Tudor« dieselben Skandale. Es fehlte nicht viel, und Victor Hugo wäre geprügelt worden. Shakespeare und Schiller wurden angeklagt, daß sie den jungen Leuten die Köpfe verdrehten. Der »Constitutionnel« erhob täglich, von englischen Blättern (Edinbourgh review, New-Monthly-Magazine, theatrical Magazine) unterstützt, die heftigsten Anklagen gegen das junge Geschlecht.
Man konnte es diesem nicht verzeihen, daß es sich mehr an die Phantasie als an den Verstand (wie die verstaubte Klassik) wandte, daß jetzt Menschen mit menschlichen Leidenschaften an die Stelle der blassen, blutleeren Schemen getreten waren.
Englische Blätter leisteten, wie oben gezeigt, den französischen in diesem Kampfe freundnachbarliche Hilfe. Nur dem französischen Kaisertum war man ja im Britenreich feindlich gesinnt gewesen; einer intellektuellen Revolutionierung wollte man dort ebensowenig das Wort reden, wie seit 1789 einer politischen. Man übersah bloß, daß gerade die beständig angefeindete französische Staatsumwälzung in England das Auftreten zwar nicht seines größten, gewiß aber meistgelesenen Dichters des 19. Jahrhunderts gezeitigt hatte. Walter Scotts Siegeslaufbahn begann. Aus der Fülle der welthistorischen Ereignisse, die er selbst miterlebt hatte, war ihm die Anregung geworden, die Geschichte selbst zum Gegenstand der Dichtung zu machen. Wohl war er nicht einmal in England der erste, der solches wagte. Wenn schon nicht mehr de Foes »Memoirs of a Cavalier«, hatte er doch wohl der Damen Lee und Porter »Recess« und »Scottish Chiefs« gelesen, die so etwas wie historische Romane geschaffen hatten, aber von der geschichtlichen Treue oft recht weit abgeirrt waren. Scott hat jedenfalls erst die nicht unwirksame Verbindung von historischer Wirklichkeit und freier Erfindung künstlerisch gehoben und ihr Daseinsberechtigung verschafft. In Jahrzehnten, die dem mächtigen Flügelrauschen gewaltiger Begebenheiten angstvoll hatten lauschen dürfen, mußte seine dichterische Tat ein lautes Echo wecken. Es war ein Taumel der jubelndsten Begeisterung, in die man sich bei Scotts Dichtungen hineinlas. Ganz Europa stand unerschütterlich in dem Banne seines Könnens und verschlang gierig, was er bot. Ein Pseudohistorizismus spannte um die Gebildetsten aller Nationen seine Netze. Es war ein Sieg von unheimlicher Gewalt.
Er kann nicht unbegreiflich erscheinen. Da man so viel Geschichte miterlebt hatte, wollte man selbst deren längstvergessene Phasen wieder an sich vorüberziehen sehen. Und so mußten Richard Löwenherz, Karl der Kühne, Ludwig XI., Cromwell u. v. a. aus ihren Gräbern emporsteigen und in künstlerischer Vollendung zu den Lesern sprechen.
Das waren die zweifachen Folgen der Niederlage Napoleons; einmal die Abschüttelung des unerträglich gewordenen geistigen Joches, die Befreiung von überlebten künstlerischen Richtungen, die der Kaiser favorisiert hatte, dann die Befruchtung der Poesie durch die Geschichte. Die zweitgenannte Wirkung war vielleicht noch intensiver und weiterreichend als die erste. Denn nun brauste durch ganz Europa der Chor der epischen Geschichtsschreiber oder geschichteschreibenden Epiker, denen keine historische Figur und Begebenheit zu unbedeutend schien, um sie nicht in dichterischer Verkleidung auferstehen zu lassen. Ödester Pragmatizismus begegnet dabei ebenso wie willkürlichste Geschichtsverfälschung. Aber die Leser verschlangen alles in wildester Sensationsgier; und wer gegen Ende der Zwanzigerjahre des 19. Jahrhunderts im Roman etwas sagen wollte, mußte es in Scotts Manier tun, um beachtet zu werden. Es war nur ein Glück, daß dieser Dichter, dem man sich so völlig und willig ergeben hatte, ein Genie war und selbst seine oberflächlichsten Nachahmer noch insoweit befruchtete, daß sie zwar seine Fehler, deren er ja manche hat, noch übertrieben, aber auch an seinen blendenden Vorzügen lernten und ihnen möglichst nahe zu kommen suchten. In England, Frankreich und selbstverständlich in Deutschland, wo man ja selbst in Zeiten, als man der sprachlichen Ausländerei am schärfsten zuleibe ging, die stoffliche um so lieber ertrug, wie z. B. Philipp von Zesens Wirken dies zeigt, war die Scottnachahmung in höchster Blüte. Die Horace Smith, Crowe, Cooper und Hope, die Soulié, Mesnard, Salvandy und Merimée, die van der Velde, Zschokke, Spindler, Hauff und Alexis offenbaren nicht als die einzigen, aber als die markantesten – all die kleinen und kleinsten Nachbildner aufzuzählen, wäre zu weitläufig – die nachhaltige Einwirkung des Scottschen Vorbildes auf ihr Schaffen.
Nur von einem, der ebenfalls den gebieterischen Einfluß des Engländers verspürte, muß noch gesprochen werden: Tieck verließ damals die Gefilde der »wundervollen Märchenwelt« und trat 1826 mit zwei Abschnitten seiner historischen Novelle »Der Aufruhr in den Cevennen« hervor. Auch an ihm war der epische Historizismus der Zeit nicht spurlos vorübergegangen, und noch 1840 huldigte er ihm in »Victoria Accorombona«. –
Es ist kein Grund vorhanden, über diese weitverzweigte Nachahmungssucht, die in germanischen und romanischen Ländern allenthalben üppig wucherte, bewegliche Klagen anzustimmen. Sie blühte ja zu allen Zeiten, und die Geschichte des Romans aller europäischen Völker lehrt es, daß immer wieder ein bedeutendes Werk der Ausgangspunkt für zahllose Nachfolger wurde. Man hat namentlich in Deutschland schlechtere Vorbilder in der Epik rastlos kopiert, als es Walter Scotts Dichtungen waren.
Aber das kann man auch heute noch bedauernd feststellen, daß das Lesepublikum sich zu allen Zeiten immer nur auf eine Richtung festschwor, daß immer nur einem literarischen Gott gehuldigt wurde und man andere Götter neben diesem nicht duldete. Ein Kreuzen von Richtungen und Gegenrichtungen war dem Sinn der Literaturfreunde nie gemäß und genehm, vielleicht nur deshalb, weil es unbequem ist, sich von dem Trott des Ein- und Angewohnten loszumachen. Für die Entwicklungsgeschichte der Literaturen hatte dieser Beharrungstrieb sicherlich seine Nachteile, für die einzelner Literaten aber, die vielbetretene Pfade meiden wollten, seine niederdrückendsten Mißlichkeiten. Die Geschichte des Romans der Franzosen lehrt dies am sinnfälligsten: denn einer der größten Dichter der Neuzeit verzettelte jahrelang seine besten Kräfte in den verzweifelten Versuchen, der diktatorischen literarischen Forderung des Tages auszuweichen und statt der romanhaften Geschichtsklitterung die Wirklichkeit in der Dichtung abzuspiegeln. Gewiß war auch Scott, weniger seine Nachahmer, Realist, indem er in nicht selten bewunderungswürdiger Objektivität Natur und Persönlichkeiten richtig sah und darstellte. Aber Stoffe, Sitten und Anschauungen in seinen Romanen waren doch nur gründlich durchschaut, niemals durchlebt. Die Erkenntnis war einem Größeren vorbehalten, daß die Zeit selbst mit ihrem überreichen Inhalte, namentlich aber die vom Beginn der Restauration an einsetzende überraschende Umwandlung aller ethischen und sozialen Anschauungen, bedeutendes Objekt der Dichtung sein könne.
Versuche, an Stelle der in der Poesie immer noch spielerisch hintändelnden Pseudorealistik dem Leben sans phrase Denkmale zu setzen, brachten dem kühnen Neuerer nur die schmerzlichsten Mißerfolge, selbst als er es versuchte, nachdem das Pariser Publikum sich von dem Pseudonym Horace de Saint Aubin nicht zur Anerkennung hatte verlocken lassen, in der sehr geschickten und damals aktuellen Verkleidung als Lord R’Hoone seine literarische Aufwartung zu machen.
Man errät schon, daß Honoré de Balzac der beherzte, aber unbeachtet gebliebene Sucher einer neuen Form des realistischen Romans war. Nach zwei Fronten mußte er einen schweren Kampf führen, um sich und seine Ideen durchzusetzen: er hatte die französische Romantik Hugos ebenso zu überwinden, wie die ihr schroff entgegengesetzte englische Scotts. Mit einem Schlage ließ sich ein in diesen beiden Extremen befangenes Publikum nicht für eine dritte literarische Richtung gewinnen, und der junge Balzac mußte zunächst auf ein Kompromiß mit seiner Gedankenwelt sinnen. Scott kam ihm insofern entgegen, als er an ihm die Kunst minutiöser Detailmalerei bewundern konnte, die oft unheimlich realistisch ist. So entschloß er sich denn, da pekuniäre und literarische Mißerfolge ihn fast aufgerieben hatten, dem vergötterten Leserliebling Scott bedenkenlos nachzufolgen und in dessen Manier historisch-romantische Bilder zu entwerfen. »Pour se délier la main« geschah es, wie Balzac später behauptete; aber eigentlich wird dem jungen Feuerkopf nichts anderes vorgeschwebt haben, als sich kurzerhand das Publikum zu erobern und den Schuldenberg, der auf ihm lastete, abzuschütteln. Wollten die Leser nicht zu ihm kommen, so kam er zu ihnen; und waren die beiden erst beieinander, dann konnte man ja das aufmerksam gewordene Publikum rasch auf Pfade führen, die nicht seinen, sondern des Dichters Neigungen entsprachen.
»Die Chouans« waren der Roman, der Balzac 1829 auf Scotts Spuren der Gunst der Kritik und der Leser zuführte. Die Schilderungen und die Charakteristik verraten deutlich, wie fleißig der Franzose den Engländer studiert hatte. An psychologischem Scharfsinn übertrifft er ihn freilich, namentlich in der fast anatomischen Auseinanderlegung der weiblichen Charaktere zeigt sich schon in diesem Roman die Kunst Balzacs, die er später bis zur höchsten Meisterschaft emportrieb. –
Hatte er mit den scottisierenden »Schleichhändlern« das Publikum einmal für sich eingenommen, so durfte er es wagen, da sein Name nunmehr genügend Zugkraft ausübte, auch mit einem Produkte hervorzutreten, in dem er ganz er selbst war, in dem seine Gedanken und Einfälle, seine Psychoanalysen und -synthesen zum Ausdrucke kamen. In der »Physiologie der Ehe«, die den »Schleichhändlern« noch in demselben Jahre folgte, ist Balzac der »Alchimist des Gedankens«, als den ihn Sainte-Beuve glücklich charakterisiert hat. Schon aus diesem Frühwerke spricht der unerbittliche Gesellschaftskritiker zu dem Leser; die wichtigsten Erkenntnisse hat er seiner Zeit abgelauscht, die zwischen der Vertreibung und Wiedereinsetzung der Bourbonen die bedeutendsten sozialen Institutionen, vornehmlich die Ehe, tiefgreifenden Veränderungen unterworfen, die das Familienleben auf andere ethische Grundlagen gestellt und namentlich den Frauen zu einer selbständigeren Stellung verholfen hatte. Das alles verlangte Darstellung in der Dichtung, und Balzac ging an dieser Forderung der Zeit nicht achtlos vorüber. In der »Physiologie der Ehe« ist sein Realismus bereits zu unheimlicher Größe angewachsen; mag man den Autor einseitig nennen wegen der Art, wie er immer nur eine bestimmte Spezies des weiblichen Geschlechts vor Augen hat, ein tiefer Seher und Erkenner ist er in diesem Buche, und seiner Zeit hat er alle die oft erschütternden Reflexionen über eheliche Verderbnis sicher abgelauscht. Es ist eine tiefe Kluft zwischen den »Chouans«, deren Heldin eine moralisierende Courtisane ist, und der »Ehephysiologie«, deren Verfasser durchaus triebhafte und zynische Frauen vor Augen hat.
Aber das Publikum übersprang diese Kluft mit Leichtigkeit und folgte dem jungen Dichter nun, wohin er es führte. Noch mutete ihm Balzac, nachdem er sich in den Sarkasmen der »Physiologie der Ehe« das Herz ein wenig erleichtert hatte, nicht gleich zu, alles mit einem Schlage zu vergessen, was es bisher angebetet hatte. In den Erzählungen, die er unter dem Titel »Scènes de la vie privée« 1830 veröffentlichte und später in dem großen Rahmen seiner »Comédie humaine« unter dieselbe Rubrik zum Teile aufnahm, ist er noch nicht der schrankenlose Realist, wie er später etwa in »Eugénie Grandet« oder »Vater Goriot« zu erkennen ist. Zwar schwingt er auch schon in diesen Erzählungen mit Geschick das geistige Seziermesser des analysierenden Psychologen, der nichts anderes will, als das menschliche Herz in allen seinen Teilen bloßzulegen und dessen Schläge zu erklären. Aber diese ersten Geschichten – von den mit dem Hauptwerke unzusammenhängenden, posthum herausgegebenen »Övres de Jeunesse« wird abgesehen – sind noch die wenigen lichten Punkte auf dem trostlos trüben Firmamente, das Balzac über seiner »Comédie humaine« ausspannte, und das ein Abbild der Trostlosigkeit war, die über dem Frankreich der Dreißigerjahre schwebte. Noch war Balzac kein unerbittlicher ...