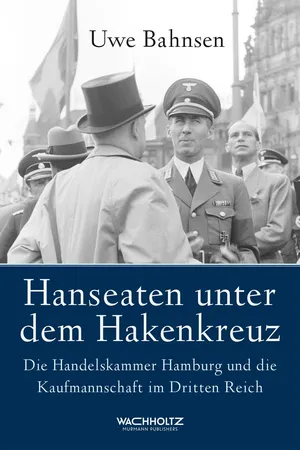![]()
ERSTES KAPITEL
Hamburg 1932 – eine Stadt in Not
Etwas missmutig blätterte Reichspräsident Paul von Hindenburg am Vormittag des 22. November 1932 in der schmalen Akte, die ihm Dr. Otto Meißner, der Staatssekretär des Reichspräsidialamtes, soeben vorgelegt hatte. Es war eine Eingabe mit stark vergrößertem Schriftbild, damit das 85-jährige Staatsoberhaupt den Text persönlich lesen konnte. Die 16 Unterzeichner (drei weitere Unterschriften wurden nachgereicht), überwiegend Persönlichkeiten der Finanz- und Agrarwirtschaft, unter ihnen der frühere Reichsbankpräsident Hjalmar Schacht und fünf namhafte Hamburger Überseekaufleute, forderten »Eure Exzellenz« in diesem auf den 19. November 1932 datierten Brief1 so höflich wie nachdrücklich auf, den Parteiführer der NSDAP, Adolf Hitler, zum Reichskanzler zu ernennen. Sie begrüßten Hindenburgs Politik, unabhängig vom Reichstag mit Notverordnungen zu regieren, und bejahten eine »vom parlamentarischen Parteiwesen unabhängige Regierung«.
Der Reichspräsident wurde mit der Eingabe gebeten, dass »die Umgestaltung des Reichskabinetts in einer Weise erfolgen möge, die die größtmögliche Volkskraft hinter das Kabinett bringt … Wir erkennen in der nationalen Bewegung, die durch unser Volk geht, den verheißungsvollen Beginn einer Zeit, die durch Überwindung des Klassengegensatzes die unerlässliche Grundlage für einen Wiederaufstieg der deutschen Wirtschaft erst schafft … Die Übertragung der verantwortlichen Leitung des … Präsidialkabinetts an den Führer der größten nationalen Gruppe« werde die »Schwächen und Fehler, die jeder Massenbewegung notgedrungen anhaften, ausmerzen und Millionen Menschen, die heute noch abseits stehen, zu bejahender Kraft mitreißen«.
Hindenburg empfand das Schriftstück als einen jener unerbetenen Ratschläge, die er im Herbst 1932 von Hitler-Anhängern aus allen Teilen des Reiches erhielt, so vom erzkonservativen Hamburger Nationalklub von 1919, der Hitler im Februar 1926 zu einem Vortrag eingeladen und ihm damit für die rechten Parteien und Verbände zur politischen Salonfähigkeit verholfen hatte. Durch das Ansinnen, den Parteiführer der NSDAP in das höchste Regierungsamt zu berufen, fühlte er sich unter Druck gesetzt. Täglich hatte er den offenkundigen Marasmus der Republik vor Augen. Aber er misstraute Hitler, der für ihn noch immer der »böhmische Gefreite« war und allenfalls »zum Postminister« tauge, wie es in Hindenburgs Umgebung hieß, und der gesamten NS-Partei. Bei dem großen Berliner Verkehrsarbeiterstreik Anfang November 1932 hatten die Nationalsozialisten mit den Kommunisten gemeinsame Sache gemacht. Dieses Zweckbündnis von Todfeinden war ihm zutiefst suspekt. Auch war offenkundig, dass in der Führung der NSDAP ein Konflikt um wirtschaftspolitische Richtungsentscheidungen ausgetragen wurde. In dessen Mittelpunkt stand der Reichsorganisationsleiter Gregor Strasser, der über die Machtfülle eines Generalsekretärs verfügte und sozialrevolutionäre Tendenzen vertrat, die ihn zu einem ernsthaften Rivalen Hitlers werden ließen. Überdies gab es durchaus Indizien für die These, die von Hitler entfachte und geführte »Bewegung« habe ihren Höhepunkt überschritten und stehe möglicherweise sogar vor dem Zerfall. Bei der Reichstagswahl vom 6. November 1932 hatte die NSDAP einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen und mit 33 statt zuvor 37 Prozent deutlich weniger Stimmen erhalten als bei der Wahl vom 31. Juli 1932.
Hindenburg entschied sich jedenfalls gegen einen Reichskanzler Hitler und ernannte am 3. Dezember 1932 den Reichswehrminister Kurt von Schleicher zum Regierungschef. Zwei Millionen Stimmen für Hitler und seine mit massiven finanziellen Problemen ringende Partei weniger – das führte im linken Spektrum sogleich zu frohlockenden und erleichterten Kommentaren, auch im Ausland. In London entwarf der Politologe Harold Laski, einer der intellektuellen Wortführer der britischen Linken, bereits ein Szenario von Hitler als politischem Ruheständler: »Von Zufälligkeiten abgesehen, ist es heute nicht unwahrscheinlich, dass Hitler seine Laufbahn als ein alter Mann in einem bayrischen Dorf beschließen wird, der abends im Biergarten seinen Vertrauten erzählt, wie er einmal beinahe das Deutsche Reich umgestürzt hätte.«2 Und in der Hansestadt diagnostizierte ein Kommentator des SPD-Organs »Hamburger Echo« eine »Hitlerdämmerung«: »Der Zauberbann, in dem Millionen standen, ist gebrochen, die Fluten sinken. Der Faschismus wird Deutschland nie erobern. Das ›Dritte Reich‹ kommt niemals. Die NSDAP hat sich politisch als eine Episode erwiesen, deren Überwindung nur noch eine Frage der Zeit ist.«3
Die Unterzeichner der Eingabe an Hindenburg hielten dagegen die Regierungsparteien der Weimarer Republik für unfähig, die schwere Krise des Reiches zu meistern. Die fünf Hamburger Kaufleute, die das von Hjalmar Schacht entworfene Schreiben mit ihrer Unterschrift versehen hatten, waren Männer von Ansehen und Gewicht in der Wirtschaft:
Emil Helfferich, früherer Generaldirektor des Straits und Sunda Syndikats, einer Gründung deutscher Banken und Überseehäuser, ein überaus erfolgreicher und einflussreicher Überseekaufmann mit exzellenten Beziehungen in Südostasien, aber auch in den USA und Westeuropa, Aufsichtsratsmitglied der HAPAG, Vorstandsmitglied der Deutsch-Amerikanischen Petroleum-Gesellschaft (Vorläufer der ESSO AG), ein Bruder des damals führenden Finanzexperten Karl Helfferich;
Franz Heinrich Witthoefft, Mitinhaber der Außenhandelsfirma Arnold Otto Meyer, Aufsichtsratsvorsitzender der Commerzbank AG, Altpräses der Handelskammer Hamburg, Präsident des Übersee-Clubs;
Kurt Woermann, Chef eines auf den Afrika-Handel spezialisierten bedeutenden Unternehmens;
Carl Vincent Krogmann, Mitinhaber der Außenhandelsfirma Wachsmuth & Krogmann, Mitglied der Handelskammer Hamburg;
Erwin Merck, Chef des traditionsreichen Handelshauses Merck & Co.
NSDAP-Mitglied war zu diesem Zeitpunkt nur Kurt Woermann. Emil Helfferich, Carl Vincent Krogmann und Franz Heinrich Witthoefft waren Mitglieder des Keppler-Kreises, den der süddeutsche Industrielle Wilhelm Keppler im Frühjahr 1932 als »Studienkreis für Wirtschaftsfragen« zur wirtschaftspolitischen Beratung Hitlers und der Führung der NSDAP gegründet hatte. Im März 1932 war Keppler im Auftrag Hitlers in Hamburg erschienen, um mit führenden Unternehmern die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit Hitlers Partei zu sondieren. Das Projekt der Industrielleneingabe entstand im Herbst 1932 in diesem Kreis.
Die fünf Hamburger Großkaufleute, die sie unterschrieben hatten, verband ein elementares Interesse – eine vor allem auf die Belebung des deutschen Außenhandels gerichtete Wirtschaftspolitik. Gewiss standen sie der NSDAP auch politisch nahe, und bei ihnen mag die illusionäre Überlegung eine Rolle gespielt haben, es könne gelingen, den Radikalismus von rechts durch eine Einbindung der NSDAP und die Beratung Hitlers zu bändigen. Aber vor allem hofften sie, mit Hilfe dieser Partei könne eine neue, antizyklische Wirtschaftspolitik eingeleitet werden. Die Auffassung, dass dies dringend notwendig sei, teilten sie mit etlichen jüngeren Kaufleuten aus großbürgerlichen Familien.
In der Kaufmannschaft insgesamt hatte die NSDAP als Partei nur einen geringen Rückhalt.4 Man störte sich an ihrem plebejischen Auftritt, ihrer Gewaltbereitschaft, ihrer Radaurhetorik, dem gesamten Mangel an politischer Kultur. Jedoch gab es Unternehmer, die über all das hinwegsahen, zum Beispiel die Zigarettenfabrikanten Hermann, Philipp und Alwin Reemtsma. Deren Einstellung zum Nationalsozialismus und zur NS-Prominenz, den Nichtraucher Hitler eingeschlossen, beruhte ausschließlich auf kühlen konzernstrategischen Überlegungen. Hitler war für sie der »kommende Mann«, und im Juli 1932 vereinbarte Philipp Reemtsma mit ihm bei einem Treffen im Berliner Hotel »Kaiserhof« eine aufwendige Anzeigenkampagne des Hauses Reemtsma in der Parteipresse, vor allem im NS-Organ »Völkischer Beobachter«. Die NS-Führung wusste, dass jedenfalls Hermann und Philipp Reemtsma persönlich keine Anhänger des Nationalsozialismus waren. Aber die finanzielle Unterstützung durch die Reemtsmas war für sie wichtiger – die »Bewegung« brauchte Geld, und zwar dringend.5
In einem zentralen Punkt stimmten fast alle Kaufleute mit Hitler und seiner Partei überein: Den Versailler Vertrag, den die Nationalsozialisten so erbittert bekämpften, hielt man in der Hamburger Wirtschaft für ein Siegerdiktat, aus dessen Fesseln Deutschland sich befreien müsse. Die Reparationen, der Verlust der Kolonien, die Ablieferung des größten Teils der deutschen Handelsflotte, die Beschlagnahme des deutschen Auslandsvermögens und der Patente, die dem Reich auferlegten Handelsbeschränkungen und -benachteiligungen – das und vieles mehr waren Wunden, die auch nach einem Jahrzehnt noch bitter schmerzten. Die Folge war, dass 1932 die »Harzburger Front«6 als »Nationale Opposition« auf beträchtliche Sympathien in der Kaufmannschaft stieß.
Symptomatisch war, dass der Werftunternehmer Rudolf Blohm, ein Anhänger der konservativen Deutschnationalen Volkspartei (DNVP), und Blohm + Voss-Direktor Carl-Gottfried Gok zu den Teilnehmern der Harzburger Tagung gehörten, die allerdings fast an Hitlers usurpatorischem Machtanspruch gescheitert wäre. Gok war Reichstagsabgeordneter der DNVP und galt ebenso wie Blohm als konsequenter Gegner der parlamentarischen Demokratie. Hitlers Verachtung für das Weimarer »System« fiel jedenfalls bei vielen Unternehmern auch in Hamburg insoweit auf fruchtbaren Boden, als sie dem »Parteienstaat« nichts mehr zutrauten.
Hamburg war nach Berlin die andere deutsche Metropole, in der sich 1932 das Schicksal der Weimarer Republik entschied. Hitler und sein Chefpropagandist Joseph Goebbels waren sich dessen völlig bewusst. Erst wenn die braune Partei das »rote Hamburg« dauerhaft erobert hatte, wo der KPD-Vorsitzende Ernst Thälmann in der Arbeiterschaft so populär war und die Sozialdemokratie und die Gewerkschaftsbewegung auf eine lange, festgefügte Tradition zurückblicken konnten, war die Weimarer Republik besiegt.
Insgesamt vier Großkundgebungen mit Hitler als Hauptredner veranstaltete die NSDAP 1932 in Hamburg – am 1. März in Sagebiels Festsälen zur Wahl des Reichspräsidenten am 13. März, am 23. April auf der Motorrad-Rennbahn in Lokstedt anlässlich der Landtagswahl in Preußen und der Bürgerschaftswahl in Hamburg, die beide am 24. April stattfanden, am 20. Juli auf dem Victoria-Sportplatz an der Hoheluft-Chaussee zur Reichstagswahl am 31. Juli und am 28. Oktober in den Ausstellungshallen in Altona zur erneuten Reichstagswahl am 6. November. Jedes Mal war das Publikumsinteresse enorm. In Lokstedt sprach Hitler vor 120 000 Zuhörern. Auf dem Victoria-Sportplatz hatten sich 50 000 Menschen versammelt. Hitler bediente ihr Misstrauen gegenüber dem parlamentarischen System und der Parteienherrschaft, und er prangerte im Hinblick auf die drückenden, wirklich existenziellen Probleme, mit denen jeder Einzelne zu kämpfen hatte, den Weimarer Verfassungsstaat an, dem er in maßloser, beißender Schärfe Rat- und Hilflosigkeit vorwarf.
Die breite Resonanz auf einen Politiker, dessen demagogische Skrupellosigkeit jeder Zuhörer erkennen konnte, ließ auf einen politischen Fieberzustand schließen, dessen furchtbarer Höhepunkt der folgenschwere »Altonaer Blutsonntag« am 17. Juli 1932 mit 18 Todesopfern war. Kurz darauf, am 9. August, hob die Polizei bei einer Großrazzia mit 1500 Beamten im Gängeviertel in der Neustadt die Zentrale des illegalen Roten Frontkämpferbundes der KPD für die gesamte Küste aus und stellte ein umfangreiches Waffen- und Munitionsarsenal sicher. Der Senat konnte die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht mehr gewährleisten. Blutige Zusammenstöße zwischen der Polizei, Kommunisten und NS-Anhängern auf den Straßen und in den Versammlungslokalen, die berüchtigten »Saalschlachten«, waren an der Tagesordnung.
Am 14. Februar hatte ein Kommunist an der Ecke Pilatuspool / Kurze Straße einen Flugblattverteiler der NSDAP erschossen. Am 10. April töteten fanatische KPD-Anhänger zwei Nationalsozialisten im Ausschläger Weg. Am 19. Mai starb ein Nationalsozialist bei Zusammenstößen zwischen Anhängern der NSDAP und der KPD am Schaarmarkt. Am 17. Juni kamen in St. Georg bei Schießereien zwischen Kommunisten und der Polizei drei Menschen ums Leben. Am 1. August starben am Rademachergang bei einem Schusswechsel ein KPD-Funktionär und ein Polizeimeister. Am 29. Oktober erschossen Nationalsozialisten in der Fruchtallee einen Angehörigen der SPD-nahen Wehrorganisation »Reichsbanner«, der Plakate klebte. Am 30. Oktober töteten Nationalsozialisten in der Holstenstraße einen Kommunisten. Abgerundet wurde diese (keineswegs vollständige) Bilanz des alltäglichen Bürgerkriegs auf Hamburgs Straßen durch eine Entscheidung der Hamburger Hochbahn vom 6. April 1932, ihre Bediensteten ab sofort mit Revolvern auszurüsten, nachdem Personal und Fahrgäste wiederholt überfallen und ausgeraubt worden waren.
Die Dauerkrise der inneren Sicherheit war schlimm genug. Zutiefst besorgniserregend aber war die Lage des Stadtstaates in politischer, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht. Bei der Bürgerschaftswahl vom 27. September 1931 hatte der Mitte-Links-Senat aus SPD, Deutscher Staatspartei und Deutscher Volkspartei seine Mehrheit verloren. Die NSDAP war nun mit 26,2 Prozent der Stimmen und 43 von 160 Sitzen zur zweitstärksten Partei geworden – nach der SPD mit 27,8 Prozent und 46 Mandaten. Zugleich hatte die KPD mit 21,9 Prozent und 35 Sitzen ihr bestes Wahlergebnis währen...