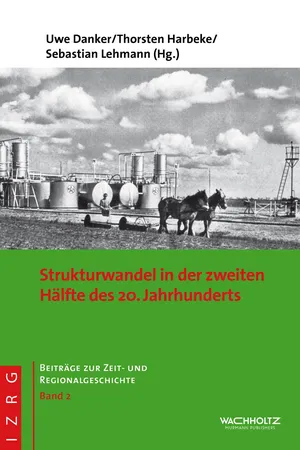![]()
CLAUDIA RUGE
» EUROPA UND UNSERE HEIMISCHE LANDWIRTSCHAFT« –
Landwirtschaftlicher Strukturwandel in Schleswig-Holstein im Kontext der europäischen Integration. Ein Dissertationsprojekt
Einleitung
»Ich will mit einer Sorge machenden Frage nicht hinter dem Berg bleiben; und beim Durchblättern einer Vielzahl von Beiträgen des Bauernblattes taucht dies entscheidende Problem genügend oft auf: Europa und unsere heimische Landwirtschaft. (...) Aus den vielen Beiträgen und Meinungen und Diskussionen der letzten Wochen und Monate, (...), schält sich einwandfrei die bange Frage heraus, ob denn der deutsche Bauer, ob im engeren Sinne der schleswig-holsteinische Bauer mit Struktur und Wirtschaftsmethode, im neuen größeren Raum wird bestehen können, und ob die Weichen für die Fahrt seines Zuges richtig gestellt sind. Mit kurzem Wort: haben wir Chancen, und wo liegen diese?«1
Diese Frage stellt sich Ende 1957 Bauer Hansen jun. aus Ausacker. Der praktizierende Landwirt aus dem Kreis Flensburg-Land schreibt von »Sorgen« und »bangen Fragen« und von einem »entscheidenden Problem«, das auf die schleswig-holsteinischen Bauern in naher Zukunft zukomme. Von »Europa« ist in seiner Leserzuschrift die Rede und von einem größeren Raum, in dem die Landwirtschaft fortan zu bestehen habe.
Hansens Leserbrief erscheint in der Weihnachtsausgabe des »Bauernblattes« im Dezember 1957, am Vorabend der Einführung des Gemeinsamen europäischen Agrarmarktes, der mit der EWG-Agrarministerkonferenz der sechs Mitgliedstaaten Frankreich, Italien, Deutschland und den Benelux-Ländern in Stresa im Juli 1958 seinen Ursprung nimmt. Noch sind ganz konkrete Folgen und Auswirkungen der europäischen Integration auf dem Agrarsektor nicht absehbar, ihre praktischen Konsequenzen für die »heimische« Landwirtschaft nur zu vermuten. Nicht nur dem »einfachen Landwirt«, auch Experten aus Politik und Wissenschaft erscheint die junge Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zu diesem Zeitpunkt wie ein Buch mit sieben Siegeln. Und dennoch: Hier schreibt ein Landwirt, der sich Gedanken macht um seine Zukunft, der über den Tellerrand seines eigenen Betriebes hinausblickt, das politische Geschehen wahrnimmt und aufmerksam verfolgt, der sich die Mühe macht, abends aus dem Stall kommend einen Brief aufzusetzen, um nach Chancen der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft im künftigen Gemeinsamen Markt zu fragen.
Eine Antwort auf Hansens Zuschrift folgt prompt. Mit der nächsten Ausgabe des Bauernblattes im Januar 1958 meldet sich Landwirt Matthias Haidn aus Falshöft in einem Leserbrief zu Wort. Er argumentiert:
»Die bange Frage nach der Zukunft unserer Landwirtschaft im Gemeinsamen Markt wird nicht nur von Saboteuren gestellt, sondern von der berechtigten Sorge um unsere Höfe und um unsere Existenz. Man braucht kein Prophet zu sein, um an Hand von Tatsachen die künftige Entwicklung verhältnismäßig klar ablesen zu können.«2
Ganz pragmatisch am Beispiel des künftigen Getreidepreises erörtert Haidn weiter:
»Die Getreidewirtschaft bildet die Achse, um die sich letzten Endes die landwirtschaftliche Preispolitik dreht. Auch hier werden schwere Spannungen nicht vermeidbar sein. So liegt bei uns der Erzeugerpreis bei Schweinen in den letzten 3 Jahren bei 120,– DM je Zentner und in Holland bei 80,– DM. Es ist nicht zu erwarten, daß die übrigen Mitgliedstaaten ihr niedriges Futtergetreideniveau dem deutschen angleichen. Die Rückschläge, selbst bei teilweiser Angleichung, auf die Erlöse bei Schweinen, Kartoffeln, Roggen, der in den übrigen Mitgliedstaaten nur Futtergetreide ist, müssen mit bangen Erwartungen erfüllen.«3
Landwirt Haidn aus Nieby an der Ostsee steht der Schaffung des Gemeinsamen Marktes skeptisch gegenüber. Er spricht ebenfalls von »bangen Erwartungen«, fürchtet er doch ein Absinken der deutschen Erzeugerpreise in Folge einer EWG-weiten Preisangleichung auf dem Getreidemarkt.
Die beiden ausgewählten Lesermeinungen der Landwirte Hansen und Haidn gegen Ende der 1950er Jahre machen deutlich: Beide Landwirte blicken interessiert, jedoch mit einer gewissen Besorgnis auf den künftigen europäischen Agrarmarkt, dessen konkrete Auswirkungen sich noch nicht abschätzen lassen. Auch Existenzängste schwingen mit, denn für die Betroffenen scheint klar, dass die Einbettung der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft in einen größeren Markt für sie weitreichende Konsequenzen wie instabile Preise oder einen erhöhten Konkurrenzdruck mit sich bringen wird. Tatsächlich wird die Schaffung des Gemeinsamen Marktes ab 1958 eine vollkommen neue Phase der Agrarwirtschaft einleiten, die nicht mehr ausschließlich in engen nationalstaatlichen, sondern fortan in europäischen Bahnen verläuft4 und eine fundamentale Umstrukturierung der gesamten europäischen wie regionalen Land- und Ernährungswirtschaft fördert. Etabliert wird mit der GAP eine Politik, die ihren Produzenten einerseits durch eine einheitliche Zollmauer ein hohes Maß an Außenschutz vor preisdrückenden Einfuhren aus Drittstaaten gewährt, die europäischen Erzeuger somit vor freiem Wettbewerb auf dem Weltmarkt abschirmt, die andererseits jedoch durch Abschaffung der Binnenzölle die Konkurrenz zwischen den Staaten des europäischen Marktes intensiviert und die nationalen Agrarwirtschaften zu immer stärkeren Anpassungsvorgängen zwingt.
Vor allem die im Zuge von 1955 verabschiedetem Landwirtschaftsgesetz und Grünen Plänen gut protegierte bundesdeutsche Landwirtschaft erhält mit der Schaffung des Gemeinsamen Marktes 1958 fast kontinuierlich Modernisierungsimpulse. Viele Landwirte geraten in die Entscheidungssituation, den eigenen Betrieb erhöhten Marktanforderungen anzupassen, sprich aufzustocken, oder auf außerlandwirtschaftliche Einkommensbereiche auszuweichen,5 eine Alternative, die sich in Schleswig-Holstein aufgrund der besonderen Wirtschaftsstruktur und den fehlenden Beschäftigungsmöglichkeiten in Industrie oder Gewerbe nur wenigen Landwirten stellt. Gleichwohl bleibt vielen nur die Möglichkeit aufzugeben, den Hof zu verpachten und ohne Nachfolger in den Ruhestand zu treten, wofür sich zwischen 1949 und 1999 auch nahezu 40.000 Betriebsinhaber entscheiden.6
Hofaufgaben, Abwanderungen aus der Landwirtschaft in andere Arbeitszweige oder betriebliche Umstrukturierungen wie Spezialisierungen und Konzentration der Produktion beschreiben Phänomene landwirtschaftlichen Strukturwandels. Die Ursachen, die diesen Wandel bedingen, sind dabei stets vielfältig: Neben rein wirtschaftlichen Faktoren, wie dem erwähnten Angebot an außerlandwirtschaftlichen Arbeitsplätzen innerhalb einer Region oder dem ständig stattfindenden technischen Fortschritt können auch vielfältige gesellschaftliche und kulturelle Ursachen als Auslöser und Motoren für landwirtschaftlichen Strukturwandel identifiziert werden. Die häufig ungelöste Hofnachfolge, die Innovationsbereitschaft einer Generation oder eine tiefe kulturelle Verwurzelung mit dem eigenen Betrieb, der trotz langjähriger Unrentabilität einfach nicht aufgegeben werden will, bedingen Tempo und Intensität des Wandels. Strukturwandel in der Landwirtschaft folgt insgesamt eigenen Gesetzmäßigkeiten, lässt sich als multifaktorielles Geschehen begreifen.
Neben den ganz unterschiedlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Einflüssen stellt sich immer auch die Frage nach dem Einfluss von Agrarpolitik oder Politik überhaupt auf Verlauf und Ausgestaltung des Strukturwandels. Denn insbesondere der Agrarpolitik wird oftmals die Rolle des Urhebers und Antreibers von Wandlungsprozessen zugeschrieben.7 Gerade im Sektor Landwirtschaft, in welchem die Gesetze des Marktes mit den ersten Marktordnungen außer Kraft gesetzt, Preise und damit Einkommen politisch festgelegt wurden, wird Strukturwandel von beteiligten Akteuren nicht selten als passiv erduldeter Vorgang empfunden. Strukturwandel würde vielfach als »von oben« verordnet, »an Schreibtischen berechnet«, von Bürokraten »beschlossen« oder als »politisches Konzept« wahrgenommen und diskutiert,8 so der Historiker Gunter Mahlerwein.
Obgleich die oben beschriebenen vielfältigen Einflussfaktoren auf Strukturwandel vermuten lassen, dass die landwirtschaftliche Bevölkerung dem Wandel keineswegs ohnmächtig gegenüberstand, sondern diesen stets mitgeprägt hat,9 begreifen sich viele Landwirte als Opfer agrarpolitischen Handelns, suchen in Politik meist die primären Ursachen zur Erklärung einschneidender und für sie schmerzhafter Entwicklungsprozesse.
Mein Dissertationsvorhaben, auf das ich im vorliegenden Beitrag einen Ausblick geben möchte, widmet sich in erster Linie den Wahrnehmungs- und Reaktionsmustern der schleswig-holsteinischen Landwirte auf eben jenen strukturellen Wandel, der, so die vorläufige These, mit Etablierung der Gemeinsamen europäischen Agrarpolitik in den 1960er Jahren in eine beschleunigte Phase zugunsten wachsender Betriebseinheiten10 eintrat. Im forcierten Konkurrenzkampf um Absatz und Marktchancen konnten, nach bisheriger Vermutung, vor allem mit Beginn der 1970er Jahre vermehrt gut strukturierte, kapitalkräftige und zukunftsfähige Wachstumsbetriebe bestehen, während sich die Ertragslage kleinerer, ungenügend spezialisierter Bet...