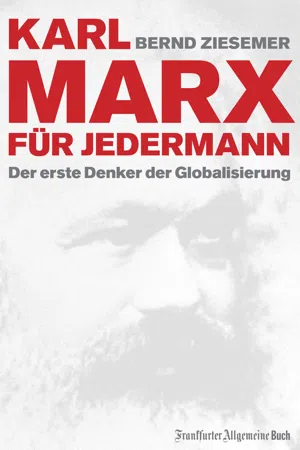![]()
TEIL I
DAS LEBEN EINES REVOLUTIONÄRS
![]()
1 DREI LEBEN IN EINEM
„Das bestätigt leider nur sehr die Meinung,
welche ich trotz Deiner mancher guten Eigenschaften hege,
dass der Egoismus in Deinem Herzen vorherrschend ist.“
Heinrich Marx am 8.11.1835 an seinen Sohn Karl
Dialektik einer Persönlichkeit
Karl Marx wollte vor allem anderen eines: die sozialen und politischen Verhältnisse seiner Zeit umstürzen. Sein ganzes Selbstbewusstsein wurzelte in seiner Geschichtsphilosophie, lange bevor er nach den Gesetzen der Ökonomie suchte. Revolutionär, Philosoph, Ökonom – Karl Marx lebte mindestens drei Leben in einem. Doch diese drei Stränge seines Lebens entwickelten sich weder gleichzeitig, noch waren sie für ihn selbst gleich zu gewichten.
Karl Marx war Revolutionär, bevor er Geschichtsphilosoph wurde – und Geschichtsphilosoph, bevor er sich in einen Ökonomen verwandelte. Und sein engster, ja sein einziger wirklicher Freund, Friedrich Engels, schrieb unmittelbar nach seinem Tode 1883 völlig zu Recht über ihn: „Denn Marx war vor allem Revolutionär. Mitzuwirken, in dieser oder jener Weise, am Sturz der kapitalistischen Gesellschaft und der durch sie geschaffenen Staatseinrichtungen, mitzuwirken an der Befreiung des modernen Proletariats, dem er zuerst das Bewusstsein seiner eigenen Lage und seiner Bedürfnisse, das Bewusstsein der Bedingungen seiner Emanzipation gegeben hatte – das war sein wirklicher Lebensberuf. Der Kampf war sein Element.“
Aus dem Dreiklang seines Lebens – Politik, Philosophie und Ökonomie – entstand sein epochales Werk, und entstanden zugleich die vielen großen Widersprüche eben dieser Lebensleistung. Der Revolutionär Marx wollte den Sozialismus zur Wissenschaft machen, aber machte damit zugleich seine Wissenschaft zur Magd seiner sozialistischen Politik. Seine teleologische Geschichtsphilosophie durchdrang sein gesamtes ökonomisches Werk – in der Regel nicht zu dessen Nutzen. Und aus dem allgemeinen Gesetz der Hegelschen Dialektik, aus der stetigen Negation der Negation, nicht aus der Ökonomie selbst, speiste sich letztlich seine zentrale Idee vom unvermeidlichen Übergang des Kapitalismus zum Sozialismus und Kommunismus. In der Ökonomie suchte er nur die praktischen Beweise für seine große philosophische Gewissheit.
Und wie sein Werk, so entwickelte sich auch die ganze Persönlichkeit des Dr. Karl Marx schon in jungen Jahren als eine einzige merkwürdige Vereinigung von Widersprüchen: getaufter Jude und Antisemit, Privatgelehrter und Feuerkopf, Bohemien und Geheimbündler, Verschwender und Bettler, liebender Familienvater und eitler Einzelgänger, Vorkämpfer und Verächter des Proletariats, Neidhammel und Großherz, ein Bewunderer des Kapitalismus und zugleich sein schärfster Kritiker, ein Meister des großen Wurfs und der kleingeistigen Intrige, begnadeter Polemiker und dröger Scholastiker, Romantiker und Materialist, einer der größten Stilisten der deutschen Sprache und einer ihrer peinlichsten Verdreher, öffentlicher Sozialist und privater Bourgeois, Rebell und Rentier, ewiger Deutscher und entwurzelter Emigrant, ein Mann des Worts und ein Mann der Tat.
Doch trotz all dieser Widersprüche war Marx vor allem eines: ein geistiger Gigant, dessen Einfluss in gewisser Weise bis heute weltweit fortwirkt. Wie schrieb doch der britische Marxist Terry Eagleton zu Recht: „Nur sehr wenige Denker haben den Lauf der Geschichte so entscheidend verändert wie der Autor des ‚Kapitals‘. Es gibt keine Karthesianischen Regierungen, Platonistische Guerillakämpfer oder Hegelianische Gewerkschaften. Nicht einmal die hartnäckigsten Kritiker Marx’ können leugnen, dass er unser Verständnis der menschlichen Geschichte verwandelt hat.“
Die Familie in Trier
Und alles begann in der Kleinstadt Trier an der Mosel, die Anfang des 19. Jahrhunderts gerade einmal zehntausend Einwohner zählte. Am 5. Mai 1818 erblickte dort Karl Heinrich Marx als zweites von neun Kindern des Rechtsanwalts Heinrich Marx und seiner Frau Henriette das Licht der Welt. Eine geordnete Familie – wohlsituiert, aber nicht reich; arbeitsam und rheinisch liberal. Geistig herrschte in dieser Familie das Ideal einer ganz klassischen deutschen Bildung, politisch jedoch die typische Atmosphäre der nachnapoleonischen Zeit, in der die Ideale von 1789 noch etwas bedeuteten. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – darauf konnte man sich auch in der Familie Marx im Zweifel ehrlichen Herzens besinnen.
Karls Mutter stammte aus einer leidlich wohlhabenden Familie in den Niederlanden. Ihre Schwester Sophie heiratete den reichen Fabrikanten Lion Philips, der mit seinen Nachkommen den Grundstein für den heutigen Weltkonzern gleichen Namens legte. Für den erwachsenen Karl Marx, der in ständigen Geldnöten steckte, wurde der Onkel im fernen Gelderland zum harten Verhandlungspartner um das Erbe seiner Mutter. Henriette Marx hatte ihren Schwager Lion als Testamentsvollstrecker eingesetzt – und ihr Sohn bemühte sich schon vor ihrem Tode immer wieder mit Briefen und persönlichen Besuchen in den Niederlanden, einen Teil des zu erwartenden Geldes vorzeitig loszueisen. Doch meist scheiterten seine Bemühungen an der Hartnäckigkeit von Onkel Lion.
Sein Vater Heinrich Marx stammte aus einer alteingesessenen Familie von Rabbinern und war erst kurz vor der Geburt seines Stammhalters Karl zum Protestantismus konvertiert. Dabei ging es nicht um Religion, sondern seine bürgerliche Existenz: Unter napoleonischer Herrschaft war Heinrich Marx zum Justizrat in Trier ernannt worden. Um sein Amt auch unter preußischer Oberhoheit behalten zu können, musste der Jude seinen Glauben aufgeben. Erst im August 1824 wurden auch seine Kinder formlos in der elterlichen Wohnung getauft. Henriette Marx trat erst viel später zum Christentum über: Erst als ihr Vater gestorben war und sie nicht mehr den Zorn ihrer jüdischen Verwandten in Holland fürchten musste. Nach allem, was wir wissen, spielte Religion danach in der aufgeklärten Familie des Advokaten Heinrich Marx keine große Rolle mehr.
Karl Marx selbst hat sich niemals zu dem opportunistischen Religionswechsel seines Vaters geäußert. „Auch wenn Karl Marx zeitlebens vom Judentum nichts wissen wollte, bleibt es dennoch verwunderlich, dass er sich nicht mit dessen Kultur und Geschichte beschäftigte, nicht einmal das Alte Testament genauer kannte und im Briefwechsel mit Engels mit antisemitischen Sprüchen nicht hinter dem Berg hielt“, schreibt sein Biograf Klaus Körner in seiner 2008 erschienen Monografie. Juden waren für Marx immer die anderen – auch wenn sie, wie er selbst, längst getauft waren. In seinem privaten Briefwechsel belegte er fast alle Juden, die ihm irgendwo in die Quere kamen, mit unflätigen Beschimpfungen. Den Sozialisten Ferdinand Lassalle, der mit Marx um die Führung der jungen deutschen Arbeiterbewegung wetteiferte, qualifizierte er in seiner Korrespondenz nahezu durchgängig als „Jüdlein“ oder „jüdischen Nigger“ ab.
Zu einer der größten Merkwürdigkeiten seiner frühen geistigen Entwicklung gehört die Tatsache, dass sich Marx offenkundig und ostentativ nicht für das Judentum interessierte – ihm aber trotzdem eine seiner allerersten Veröffentlichungen widmete. Mit gerade einmal 25 Jahren verfasste er den Aufsatz „Zur Judenfrage“, der im Herbst 1843 herauskam. Seit Jahrzehnten tobt unter Fachhistorikern und unter Marxisten der Streit, ob man den im strengen Hegelianischen Ton verfassten Text als antisemitisch bezeichnen muss oder nicht.
Eigentlich will Marx mit seinem Aufsatz nur nachweisen, dass die Forderung nach einer vollständigen Emanzipation der benachteiligten Juden in der bürgerlichen Gesellschaft schon deshalb unsinnig sei, weil auch die Mehrheit der Bevölkerung über keine wirkliche Freiheit verfüge. Erst wenn die vollständige Trennung von Staat und Religion überhaupt erfolgt sei, könne man über die Gleichberechtigung der Juden reden. Doch Marx versteigt sich in seinem materialistischen Wahn, den jüdischen Glauben aus dem Dasein des „Alltagsjuden“ erklären zu wollen, in eine dialektische Phraseologie, die man wohl tatsächlich nur als antisemitisch bezeichnen kann: „Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welcher ist sein weltlicher Gott? Das Geld.“ Das Geld sei der „eifrigste Gott Israels“, schreibt Marx weiter. Und dieser Gott der Juden habe sich „verweltlicht“ und sei gleichzeitig zum „Weltgott“ geworden. In Nordamerika könne man längst sehen, dass die „praktische Herrschaft des Judentums über die christliche Welt“ verwirklicht sei.
Trotz dieser Entgleisungen kann man die These, Marx habe durch die Zwangstaufe als Kind gelitten und seine demütigenden Erfahrungen als jugendlicher Konvertit möglicherweise in seinem späterem Leben durch eine antisemitische Haltung überkompensiert, getrost bezweifeln. Sein großer und nach wie vor grundlegender Biograf Richard Friedenthal schrieb 1981 treffend: „Marx hat an Selbsthass, ob jüdischem oder sonstigem, weniger gelitten als irgendein anderer bedeutender Mensch. Man kann ihm übertriebene Selbstgefälligkeit zuschreiben, er hat nie an sich auch nur im geringsten gezweifelt, nie auch nur die kleinste Kritik an sich geübt oder hingenommen und nie auch seine Abstammung von langen Rabbinerreihen bis weit hinein ins 16. Jahrhundert als Belastung empfunden; er hat sie einfach nicht erwähnt.“
Im erzkatholischen Trier blieb Marx aber selbst als Protestant Angehöriger einer verschwindenden Minderheit in der Stadt. Obwohl geachtet, integrierte sich seine Familie nur wenig in das konservative Bürgertum. Am Gymnasium fand sich für Karl, zumindest nach den spärlichen Hinweisen seiner Biografen, offenbar nur ein sehr kleiner Zirkel von Freunden. Der wichtigste Kamerad dieser Jahre war Edgar von Westphalen, mit dem gemeinsam er auch sein Abitur ablegte (beide mit mäßig gutem Notendurchschnitt). Marx ging im Haus seines Freundes ein und aus und wurde zum Bewunderer dessen Vaters, des liberalen preußischen Regierungsrats Ludwig von Westphalen. Lange Gespräche bei Spaziergängen mit ihm waren ein Bildungserlebnis, ja ein Erweckungserlebnis für den jungen Marx. Man sprach jedoch nicht über Politik, sondern über Philosophie und schöne Künste. Bald fühlte sich der junge Marx bei den Westphalens wohler als in der eigenen Familie.
Schließlich verliebte sich Karl auch noch in die Schwester Edgars, Johanna (genannt Jenny). 1836 verlobten sich die beiden in Trier, aus Geldmangel konnten sie aber erst sieben Jahre später heiraten. Bis zu ihrem Tode 1881 (zwei Jahre vor Marx’ Tod) teilten die beiden stetig abwechselnde Phasen bitterster Not und plötzlichen verschwenderischen Reichtums. Jenny Marx wurde zur wichtigen Mitarbeiterin ihres Mannes und übertrug die fast unleserliche Handschrift seiner Buchmanuskripte ins Reine. Sie lebte an seiner Seite gezwungenermaßen das unstetige Leben einer Revolutionärin, blieb aber immer stolz auf ihre hohe Herkunft. Bei ihrer Ankunft im englischen Exil ließ sie sich sogleich Visitenkarten drucken mit der Aufschrift: „Mrs. Karl Marx, née Baroness Jenny von Westphalen“. Die Erbstücke ihrer Vorfahren aus dem schottischen Hochadel wanderten zwar immer wieder ins Pfandhaus, um Geld zu beschaffen. Doch Jenny Marx legte größten Wert darauf, sie auch immer wieder auszulösen, sobald etwas Honorar in der Haushaltskasse klingelte.
Die Heirat mit Jenny von Westphalen bescherte der Weltgeschichte einen ironischen Aperçu, wie er so typisch ist für das ganze Leben Marx’: Der Halbbruder Jennys, Ferdinand von Westphalen, hetzte seinem Schwager Karl 1850 als preußischer Innenminister die Geheimpolizei auf den Hals. Der Erzkonservative galt streckenweise als einer der prominentesten Widersacher der sozialistischen Arbeiterbewegung in Deutschland. Die revolutionären Umtriebe seines Schwagers missbilligte Ferdinand von Westphalen auf das Schärfste. Und noch mehr verachtete er Karl Marx für das Elend, in das er seine Halbschwester nach der Heirat stürzte. Den Bruder Edgar, der sich ebenfalls der sozialistischen Sache verschrieben hatte und niemals ein bürgerliches Auskommen fand, unterstützte er gelegentlich mit etwas Geld. Gegenüber den Bettelbriefen der Familie Marx, die immer mal wieder bei ihm eintrafen, blieb er dagegen bis zum bitteren Ende hart.
Bonn und Berlin: Die Studentenzeit
So akribisch Wissenschaftler und Marxologen auch das Leben Marx’ durchforscht haben, letztlich konnten sie das große Rätsel seines Lebens nicht lösen: Wir wissen nicht, wann genau und vor allem warum der junge Mann aus bürgerlichen Hause zu einem Revolutionär wurde. Wieso verwandelte sich der Gedichte schreibende Liebling der Familie Marx, der von seinen Schwestern verhätschelt und von seinem Vater mit einem fürstlichen Stipendium ausgestattet worden war, in seinen Universitätsjahren mit schnellen Schritten in einen notorischen Staatsfeind und geschworenen Umstürzler? Als Karl 1835 ganz nach dem Willen des Vaters sein Studium der Jurisprudenz und Kameralistik an der nicht allzu weit entfernten Universität Bonn aufnahm, müssen wir uns ihn als klassisch gebildeten, hochbegabten, überaus wissbegierigen und brandehrgeizigen Jüngling mit vielen Talenten und ohne klares Ziel vorstellen. Ziemlich verzogen und äußerst selbstbewusst für sein Alter, aber nicht wirklich aufsässig oder gar politisch rebellisch. Zunächst besuchte er brav die juristischen Vorlesungen, die sein besorgter Vater ihm mit großer Akribie ausgesucht und angeraten hatte. Sehr viel mehr wissen wir über seine beiden ersten Semester in Bonn nicht.
Natürlich gärte es seit dem Hambacher Fest im Mai 1832 an allen deutschen Hochschulen. Die Forderungen nach nationaler Einigung, bürgerlicher Freiheit und Demokratie gingen unter den Studenten um. Aber der preußische Staat kontrollierte die Universitäten stärker denn je. Und die Universität Bonn war damals gewiss nicht als besonders fortschrittlich bekannt. Ob sich Marx überhaupt den Unruhestiftern einer deutschnationalen Studentenverbindung angeschlossen hatte, zum Beispiel der „Landsmannschaft der Treveraner“ (Trierer), wissen wir nicht. Einiges spricht aber dafür. Aktenkundig wird der Studiosus an der Universität Bonn nur ein einziges Mal: Weil die Behörden den jungen Marx nach einem Kneipenbesuch mit einem Säbel in der Hand aufgreifen, eröffnet die Universitätsleitung ein förmliches Verfahren gegen ihn. Das Tragen von Waffen ist Studenten untersagt. Doch ehe Marx für seine Untat (wahrscheinlich eher ein Studentenulk als ein früher Ausweis rebellischer Gesinnung) zur Rechenschaft gezogen werden konnte, wechselte er bereits an die Universität Berlin.
Schon in Bonn war der Kontakt zum Elternhaus gestört, nun riss er wochenlang völlig ab – und Heinrich Marx beklagte sich bitterlich über den „Egoismus im Herzen“ seines Sohnes. Eigentlich geht es Karl jetzt in seinen Briefen an Vater und Mutter nur noch darum, immer neue Geldforderungen zu stellen und sich ansonsten lästige Fragen über sein Studium vom Halse zu halten. An der Universität Berlin, wo sich der junge Marx am 22. Oktober 1836 immatrikulierte, verlor sich das Interesse an der Jurisprudenz schnell, die seinem Vater doch so am Herzen lag. Stattdessen schoben sich Philosophie und Geschichtswissenschaft, die seinem Vater als brotlose Kunst galten, für Karl ganz in den Vordergrund. Aus ihnen leitete der junge Marx eine immer radikalere Kritik am preußischen Staat und an der christlichen Religion ab, auf die sich der König in seinem Gottesgnadentum berief. Er verstand sich spätestens jetzt als radikaler Demokrat und Freigeist.
Marx geriet in diesen Monaten unter den Einfluss der sogenannten Linkshegelianer, die aus dem Werk des preußischen Staatsphilosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel ganz andere Schlussfolgerungen zogen als die Althegelianer. Der erste Kontakt mit der Philosophie Hegels kam offenbar über die Vorlesungen des Berliner Professors Eduard Gans zustande, bei dem Marx Kriminalrecht und Preußisches Landrecht hörte. Der Student schreibt lange Passagen der Vorlesungen mit und exzerpiert Hunderte Seiten aus einschlägigen Büchern – eine Praxis, die Marx Zeit seines Lebens beibehalten sollte. Sein Biograf Körner rechnete aus, dass zwei Drittel seines schriftlichen Nachlasses (und damit auch ein Großteil seiner vierzigbändigen Gesamtausgabe) aus Exzerpten und Entwürfen bestehen.
Über Professor Gans rutschte Marx in einen Debattierzirkel von Linkshegelianern hinein, die bei reichlich Wein und Bier über Gott und die Welt schwadronierten. Dazu gehörten der Theologiedozent Bruno Bauer, der Historiker Karl Friedrich Köppen und der Geografielehrer Adolf Friedrich Rutenberg. Seit dem Tod Hegels im Jahr 1831 rangen sie mit den orthodoxen Anhängern des Philosophen um die richtige Deutung seines Werks. Während Hegel und seine direkten Epigonen in dem preußischen Staat die höchste Verkörperung des Weltgeistes und eine sittliche Idee erster Güte erblickten, wandten die Linkshegelianer die Dialektik ihres Meisters gegen die herrschenden Verhältnisse. Die von ihm beschworene geschichtliche Spirale der „Negation der Negation“ sollte sich fortdrehen – und den preußischen Staat durch eine freiheitliche Demokratie „aufheben“, wie es im Jargon der Philosophen hieß. Der Kreis um Marx arbeitete sich vor allem an der lutherischen Staatsreligion Preußens ab, die ihrer Meinung nach im direkten Gegensatz zu den Vernunftgeboten Hegels stand.
Es waren weniger ihre philosophischen Verrenkungen an sich, die viele Junghegelianer in Konflikt mit der preußischen Zensur und den Polizeibehörden brachten, sondern ihre Religionsfeindlichkeit. Die meisten jungen Dozenten scheiterten deshalb mit dem Versuch, eine akademische Karriere an preußischen Universitäten zu begründen. Auch Marx lieferte zwar eine hastig zusammengestoppelte Doktorarbeit zur „Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie ab“, die ihm 1841 ohne Rigorosum und ohne jeden Besuch vor Ort eine etwas zweifelhafte Promotion der Universität Jena eintrug. Doch auf eine akademische Laufbahn konnte er sich zu diesem Zeitpunkt schon keine Hoffnung mehr machen, nachdem seine Freunde und Förderer aus dem Debattierzirkel in Berlin selbst auf heftige Widerstände an ihren Universitäten stießen. Der Versuch seines damaligen Freundes (und späteren Widersachers) Bruno Bauer, Marx eine Dozentenstelle zu verschaffen, scheiterte schon im Ansatz. Nach sechs Jahren Studium hatte sich Marx zwar unter den Berliner Junghegelianern einen Ruf wie Donnerhall verschafft, stand beruflich jedoch vor dem Nichts.
Auch wenn kein Lehrstuhl für Philosophie winkte, verstand sich Marx von nun an jedoch als Philosoph. Was immer er in den folgenden Jahrzehnten auch schrieb, bemühte sich um den dialektischen Jargon Hegels. Zugleich zeigte sich bereits in seiner Doktorarbeit ein Zug, der ihn sein ganzes Leben begleiten sollte: „Schon der junge Marx nimmt als Philosoph entschieden Partei für Epikur als den Dogmatiker und damit für den Dogmatismus überhaupt“, schreibt sein Biograf Richard Friedenthal: „Das einmal Gefundene steht sogleich ein für alle Male bei ihm fest; es kann sich fortan nur darum handeln, dafür ‚Beweise‘ nachzuholen. Was sich nicht in diese Beweisführung einfügen lässt, wird ignoriert oder bekämpft.“ Auch sein ökonomisches Werk krankte später an dieser Haltung.
Marx verstand seine Philosophie Zeit seines Lebens nicht als Beschäftigung für den universitären Elfenbeinturm, sondern als praktische Waffe zur Umgestaltung der vorherrschenden Verhältnisse. 1843, zwei Jahre nach seinem Abschied von der Universität, schrieb er in seiner „Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie“ die programmatischen Worte: „Wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen.“ Und 1845 formulierte Marx seine berühmte 11. These über den materialistischen Philosophen Ludwig Feuerbach: „Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kömmt darauf an, sie zu verändern.“
Man kann getrost davon ausgehen, dass sich diese Erkenntnis jedoch schon bei seinem Abschied von der Berliner Universität in seinem Kopf festgesetzt hatte, auch wenn er sie erst einige Jahre später schlüssig theoretisch formulierte. Seine Philosophie sollte, ja musste sich in der Praxis beweisen, wenn sie wahr sein wollte. Doch zunächst fehlte dem revolutionären Geschichtsphilosophen noch die revolutionäre Praxis, um diesen theoretischen Anspruch auch einzulösen. Doch das sollte sich viel schneller ändern, als Marx selbst bei seinem eher unrühmlichen Abschied von der Universität wohl vermutet hatte.
Als Chefredak...