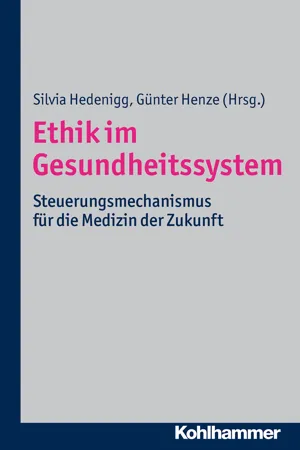![]()
Teil II
Ethik in der Medizin
![]()
1 Ethik in der Medizin – aus der Sicht eines Psychiaters
Klaus Dörner
1 Einleitung: »Ethisierung« als Phänomen einer neuen Epoche?
In »Der gute Arzt« (Dörner 2003) habe ich beschrieben, wie praktische Medizin zunächst in einer Beziehung aus mindestens drei Menschen besteht, woraus sich das Handeln der Medizin entwickelt. Medizin ist also erst einmal eine Beziehungswissenschaft, also human- oder geisteswissenschaftlich, bevor sie auch angewandte Naturwissenschaft wird. So sehr jede Beziehung von einer Haltung geprägt ist, in der Tugenden zum Ausdruck kommen, gibt es im Übergang von der Beziehung zum Handeln einen Schnittmengenbereich, wo es um Entscheidungen und Wahlen geht. Diese muss ich vor mir und vor Anderen begründen, wobei ich mich auf mein Menschen- und Weltbild und die sich daraus ergebenden handlungsleitenden Normen stütze. Das Ergebnis ist eine Moral, sowohl individuell für mich als auch kollektiv für alle Ärzte, was zu formulieren Aufgabe der Selbstverwaltung (Ärztekammer) ist. Es geht dabei um die Klärung: Wozu bin ich verpflichtet, was ist mir erlaubt und was ist mir verboten?
Nun wechseln die Epochen und mit ihnen ihre Moralvorstellungen. Ich spüre, wie die mich bisher tragende Moral an Glaubwürdigkeit verliert, weil die soziale, auch technische Wirklichkeit sich weiterentwickelt hat. Und erst das ist die Stunde des ethischen Nachdenkens im engeren Sinne. Ich muss solange nach neuen ethischen Gründen suchen, die besser zur neuen Wirklichkeit passen, bis ich einen Kanon von jetzt wieder passenden Normen gefunden habe, die mich eine kürzere oder längere Zeit – als neue Moral – tragen und mich dadurch von der handlungslähmenden ethischen Denkanstrengung zeitweilig entlasten. Aber selbst dann bleibt mir immer noch die Mühe zu klären, ob die gefundenen Moralvorstellungen auch der konkreten Situation jedes einmaligen Individuums gerecht werden. Das also ist der Fall, wo Foucault die Frage stellt, ob ich auch anders denken kann oder gar muss, als ich denke.
Wenn wir jetzt hinzudenken, dass Heinz von Foerster mit seiner »Kybernethik« den Fall diskutiert, dass Ethik als ein Sensor das Gesundheitssystem steuert, dann wissen wir jetzt schon, dass Ethik je nach der historischen Epoche ganz unterschiedlichen Normen folgen kann. So können wir zum Beispiel rein empirisch ab 1980 sowohl einen Boom der Marktradikalisierung als auch einen Boom der »Ethisierung« der Medizin registrieren. Diese merkwürdige Gleichzeitigkeit lässt sich allerdings in mehreren Richtungen interpretieren: Spricht sie dafür, dass die Risiken der Marktradikalisierung für kranke Menschen wohltuend durch mehr Aufmerksamkeit für Ethik in der Medizin gemildert werden? Oder stellt der Ethik-Boom – inhaltlich – nur die ideelle Verstärkung der Marktradikalisierung dar, weil beide Ebenen von ähnlichen Normen gesteuert sind, nämlich vom Menschenbild des isolierten Individuums, vom Lebensziel der unendlichen Mehrung der Selbstbestimmung und vom methodischen Ideal des Wachstums, der Expansion, wozu dann freilich auch von Foersters kategorischer Imperativ der unendlichen Erweiterung der Wahlmöglichkeiten gehören würde.
Oder – und das bewegt mich zurzeit besonders – könnte es sein, dass wir aus der uns vertrauten Wirklichkeit der marktgesteuerten Industrie-Gesellschaft schon in eine neue Epoche aufgebrochen sind, etwa in die Dienstleistungs-Gesellschaft, für deren neue Strukturen und moralische Normen wir aber noch keinen Begriff gefunden haben, sodass wir die an sich schon überholten, aber uns geläufigen Menschenbild-Moralbegriffe fälschlich auf die entstehende neue gesellschaftliche Wirklichkeit anwenden, weil wir in der Schule nicht die neuen, sondern nur die alten Moralbegriffe gelernt haben. Foucaults Frage lautet also besonders für eine solche epochale Übergangszeit zu Recht: Kann ich anders denken, als ich denke?
Ich will mich daher im Folgenden auf die Prüfung dieser drei hypothetischen Interpretationen beschränken, ob nämlich der Unterschied zwischen Industrie-Gesellschaft (1830–1980) und Dienstleistungs-Gesellschaft (ab 1980) so durchschlagend ist, dass er nicht nur den Arbeitsmarkt betrifft, wie wir das täglich in der Zeitung lesen, sondern auch die Beziehungen im Medizin- und Gesundheitswesen, also im Bereich des Helfens und die damit zusammenhängenden Menschenbilder und Normen, sodass vielleicht aus früher mal gültigen Idealen inzwischen Ideologien geworden sind (dabei mache ich nur den kleinen Vorbehalt, dass niemand heute schon wissen kann, ob der Name für eine Gesellschaft, in die wir gerade erst hineinzuwachsen beginnen, mit »Dienstleistungs-Gesellschaft« angemessen gewählt ist).
2 Die Industrie-Gesellschaft und ihre Ethik
Zunächst also nun zur Industrie-Gesellschaft und zur Industrie-Ethik. Die Industrialisierung (oder Modernisierung oder Säkularisierung) der Gesellschaft bedeutete zunächst ökonomisch die Verlagerung der handwerklichen Produktion – im Glauben an die größere Effizienz wissenschaftlicher Rationalität – in möglichst große Institutionen, Fabriken, wo die serielle Produktionsweise größere Mengen an Produkten für mehr Menschen zu kleineren Preisen einen atemberaubenden, alle Menschen – mit Recht – faszinierenden Fortschritt garantierte.
Kein Wunder, dass alle fast wahngewiss daran glaubten, dass dieser eindimensional-technisch-wissenschaftliche Fortschritt sich von der Bearbeitung von Sachen auch auf die Bearbeitung von Menschen übertragen ließe, umso mehr, je größer – fabrikanalog – die Institution, hier also der Krankenhäuser, Anstalten und Heime, und je mehr man kranke Menschen auf Krankheiten und deren Bekämpfung versachlichte. Für die Dauer der Industrie-Gesellschaft bedeutete daher Fortschritt vor allem: »Stationär vor ambulant«; denn nur in möglichst großen Institutionen konnten die Methoden wissenschaftlicher Rationalität – wie etwa das kontrollierte Experiment – greifen, und wenn es auch – wie bei psychisch Kranken und Behinderten – lebenslang dauern sollte. Für das zum Greifen nahe Ziel, der Machbarkeit der leidensfreien Gesellschaft und des leidensfreien Individuums, nach dem Menschenbild des homo rationalis hygienicus und schließlich auch praeventicus (nämlich im Vorgriff auf eine paradiesische Zukunft) waren Opfer in Kauf zu nehmen.
Diese Opfer waren nun sehr verschiedenartig und konnten vor lauter Fortschrittsbegeisterung meist erst sehr viel später als solche wahrgenommen werden. So fiel etwa der Institutionalisierung, aber auch Professionalisierung des Helfens die menschheitsgeschichtlich bewährte soziale Infrastruktur zum Opfer: Zum einen die Familie, fürs schwerere Helfen jetzt überflüssig, vom Ort industrieller Arbeit räumlich getrennt und für die Erziehung durch die Schulpflicht ersetzt, galt sie zunehmend als vormodernes Auslaufmodell; die Nachbarschaft wurde fast ganz liquidiert; die Kirchengemeinden verrieten ihr oberstes biblisches Gebot der absoluten Einheit von Gottes- und Menschendienst und verkümmerten seither; die kommunale Selbstverwaltung verlor an Daseinsvorsorge; und der einzelne Bürger war jetzt mehr isoliertes Individuum als Beziehungswesen, genoss die Entlastung von der immer lästigen Sorge um Andere als Fortschritts-Freiheitsgewinn zur einseitigen Mehrung seiner Selbstbestimmung, sodass er zunehmend nicht mehr nur Herr über sein Leben, sondern auch über seinen Tod sein wollte.
Schließlich waren auch die psychisch Kranken, geistig und körperlich Behinderten und sonstigen chronisch Kranken trotz mancher realer Fortschritte unter dem Strich Opfer. Je mehr und dauerhafter sie aus ihrer Lebenswelt und ihrem Sozialraum herausgerissen, selektiert, nach Diagnosen homogenisiert und bis zu lebenslang in Institutionen konzentriert wurden, desto mehr waren sie in den Augen der Gesellschaft entwertet, weshalb die Gewalthemmschwelle gegen sie vor allem von Seiten der für sie verantwortlichen Profihelfer sinken musste. So nahm ab 1893 die Begeisterung der Ärzte zu, sie bei Therapieresistenz eugenisch-präventiv zu sterilisieren. Und im ersten Weltkrieg waren die kriegführenden Nationen so weit, alle institutionalisierten Menschen so lange einer Kalorienreduktion zu unterwerfen, bis die beabsichtigte »Übersterblichkeitsquote« erreicht war. In Deutschland waren das 70.000 erstmals staatlich organisierte Mordopfer – ohne Protest der für sie verantwortlichen Helfer oder der Kirchen, sodass die NS-Psychiater im Zweiten Weltkrieg nichts hinzuerfinden mussten, sondern sich auf ein durch die Industrie-Gesellschaft in einhundert Jahren gut etabliertes Umgangsmuster der Vernichtung der Leistungs-Minderwertigen und der die Produktion Störenden stützen konnten.
Damit ist zumindest in dieser Hinsicht das Paradigma der Industrie-Gesellschaft am Ende; denn die Entwertung von Leistungs-Minderwertigen und Störenden lässt sich über ihre Tötung hinaus nicht mehr steigern. Aber auch schon die Voraussetzung dazu, die massenhafte Institutionalisierung von Menschen war ein »Alleinstellungsmerkmal« der Industrie-Gesellschaft, hat es so systematisch – im Glauben an Wissenschaftsfortschritt und im Zwang zur Leistungssteigerung – in der ganzen Menschheitsgeschichte nie gegeben und wird es, so Gott will, auch künftig nicht mehr geben, zumindest dann nicht, wenn wir den Weg der Institutionalisierung als menschheitsgeschichtlich einmalige Sackgasse und Perversion erkennen. Das kann auch gar nicht anders sein; schon rein anthropologisch kann kein Mensch von sich aus in einer Institution (Anstalt, Heim) dauerhaft leben wollen.
Dabei können wir inzwischen empirisch ganz gut nachweisen (z. B. Burkhard Werner, Kath. Hochschule, Freiburg), dass mit der reinen Größe der Institution die Wahrscheinlichkeit der Personenentwertung der Bewohner, aber auch der Gesundheitsschädigung der dort stationär tätigen Profihelfer zunimmt. Und mit wie viel ehrlicher Begeisterung haben wir Profis und unsere Vorgänger an der Persönlichkeits-Entwertung der Leistungs-Minderwertigen und Störenden von 1830 bis 1980 und z.T. bis heute mitgearbeitet – mit aufsteigendem Verantwortungsgrad, umso mehr!
Und warum? Weil wir subjektiv wirklich glaubten, wir täten den psychisch Kranken und Behinderten etwas Gutes, wenn wir sie dem Regime des Wissenschafts-Fortschritts unterwerfen würden – dem großen Ziel der leidensfreien Menschheit zuliebe. Denn subjektiv ebenso ehrlich folgten wir der Ethik der (marktwirtschaftlichen) Industrie-Gesellschaft und ihrem Menschenbild des homo rationalis, hygienicus, praeventicus, also des isolierten Individuums, das, wissenschafts- und gesundheitsgläubig, die Vorsorge über die Fürsorge stellend, die Mehrung seiner Selbstbestimmung und die unendliche Steigerung seiner Leistungsfähigkeit als Lebensziel hat. Jemand ist umso mehr Mensch, je mehr er seine Leistungsfähigkeit steigert, und umso weniger Mensch, je leistungsminderwertiger und schließlich lebensunwerter er ist – auf einer nach oben und unten offenen Skala. Eine Ethik, die ökonomisch im Grunde nur der Logik des Wandels von der vormodernen Subsistenzwirtschaft zur expansionsorientierten kapitalistischen Marktwirtschaft entspricht.
3 Die Dienstleistungsgesellschaft und ihre Ethik
Nun stelle ich die Dienstleistungs-Gesellschaft und ihre Ethik nicht dagegen, sondern daneben; denn die Vorteile und Segnungen der Industrie-Gesellschaft sind so überwältigend, dass sich ihre Strukturen und Normen noch lange weiterentwickeln werden. Aber es tritt – so meine Hypothese – neben sie das neue epochale Großparadigma, vorerst Dienstleistungs-Gesellschaft genannt, strukturell und normativ z. T. durchaus gegenläufig, aber zumindest doch mit der Chance, die pathologischen Einseitigkeiten und bis zum Töten reichenden Extreme der Industrie-Gesellschaft auszugleichen, wenn wir die Kraft dazu haben; denn auch heute gilt wieder Foucaults Frage: Kann ich auch anders denken, als ich denke?
Zunächst leitet sich der Sinn des Begriffs »Dienstleistungs-Gesellschaft« ökonomisch u. a. davon ab, dass die industrielle Güterproduktion derart automatisiert ist, dass neue Arbeitsplätze überwiegend nur noch im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen zu schaffen sind, durchaus um den zwiespältigen Preis von deren Professionalisierung, aber kaum noch der Institutionalisierung; diese scheint vielmehr zum menschheitsgeschichtlichen Auslaufmodell zu werden, was für unser Thema von entscheidender Bedeutung ist.
Denn der Paukenschlag, mit dem der Beginn der Dienstleistungs-Gesellschaft um 1980 anzusetzen ist, besteht nicht zuletzt im demografischen Wandel und damit auch der Professionalisierung der intergenerativen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dies ist ironischerweise vor allem Folge des realen Fortschritts von Medizin und sozialer Sicherung in der Industrie-Gesellschaft, also der explosiven Zunahme der Alten, aber durchaus auch der körperlich chronisch Kranken. Daraus resultieren so viele strukturelle und normative Veränderungen, dass ich es für gerechtfertigt halte, sie als Symptome einer neuen Epoche der Dienstleistungsgesellschaft und ihrer Dienstleistungs-Ethik zu halten. Ich werde daher im Folgenden einige solcher Symptome auflisten und sie zur Diskussion stellen.
Zunächst bei dieser Symptomaufzählung ein paar Fakten, von denen wir einigermaßen gesichert ausgehen können.
- Wir wachsen in eine Gesellschaft hinein mit dem größten Hilfebedarf der Menschheitsgeschichte, so groß, dass er mit dem seit der Industrie-Gesellschaft gewohnten System der Profihelfer allein nicht mehr abzudecken ist; hier bedarf es vielmehr auch wieder der Bürger, obwohl diese doch gerade durch die Industriegesellschaft vom Helfen befreit worden waren.
- Mindestens so aufregend ist das Symptom, dass die Akzeptanz der Pflegeheime, noch vor vierzig Jahren als Würdigung für lebenslange Maloche im Sinne der Industrie-Ethik recht hoch, bis heute fast auf Null gefallen ist: Institution als Auslaufmodell. Die Menschen wollen Integration statt Institution, nehmen dafür auch Versorgungsnachteile in Kauf. Da aber, wie allen Insidern bekannt, nicht Profis, sondern nur Bürger andere Bürger auf Dauer und im Alltag integrieren können, brauchen wir künftig Bürgerhelfer nicht nur aus quantitativen, sondern auch aus qualitativen Gründen.
- Daraus ergibt sich eine Art normatives Leitsymptom für die Dienstleistungs-Gesellschaft: Während Fortschritt in der Industrie-Gesellschaft bedeutete, die Menschen zur Hilfe zu bringen (stationär vor ambulant), bedeutet Fortschritt heute in der Dienstleistungs-Gesellschaft umgekehrt, die Hilfen zu den Menschen zu bringen, und dies a) weil die Menschen es subjektiv wollen und gleichsinnig b) weil dies dank weiteren Fortschritts inzwischen auch technisch leichter möglich geworden ist (jetzt ambulant vor stationär).
- Und jetzt kommt ein Faktum-Symptom, das die meisten von Ihnen mir (obwohl am besten empirisch gesichert) nicht glauben können, weil die Medien immer noch aus der entgegengesetzten Optik der überholten Industrie-Gesellschaft wahrheitswidrig informieren: Denn alle Messinstrumente beweisen, dass zunehmend mehr Bürger, seit 1830 einseitig selbstbestimmungs-orientiert, jetzt ziemlich genau seit 1980 wieder in der Breite mehr für die Nöte und Sorgen Anderer ansprechbar sind (Dörner 2007, S. 46 ff.). Sie machen neben ihrem weiterhin geschätzten Grundbedürfnis nach Selbstbestimmung auch ihr anderes komplementäres Grundbedürfnis nach Bedeutung für Andere stark – etwa nach dem Motto: »Jeder Mensch braucht seine (noch so kleine) Tagesdosis an Bedeutung für Andere«, braucht es, nicht nur hilfs-, sondern auch helfensbedürftig zu sein, entdeckt sein Menschenbild des Menschen als Beziehungswesen wieder, weil er sich nur so gesund fühlen kann. Beispiele dafür: Seit 1980 Zunahme der Freiwilligen, der Nachbarschaftsvereine, der Selbsthilfegruppenkultur, der Bürgerstiftungen und Entstehung der flächendeckenden Hospizbewegung mit 80.000 Bürgerhelfern (Dörner 2012, S. 11–18); dadurch sind in der kurzen Zeit von dreißig Jahren zumindest vier neue Formen des Helfens erfunden worden: Generationsübergreifendes Siedeln (2.000 Projekte), ambulante stadtviertelbezogene Wohnpflegegemeinschaften (1.000 Projekte), Gast- oder Pflegefamilien auch für Alterspflegebedürftige sowie die 24-Stunden-Pflege in der eigenen Wohnung. Inzwischen gibt es selbst in fast jedem Dorf eine Bürgerinitiative, etwa für Demente. Würde man all diese Aktivitäten zusammenfassen, ergäbe sich eine Nachbarschaftsbewegung mit sicher über einer Million Bürgern (und Profis) (Dörner 2012, S. 11–18). Aber schon eine solche Zusammenfassung entspricht offenbar nicht der Dienstleistungs-Ethik; jede Initiative bestellt lieber ihren eigenen Sozialraum-Acker.
- Ein Symptom für...