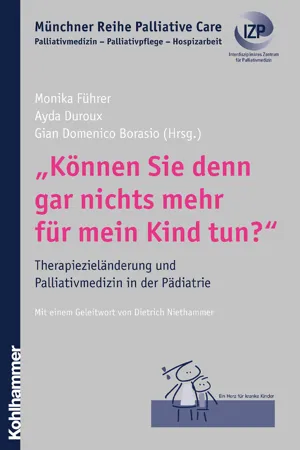![]()
Teil C: Palliativmedizin in der Pädiatrie – Heute und in Zukunft
![]()
Der Schmerz – Verbündeter und Verräter
Monika Führer
1 Schmerz verstehen
Der Schmerz ist ein Verbündeter des Lebens. Sieht man von Konzepten der vorgeburtlichen Teilhabe des Ungeborenen am mütterlichen Erleben ab, so beginnt die Schmerzgeschichte jedes Menschen mit der Geburt. Für die Gebärende gehört der Geburtsschmerz zu den wesentlichen Grenzerfahrungen, er ist eine zutiefst persönliche, aber auch mitteilbare, weil bewusste Erfahrung. Dass die Geburt für das Kind jedoch ebenfalls mit existentiellem Schmerz verbunden sein muss, ist evident, wenn man den Geburtsvorgang einmal aus der Perspektive des bis dahin im Körper der Mutter wunderbar geborgenen Feten betrachtet. Diese Erfahrung des ersten Schmerzes, der ersten Trennung, teilen alle Menschen, aber sie bleibt im Dunkel des Unbewussten. Eine Sensation, die nur der Körper erinnert, die sich damit der Kommunikation weitgehend entzieht. Keine andere Wahrnehmung ist damit so unmittelbar wie der Schmerz mit unserer Körperlichkeit und Endlichkeit verbunden.
So sehr sich eine Geburt von der anderen unterscheidet, so unterschiedlich beginnt auch die Schmerzgeschichte jedes einzelnen Menschen. Schmerz wird damit immer in einem ganz persönlichen Kontext empfunden, er folgt nicht einfach linear aus einer definierten äußeren oder inneren Ursache. Vielmehr ist der Schmerz ein in der Afferenz über wenige neuronale Strukturen verschalteter Sinn, der in der weiteren Verarbeitung Teil eines komplexen Systems permanenter Rückmeldung des körperlichen und seelischen Zustandes wird. Dieses überlebenswichtige System befindet sich von Anfang an in einem Lernprozess. Dieser Prozess folgt altersabhängigen Notwendigkeiten und wird von individuellen Erfahrungen beeinflusst. Das alarmierende Schreien eines hungrigen Säuglings ist selbst für empathische Eltern zunächst kaum von »schmerzbedingtem« Schreien zu unterscheiden. Da Hunger für den jungen Säugling tatsächlich existenziell bedrohlich ist, lernt das Kind erst allmählich mit dem Hungerschmerz umzugehen und die Befriedigung seiner Bedürfnisse aufzuschieben. Deutlich länger brauchen Kinder um mit dem Schmerz des Verlassenseins umgehen zu können. Das »Überleben« ist für das lange hilflose Kind unmittelbar an die ständige Anwesenheit einer Bezugsperson gebunden. Verlassen werden ist somit eine existentielle Bedrohung, die tiefen Schmerz auslöst. Weitere wichtige Schmerzerfahrungen finden mit zunehmender Autonomie in der Auseinandersetzung mit der unbelebten Umwelt bei unzähligen kleinen »Unfällen« statt. Hier stellt der Schmerz immer auch eine Begrenzung des eigenen Expansionsdranges dar. Aber auch andere Kinder und Erwachsene fügen dem Kind immer wieder Schmerz zu. Die Verarbeitung dieser vielfältigen Erfahrungen findet dabei entscheidend im Kontext mit den erlebten physischen und emotionalen Folgen statt. Die Bewertung von Schmerz und schmerzauslösender Situation wird dabei ganz wesentlich vom Verhalten der Eltern und anderer wichtiger Bezugspersonen beeinflusst. Das Kind lernt den Schmerz kennen und entwickelt seinen ganz persönlichen Schmerzmaßstab. Besonders deutlich wird dieser Prozess, wenn wir bereits an dreijährigen Kindern die Fähigkeit zum Mitleid erleben. In diesem Alter hat das Kind aus den bis dahin gemachten Schmerzerfahrungen bereits ein Konzept von »Leiden« im weitesten Sinne entwickelt, das es ihm ermöglicht, bestimmte Ereignisse als leidverursachend zu identifizieren, oder aber verbale oder nonverbale Schmerzäußerungen in Beziehung zu eigenen Leiderfahrungen zu setzen. Besonders anrührend ist es, welch gute Schmerztherapeuten Kinder in diesem Alter bereits sind. In ihrem schon sehr komplexen Leidkonzept spielt Linderung durch Trösten, körperliche Nähe und Beschützen eine wichtige Rolle.
Dieses ganzheitliche und dynamische Konzept vom Schmerz bedeutet für den Umgang und die Betreuung von Kindern, dass
- Schmerz als eine unabwendbare, mit dem Leben untrennbar verbundene Erfahrung verstanden wird, auf die jedes Kind im Rahmen seiner physiologischen Möglichkeiten mehr oder weniger gut vorbereitet ist.
- Schmerz von Anfang an ein multidimensionales Geschehen ist, das verschiedenen körperlichen, psychischen und sozialen Einflüssen unterliegt.
- die Vermeidung von Trennung und die Ermöglichung von körperlicher Nähe durch die Bezugspersonen gerade sehr jungen Kindern ermöglicht, Schmerz möglichst angstfrei zu verarbeiten.
- die Antizipation von Schmerz bei entsprechenden Eingriffen oder Zuständen und die sorgfältige Schmerzmessung und -behandlung gerade auch bei den jüngsten Patienten zur günstigen Entwicklung des individuellen Schmerzerlebens beiträgt.
Dieses Grundverständnis kann entscheidend dazu beitragen, dass der Schmerz dadurch der Verbündete des Kindes bleibt, dass er seine Funktion als Warnsystem behält. Die Erfahrung von Geborgenheit und rascher Linderung kann verhindern, dass sich Schmerz und Angst zu einem Gefühl existentieller Bedrohung verbinden.
2 Schmerz messen
Maßstab für die Qualität der Schmerztherapie kann entsprechend dem im ersten Kapitel skizzierten Schmerzverständnis ausschließlich die subjektive Schmerzempfindung sein. Damit kommt der Schmerzmessung mit Hilfe verschiedener, altersangepasster Instrumente eine besondere Bedeutung zu [1,2]. Grundsätzlich ist die Selbsteinschätzung des Patienten der Fremdeinschätzung durch die Eltern oder das Pflegepersonal der Vorzug zu geben [3,4]. Instrumente zur direkten Schmerzmessung müssen dem Alter entsprechend eingesetzt und der kindlichen Vorstellungswelt angepasst werden [5] (Visuelle AnalogSkala für Schulkinder, Numerische AnalogSkala ab ca. 12 Jahren) [6]. Allerdings können Instrumente, die mit sogenannten Schmerzgesichtern [7,8] arbeiten (z. B. Abb. 1: Smiley-Analog-Skala) können ab einem Alter von ca. drei Jahren eingesetzt werden. Besondere Schwierigkeiten ergeben sich bei der Beurteilung von Schmerzlokalisation, Schmerzqualität und Schmerzintensität bei Patienten, deren intellektuelle oder sprachliche Entwicklung eine verbale Kommunikation über ihr Schmerzerleben nicht oder noch nicht zulässt. Säuglinge, Kleinkinder, aber auch Kinder mit schweren geistigen oder körperlichen Behinderungen stellen damit besondere Anforderungen an die Erfassung und Messung von Schmerz. Die oft erstaunlich gute Beobachtung diskreter Verhaltensveränderungen ihrer Kinder durch aufmerksame Eltern, die geschulte Beobachtung durch erfahrene Pflegekräfte und die gründliche Untersuchung durch den Kinderarzt müssen im nonverbalen Alter konkrete Angaben durch den Patienten selbst ersetzen. Es liegen inzwischen verschiedene ein- und multidimensionale Instrumente zur Fremdeinschätzung im präverbalen Alter vor [9,10,11], die in verschiedenen Altersgruppen und unter unterschiedlichen Bedingungen (postoperative Schmerzen, invasive Maßnahmen) validiert wurden (z. B. NIPS, Comfort-Scale, PIPP [12], PEPPS [13], KUSS, PPP zur Fremdeinschätzung bei schwer mehrfach behinderten Kindern) [14,15]. Wegen mangelnder Spezifizität oder Sensibilität kann jedoch keine der Skalen als Goldstandard gelten [16]. Zudem fehlen für viele der Skalen Angaben zu einem Cut-off Wert, ab dem eine Indikation für eine analgetische Therapie gegeben ist. Diese Schwierigkeiten dürfen nicht dazu führen, die Schmerzen gerade unserer jüngsten Patienten zu ignorieren [17,18]. Inzwischen kennt die Schmerzforschung die lange unterschätzte Bedeutung früher Schmerzerfahrungen für die seelische und körperliche Gesundheit [19] und die Verarbeitung späterer Schmerzerlebnisse [20]. Das individuelle Schmerzgedächtnis wird in frühester Kindheit angelegt und stellt einen später der bewussten Erinnerung entzogenen Erfahrungsspeicher dar [21,22].
Neben den eindimensionalen Skalen zur Schmerzmessung spielt die systematische Schmerzanamnese eine zentrale Rolle. Dabei können strukturierte Fragen, aber auch nonverbale Methoden (»Den Schmerz malen«) wichtige Einblicke in das komplexe Schmerzgeschehen geben [23]. Ein wichtiges Hilfsmittel bei der Erfassung der Schmerzlokalisatio...