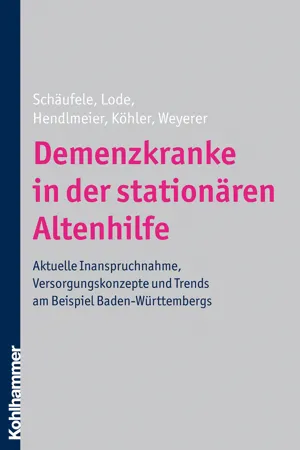
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Demenzkranke in der stationären Altenhilfe
Aktuelle Inanspruchnahme, Versorgungskonzepte und Trends am Beispiel Baden-Württembergs
- 176 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Demenzkranke in der stationären Altenhilfe
Aktuelle Inanspruchnahme, Versorgungskonzepte und Trends am Beispiel Baden-Württembergs
Über dieses Buch
In Deutschland gibt es einen zunehmenden Trend zur stationären Pflege. Zur Zeit leben 677.000 Menschen in Pflegeheimen, zwei Drittel von ihnen leiden an einer Demenz. Im Rahmen einer groß angelegten Studie wurden über 5.000 Personen in 58 Einrichtungen in Baden-Württemberg hinsichtlich ihrer Alltagsaktivitäten, kognitiven Einschränkungen und Verhaltensprobleme untersucht: Wie sieht die Lebens- und Versorgungsqualität der Bewohner aus? Inwieweit wurden neue Konzepte der Betreuung von Demenzerkrankten verwirklicht und welche Vorteile bieten sie gegenüber der traditionellen Versorgung? Auf diese Fragen gibt das Buch eine wissenschaftlich fundierte Antwort.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Demenzkranke in der stationären Altenhilfe von Martina Schäufele,Sandra Lode,Ingrid Hendlmeier,Leonore Köhler,Siegfried Weyerer im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medicine & Geriatrics. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Im Zuge der demographischen Veränderungen in den Industrieländern hat die Versorgung älterer Menschen in Altenpflegeheimen zunehmend an Bedeutung gewonnen. Während die klassischen Altenheime nach Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung aus der Versorgungslandschaft nahezu verschwunden sind, stieg die Zahl von Pflegeheimen in Deutschland stark an, allein zwischen 2001 und 2003 von 9.165 auf 9.700 (Statistisches Bundesamt 2005). Die Zahl der Pflegeheimbewohner erhöhte sich im gleichen Zeitraum von 604.000 auf 640.000. Zwischen 2003 und 2005 war ein weiterer Anstieg der Anzahl von Pflegeheimen zu verzeichnen, die Bewohnerzahlen erreichten parallel dazu den bisherigen Höchststand von 677.000 (Statistisches Bundesamt 2007).
Allein aufgrund der Bevölkerungsentwicklung, die einerseits durch steigende Lebenserwartung und andererseits durch rückläufige Geburtenraten, also durch eine doppelte Alterung charakterisiert ist (Weyerer und Bickel 2007), ist mit einer weiteren Zunahme der Inanspruchnahme von Einrichtungen der Altenhilfe zu rechnen. Dass hiervon vorrangig die Einrichtungen der stationären Altenhilfe betroffen sein werden, ist in erster Linie wegen des überproportional anwachsenden Anteils von Hoch- und Höchstbetagten wahrscheinlich, der Bevölkerungsgruppe, die das größte Risiko für Multimorbidität, schwere Pflegebedürftigkeit und intramurale Versorgung trägt. Einer Untersuchung von Bickel (1996) zufolge, betrug das kumulative Risiko eines Heimeintritts in der Altenbevölkerung bis zum Alter von 75 Jahren weniger als 7 %, bis zum Alter von 80 Jahren mehr als 15 % und bis zum Alter von 90 Jahren nahezu 60 %.
Da sich in Deutschland die Zahl der über 80-Jährigen zwischen 2000 und 2050 von 3,1 Mio. auf 9,1 Mio. und die Zahl der über 90-Jährigen von 525.600 auf 1,9 Mio. erhöhen wird (Weyerer und Bickel 2007), werden große Anforderungen auf die Versorgungssysteme zukommen. Es gibt empirische Befunde, die auf positive Kohorteneffekte hoffen lassen, d. h. auf eine Abflachung des Anstiegs der Pflegebedürftigkeitsraten im höheren Alter (Schneekloth und Wahl 2006). Da es sich dabei aber lediglich um eine Reduktion des Anstiegs handelt, ist mit weiterhin steigenden Zahlen von Pflegebedürftigen zu rechnen. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Entwicklung in einer wachsenden Inanspruchnahme von Pflegeheimen niederschlagen wird oder ob der im Gang befindliche Ausbau ambulanter Einrichtungen und Versorgungsformen für hilfs- und pflegebedürftige ältere Menschen, wie z. B. Hausgemeinschaften, die Nachfrage nach stationärer Pflege bremsen wird. Mit einem drastischen Rückgang der Nachfrage ist allerdings angesichts der jüngsten Entwicklung der Bewohnerzahlen auch künftig nicht zu rechnen.
Ausgehend von zahlreichen Befunden aus verschiedenen Industrieländern ist es mittlerweile unumstritten, dass Demenzerkrankungen zu den wichtigsten Ursachen für den Verlust der Selbstständigkeit und schwerer Pflegebedürftigkeit im Alter zählen (Bickel 2003). Eine repräsentative deutschlandweite Studie, die jüngst bei hilfs- und pflegebedürftigen Menschen in Privathaushalten durchgeführt wurde, unterstreicht diese Erkenntnis (Schäufele et al. 2006). Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass Einschränkungen im Alltag mit steigendem Demenzschweregrad erheblich zunehmen. Bereits bei leichter Demenz war eine deutlich erhöhte Versorgungsbedürftigkeit festzustellen. Während von den hilfs- und pflegebedürftigen Befragten ohne Demenz rund 50 % nicht mehr in der Lage waren, sich selbstständig zu baden, stieg dieser Anteil bei den leicht Demenzkranken auf 66,7 %, bei den mittelschwer Erkrankten auf 82,4 % und bei den schwer Demenzkranken auf 100 % an. Hilfe beim An- und Ausziehen war bei insgesamt 39,4 % der kognitiv Unbeeinträchtigten, bei 69,6 % der leicht demenziell Erkrankten, bei 88,3 % der mittelschwer und bei fast allen schwer Demenzkranken erforderlich. Die Kontrolle über die Blasenfunktion hatten 7,1 % der nicht demenziell Erkrankten, 15,2 % der leicht Demenzkranken und 36 % bzw. 60,6 % der mittelschwer und schwer demenziell Erkrankten vollständig verloren. Kein einziger schwer demenzkranker Mensch war in der Lage sich außerhalb der eigenen Wohnung zurecht zu finden, einzukaufen, seine finanziellen Angelegenheiten zu regeln, seine Medikamente zu richten, selbstständig zu telefonieren oder die Wohnung sauber zu machen. Auch den Demenzkranken im mittleren Stadium waren diese Tätigkeiten nur in Ausnahmefällen möglich. Die erhebliche Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit im Verlauf demenzieller Prozesse kam auch darin zum Ausdruck, dass nur 12 % der schwer und knapp 30 % der mittelschwer Demenzkranken ohne Schwierigkeiten mehrere Stunden alleine gelassen werden konnten. Auch bei den leicht Demenzkranken war dieser Anteil mit rund 60 % bereits deutlich geringer als bei den Probanden mit Hilfs- und Pflegebedarf ohne Demenz, von denen rund 84 % tagsüber längere Zeit alleine bleiben konnten (Schäufele et al. 2006).
Die häusliche Pflege von Menschen mit Demenz ist nicht nur aufwändiger und zeitintensiver, sondern auch belastender als die Pflege von körperlich beeinträchtigten Menschen ohne Demenz. (z. B. Gräßel 1998, Pinquart und Sörensen 2003). Da die pflegenden Angehörigen mit zunehmender Demenzschwere oft nicht mehr zur häuslichen Versorgung in der Lage sind, wird in fortgeschrittenen Krankheitsstadien eine Heimübersiedelung immer wahrscheinlicher. Ergebnisse aus einer Mannheimer Studie weisen darauf hin, dass bis zu 80 % aller Betroffenen im Verlauf der Demenz in ein Pflegeheim eintreten (Bickel 2001). Dieselbe Studie erbrachte, dass querschnittlich betrachtet ein weitaus größerer Anteil als bisher angenommen, nämlich etwa 40 % der mittelschwer bis schwer Demenzkranken, in Institutionen leben und ›nur‹ 60 % in Privathaushalten betreut und versorgt werden.
Solange in näherer Zukunft keine bahnbrechenden Erfolge in der Prävention und der ursächlichen Behandlung der häufigsten Demenzformen im Alter erzielt werden, müssen die Einrichtungen der stationären Altenhilfe mit einer weiteren Zunahme der Inanspruchnahme durch demenziell erkrankte Menschen rechnen. Einer Hochrechnung von Bickel (2001) zufolge, wird – wegen des engen Zusammenhangs zwischen zunehmendem Lebensalter und Demenzrisiko – unter den gegebenen Voraussetzungen die Zahl von mittelschwer bis schwer Demenzkranken bis zum Jahr 2020 auf nahezu 1,4 Millionen anwachsen. Bis zum Jahre 2050 sind in Deutschland sogar über zwei Millionen Demenzkranke zu erwarten.
Die Versorgung und Betreuung von hochaltrigen Menschen mit Demenz unter humanen Bedingungen wird damit zu einer der wichtigsten medizinischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen der Zukunft.
1.1 Die stationäre Pflege Demenzkranker in Baden-Württemberg: Ergebnisse aus vorangegangenen Studien
Im Land Baden-Württemberg gab es im Jahr 2001 (Stand: 15.12.2001) 944 Pflegeheime mit 66.975 pflegebedürftigen Bewohnern. Davon waren 22.032 in Pflegestufe 1, 30.806 in Pflegestufe 2 und 11.867 in Pflegestufe 3 eingestuft. Es überwogen die Frauen mit einem Anteil von 77,8 % (Pristl und Weber 2004).
Für die Stadt Mannheim liegen nach unserem Wissen bislang die umfangreichsten und belastbarsten Daten zur Inanspruchnahme von stationärer Langzeitpflege in Baden-Württemberg vor. Die Mannheimer Datenbasis kam unter anderem durch zwei aufeinander folgende Untersuchungen zustande, in die alle Bewohner von 15 Altenpflegeheimen, die die stationäre Versorgung der Stadt recht gut abbildeten, einbezogen waren. Eine Untersuchung wurde vor (1995/96) und die andere unmittelbar nach (1997/98) Einführung der Pflegeversicherung im stationären Bereich (1.7.1996) durchgeführt. Die Ergebnisse belegten, dass innerhalb von zwei Jahren der Anteil von mittelschwer oder schwer demenzkranken Bewohnern von 53,8 % auf 58,6 % anstieg (Sozialministerium Baden-Württemberg 2000a, Weyerer und Schäufele 2004), trotz des massiven Ausbaus und der Weiterentwicklung ambulanter Pflegedienste seit Ende der 80er Jahre. Diese Entwicklung weist indirekt auf den erheblichen Bedarf an Versorgungseinrichtungen hin, die rund um die Uhr Pflege und Betreuung gewährleisten können.
Eine Studie in Tagespflegeeinrichtungen in acht badischen Städten unterstreicht den Bedarf an umfassend betreuenden Einrichtungen. Vergleicht man die Nutzer der Tagespflegeeinrichtungen mit den Heimbewohnern, so stellt man fest: In beiden Versorgungsformen weisen etwas mehr als die Hälfte der Klientel Demenzen auf. Bei den Heimbewohnern war jedoch der Anteil von Personen, die in den Aktivitäten des täglichen Lebens (z. B. Körperpflege, Nahrungsaufnahme, Mobilität, Kontrolle der Ausscheidungen) erheblich von der Hilfe anderer Personen abhängig waren, mit 58,6 % deutlich höher als unter den Tagesgästen mit 27,1 %. Die Unterschiede waren besonders ausgeprägt in den Bereichen Mobilität und Fähigkeit zur Kontrolle der Ausscheidungen. Während von den Tagesgästen niemand bettlägerig war, traf dies auf rund 21 % der Heimbewohner zu. Regelmäßig urin- und stuhlinkontinent waren 10 % und 4 % der Tagesgäste, bei den Heimbewohnern betrugen die Anteile 46 % und 38 % (Weyerer et al. 2004). Unterstrichen werden diese indirekten Hinweise auf die Grenzen der häuslichen Versorgung von Demenzkranken auch durch Untersuchungen aus dem Ausland: Die »Canadian Study of Health and Aging«, eine der wenigen landesweit durchgeführten Repräsentativstudien, ergab, dass sich rund 20 % der leicht, 45 % der mittelschwer und 85 % der schwer Demenzkranken in stationärer Versorgung befanden (Graham et al. 1997). Bickel (2001) nimmt an, dass in Deutschland der Anteil derer, die von Anbeginn der Demenzerkrankung bis zum Lebensende im häuslichen Umfeld verbleiben, mittlerweile weniger als ein Drittel betragen dürfte.
Vergleichbar der stationären Versorgungslandschaft im gesamten Deutschland wurde in den 15 untersuchten Einrichtungen überwiegend integrativ betreut, d. h. es gab keine getrennten Angebote für Bewohner mit und ohne Demenz. Vier der 15 Heime boten spezielle Tagesbetreuung für einen Teil der demenzkranken Bewohner an, d. h. sie betreuten auch teilintegrativ. Lediglich eine Einrichtung verfügte über eine ›Demenzstation‹, auf der ausschließlich Menschen mit Demenz lebten. Darüber hinaus gab es in Mannheim zu diesem Zeitpunkt weder Spezialeinrichtungen noch spezielle Wohnbereiche für Demenzkranke.
Weitere wichtige Befunde aus der Untersuchung der Mannheimer Heime waren: Die Bewohner mit Demenz
- zeigten neben den kognitiven Einschränkungen vermehrt so genannte Verhaltensauffälligkeiten, häufig auch als herausforderndes Verhalten bezeichnet: Agitiertheit, Gereiztheit, Zurückgezogenheit und Apathie sowie Schlafstörungen wurden bei jeweils 40–50 % der Demenzkranken mehrfach oder sogar häufig innerhalb eines Vierwochenzeitraums von den Pflegekräften festgestellt;
- waren diejenige Gruppe innerhalb der Bewohnerschaft, die den höchsten Grad an Betreuungsbedürftigkeit aufwies: 75 % bedurften sogar ständiger Versorgung und/oder Beaufsichtigung. Bei den Bewohnern ohne Demenz belief sich der entsprechende Prozentsatz auf weniger als 30 %;
- hatten gegenüber den Bewohnern ohne Demenz weniger soziale Kontakte im Heim und nahmen deutlich seltener an Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Einrichtung teil;
- waren nur zu einem relativ geringen Anteil in nervenärztlicher Behandlung. Bei der Erstuntersuchung betrug dieser Anteil rund 13 %, bei der Zweituntersuchung immerhin 22 %. Demgegenüber erhielten 60 % der Demenzkranken Psychopharmaka, wobei 50 % Antipsychotika einnahmen. Die Verordnung der Psychopharmaka erfolgte in erster Linie durch Hausärzte.
Von den 15 Einrichtungen verfügte keine einzige über ein Konzept zur Versorgung Demenzkranker. Eine Befragung der Pflegekräfte ergab, dass die Arbeitsbelastung und die psychische und körperliche Beanspruchung durch die Arbeit beträchtlich war. Im Laufe des zweijährigen Untersuchungsintervalls war sogar eine Verschärfung dieser Situation auszumachen (Zimber und Weyerer 1998, Zimber et al. 1999). Das Pflegepersonal gab zudem Fortbildungsbedarf an, Priorität kam dabei dem Umgang mit aggressiven und verwirrten Bewohnerinnen zu, noch vor dem Umgang mit Schwer- und Todkranken.
Diese Befunde geben nur einige wenige Aspekte und Trends in der stationären Altenpflege wieder, mit denen die Einrichtungen im Zusammenhang mit der steigenden Zahl von Menschen mit Demenz konfrontiert wurden (Weyerer et al. 2001, Weyerer und Schäufele 2004). Die beschriebene Entwicklung ging unter anderem damit einher, dass neue Betreuungs- und Versorgungsansätze konzipiert und teilweise umgesetzt wurden sowie Maßnahmen zur Personalqualifizierung und Qualitätssicherung ergriffen wurden (Zimber et al. 2000, Zimber et al. 2001).
1.2 Weiterentwicklung stationärer Versorgungskonzepte für Demenzkranke
In Baden-Württemberg wurden beispielsweise kleinere, gemeindenahe und homogen belegte Versorgungseinheiten eingeführt, die den Bedürfnissen von Demenzkranken möglicherweise besser entsprechen. Gleichermaßen fanden spezifische Umgangs- und Kommunikationsweisen, wie z. B. ›Validation‹, sowie spezielle organisatorische Maßnahmen zunehmend Eingang in die Konzepte stationärer Langzeitversorgung. Es wurde mit der Implementierung besonderer stationärer Betreuungsansätze für Demenzkranke begonnen, wie der Implementierung teilintegrativer Ansätze (Tagesangebote speziell für Demenzkranke) oder segregativer Wohnformen, in denen ausschließlich Demenzkranke betreut werden. Als Alternative zur Versorgung in Pflegeheimen wurden in jüngerer Zeit auch Hausgemeinschaften für Demenzkranke eingerichtet, die durch Normalität, Alltagsnähe und durch ein familiäres Milieu charakterisiert sind (z. B. Winter und Gennrich 2001). Als Vorbilder für besondere Wohn- und Betreuungsformen dienen Konzepte aus anderen Ländern, beispielsweise Wohngruppenkonzepte aus Schweden (›Gruppboende‹), den Niederlanden (›Anton Pieck-hofje‹), Frankreich (›Cantous‹), Großbritannien (›Domus Units‹) oder spezielle Pflegebereiche für Menschen mit Demenz (›Special Care Units‹) aus Kanada und den USA (Schäufele 2005).
Vorreiter in der Etablierung spezieller stationärer Betreuungsformen für Demenzkranke ist in Deutschland die Stadt Hamburg, in der bereits 1991 im Rahmen des so genannten »Hamburger Modells« in 30 Pflegeeinrichtungen 750 Plätze zur besonderen stationären Versorgung Demenzkranker bereitgestellt wurden. Die Konzeption des Hamburger Modells findet sich bei Kellerhof (2002). Basierend auf dem »Hamburger Modell« gibt es seit Anfang 2003 auch in Baden-Württemberg entsprechende Richtlinien (Sozialministerium Baden-Württemberg 2002) für die besondere stationäre Betreuung Demenzkranker.
Von politischer Seite wurde die Entwicklung und Implementierung besonderer Ansätze in der stationären Demenzkrankenversorgung unterstützt, unter anderem indem modellhafte Einrichtungen oder Projekte finanziert wurden. In jüngerer Zeit konnten solche neueren Ansätze der Demenzkrankenbetreuung im Rahmen des im Jahr 2003 abgeschlossenen Modellprogramms »Altenhilfestrukturen der Zukunft« des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in die Praxis umgesetzt und wichtige Erkenntnisse hinsichtlich ihres Nutzens und ihrer Verstetigung gewonnen werden (BMFSFJ 2004). Im Laufe des Jahres 2004 wurde darüber hinaus eine vom BMFSFJ geförderte umfassende Evaluation des Hamburger Modells, die von der Arbeitsgruppe Psychogeriatrie durchgeführt wurde, abgeschlossen (Weyerer et al. 2006). Die quantitativen Ergebnisse der Evaluation dieser Modelle werden im Zusammenhang mit den Ergebnissen des vorliegenden Projekts abschließend diskutiert.
Ungeachtet der Aufmerksamkeit und der Förderung, die solche Modelle und speziellen Einrichtungen in den letzten Jahren erfahren haben, ist über die stationäre Langzeitpflege Demenzkranker in Deutschland insgesamt und in den einzelnen Bundesländern nur wenig bekannt. So liegen selbst Basisdaten, wie z. B. Anteile von Demenzerkrankten an der Heimbewohnerschaft, lediglich aus einzelnen lokalen Untersuchungen vor (z. B. Bickel 1996, Weyerer et al. 2001, Becker et al. 2003, Weyerer und Schäufele 2004). Es ist unklar, welche Charakteristika Demenzkranke in der stationären Pflege aufweisen und wie sich ihre aktuellen Lebensbedingungen in Abhängigkeit von krankheitsassoziierten Merkmalen oder in Abhängigkeit von Merkmalen der Einrichtungen, wie z. B. dem Konzept der Demenzkrankenbetreuung, gestalten. Allerdings mangelt es nicht nur in Deutschland an Studien, die die Auswirkungen verschiedener stationärer Betreuungs- und Versorgungskonzepte mit fundierter wissenschaftlicher Methodik untersucht haben. Die Diskussion um das ›richtige‹ Konzept, die ›richtige‹ Wohnform oder die ›richtigen‹ Baulichkeiten für die Betreuung von Menschen mit Demenz wird deshalb noch immer eher von ideologisch gefärbten Meinungen und kommerziellen Interessen als von gesicherten Erkenntnissen dominiert. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass es in Deutschland durchaus üblich ist, dass private Anbieter und Institute ihre eigenen Konzepte und Produkte ›evaluieren‹, häufig mit einem Forschungsdesign, das selbst wissenschaftlichen Mindestansprüchen nicht genügt. Dieser Sachverhalt ist unseres Erachtens ein Grund dafür, dass in den letzten Jahren die Bedeutsamkeit von baulich-räumlichen Bedingungen für die Befindlichkeit von Menschen mit Demenz unverhältnismäßig stark akzentuiert und in entsprechende Baumaßnahmen umgesetzt wurde, ohne dass für deren Wirksamkeit ausreichende empirische Belege vorliegen (Day et al. 2000).
2 Methodisches Vorgehen
2.1 Ziele der Untersuchung
In der vorliegenden Arbeit sollten folgende Fragstellungen untersucht werden:
- Strukturelle Beschreibung der Einrichtungen und ihrer Bewohnerschaft (insbesondere hinsichtlich der Merkmale Personalstruktur, Pflege- und Betreuungskonzepte, soziodemographische Merkmale, Alltagseinschränkungen und Pflegebedürftigkeit der Bewohnerschaft, Häufigkeit von Demenzen) sowie die Darstellung von Entwicklungen im Untersuchungszeitraum, wobei vor allem auch Zusammenhänge zwischen spezifischen Betreuungskonzepten, Einrichtungsmerkmalen und Bewohnerprofilen erfasst werden sollten.
- Vergleichende Analysen im Zeitverlauf, unter anderem um Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Einrichtungen (z. B. Angebot, Versorgungskonzept) und Indikatoren von Lebensqualität auf Seiten der Bewohnerschaft darzustellen (z. B. Verhaltensauffälligkeiten bei Demenz, soziale und andere positive sowie kompetenzfördernde Aktivitäten der Bewohnerschaft, Einsatz von freiheitseinschränkenden Maßnahmen, gerontopsychiatrische Versorgung).
- Ermittlung der Anteile von Bewohnern mit Demenz zu zwei Messzeitpunkten und Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf mögliche Verbesserungen der Versorgungssituation sowie deren personeller, konzeptioneller und struktureller Vor...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Methodisches Vorgehen
- 3 Ergebnisse zu Strukturdaten
- 4 Ergebnisse zu besonderen Versorgungsformen
- 5 Zusammenfassung und Diskussion
- Danksagung
- Literatur
- Anhang