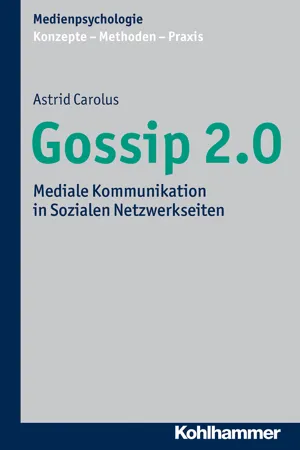![]()
1 Einleitung
„Internetnutzer verbringen die meiste Zeit in Sozialen Netzwerken“ titelte der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien e.V. (BITKOM) im Februar 2012. Etwa ein Viertel ihrer Online-Zeit verbringen die Internetnutzer der Studie zufolge auf Netzwerkseiten. Vereinfacht gerechnet bedeutet dies: Von den 140 Minuten durchschnittlicher Online-Zeit werden immerhin 30 Minuten mit einer Tätigkeit verbracht, die in dieser Form vor wenigen Jahren noch gar nicht existierte. Dies gilt insbesondere für die jüngeren Nutzer. Laut ARD/ZDF-Onlinestudie nutzt jeder der Befragten aus der Altersgruppe der 14- bis 30-Jährigen das Internet, über 60 Prozent loggen sich täglich in ihr Profil auf einer Sozialen Netzwerkseite ein. Etwa die Hälfte von ihnen verbringt bis zu zwei Stunden dort, gut 10 Prozent sogar mehr als zwei Stunden. Soziale Netzwerkseiten sind demnach längst keine Anwendung einer internetaffinen Gruppe von Online-Netzwerkern mehr. Allein das Netzwerk Facebook nutzen in Deutschland knapp 24 Millionen registrierte Mitglieder, ca. 30 Prozent der Bevölkerung. Weltweit sind es 900 Millionen Nutzer (Stand Mai 2012), die ihre Profile in vielfältiger Weise nutzen: Gruppenarbeiten planen und organisieren Studierende über ihre Netzwerkprofile, Einladungen zu Geburtstagen werden im Netzwerk verschickt, die entsprechenden Glückwünsche auf die Pinnwand gepostet. Neben Privatpersonen scheint zudem mittlerweile jedes Unternehmen, jede börsendotierte Aktiengesellschaft und jeder noch so kleine Laden aus dem Viertel mit einem eigenen Profil im Netzwerk präsent. Fast ein Drittel der deutschen Unternehmen sind laut dem Branchenverband BITKOM bereits in den Sozialen Netzwerken vertreten. Facebook selbst ist seit Mai 2012 ein börsendotiertes Unternehmen und erreicht eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden Dollar. Insgesamt stehen wir vor einem Phänomen, das die Menschen weltweit zu begeistern scheint. Aus (medien-)psychologischer Sicht stellt sich die Frage, was hinter diesem Phänomen steckt. Was macht die Faszination Sozialer Netzwerkseiten aus? Warum investiert diese große Anzahl an Menschen dort so viel Zeit und Energie? Worin besteht der Nutzen, sich über sein Online-Profil mit den Profilen anderer Menschen zu verlinken? Online zu kommunizieren, Bilder und Nachrichten auszutauschen, wenn man dies doch auch face-to-face oder über die bisherigen Kommunikationsmedien tun könnte? Was zeichnet den Kommunikationsprozess in Sozialen Netzwerkseiten aus?
Diese Arbeit versucht, einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen zu leisten. Dazu wird das Phänomen in einem ersten Schritt beschrieben und der mediale Kommunikationsprozess systematisiert. Dies geschieht mit einer Adaption der Lasswell-Formel, die ursprünglich den Prozess der Massenkommunikation zerlegte und in dieser Arbeit als „Lasswell-Formel 2.0“ Teilaspekte der Kommunikationsprozesse in Sozialen Netzwerkseiten unterscheidet. Sie liefert das Ordnungsschema dieser Arbeit, dem sowohl der erste Forschungsüberblick in Kapitel 2 als auch die weiteren Kapitel des Theorieteils und im Anschluss der Empirieteil folgen: Who communicates why and what (in which channel) with what effect? Kapitel 3 fragt zunächst nach dem Kanal (in which channel) und stellt, nach einer knappen Skizzierung der Entwicklung des Internets, die Sozialen Netzwerkseiten in den Mittelpunkt. Die Netzwerkseiten werden dabei als eine der populärsten Anwendungen des sogenannten Web 2.0 betrachtet. Dieses Web 2.0 oder auch Social Web zeichnet sich im Wesentlichen durch einen sozialen Charakter und durch die veränderte Rolle des Nutzers aus, der nun aktiver Anwender ist. Damit wird auch die Frage nach dem what im Kommunikationsprozess berührt und ausgeführt. Der Frage nach dem why wird sich auf drei Wegen genähert. Zuerst greift Kapitel 4 den Uses and Gratifications-Ansatz auf, der die Gratifikationen der Mediennutzung thematisiert. Im Hinblick auf die Nutzung Sozialer Netzwerkseiten werden hier immer wieder soziale Nutzungsmotive genannt. Um ihrer Bedeutung gerecht zu werden, vertieft Kapitel 5 diese sozialen Motive. Im Gossip-Konzept (Klatsch und Tratsch) wird ein Ansatzpunkt für das Verständnis der sozialen Nutzungsmotive der Netzwerkseiten erkannt. Mit der evolutionspsychologischen Perspektive wird in diesem Kapitel zudem ein Rahmenmodell eingeführt, das den Blickwinkel dieser Arbeit erweitern soll. In Kapitel 6 bleibt der Fokus auf den sozialen Motiven. Mit dem Zürcher Modell der Sozialen Motivation, das erneut evolutionspsychologisch argumentiert, wird ein Ansatz gewählt, der sich nicht auf den spezifischen Kontext der Netzwerkseiten bezieht, sondern grundlegende soziale Motive modelliert. Zuletzt beschäftigt sich Kapitel 7 mit der Frage nach dem who der Lasswell-Formel 2.0 und beleuchtet ausgewählte Aspekte der Persönlichkeit der Kommunikatoren Sozialer Netzwerkseiten: Das Persönlichkeitsmodell der Big Five wird ergänzt um die Evolutionary Two als eine evolutionspsychologisch basierte Erweiterung des Ansatzes. Zudem wird das Soziale Geschlecht betrachtet, das wiederum aus einer kulturellen Perspektive argumentiert. Jedes Theoriekapitel schließt mit einem Fazit und der Ableitung offener Fragen. Kapitel 8 fasst die theoretischen Ausführungen noch einmal knapp zusammen und leitet die Fragestellungen ab, die den Übergang zur Empirie ebnen. Der sich anschließende empirische Teil der Arbeit greift die Fragestellungen auf und versucht mittels einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Methoden Antworten zu finden. Dabei folgt dieser Teil erneut der Struktur der Lasswell-Formel 2.0. Kapitel 9 geht dem Inhalt und der Form von Profilen Sozialer Netzwerkseiten inhaltsanalytisch nach und leistet eine detaillierte Beschreibung des Untersuchungsgegenstands (what). Im Anschluss fragt Kapitel 10 nach den Motiven der Kommunikatoren Sozialer Netzwerkseiten (why) und stellt zwei Fragebögen vor. Beide Instrumente basieren auf den beiden im Theorieteil dargestellten theoretischen Konzepten (Gossip und Nutzungsgratifikationen). Eingesetzt werden sie zur Untersuchung von Zusammenhängen dieser Motivsysteme von Sozialen Netzwerkseiten mit allgemeineren sozialen Motiven. Kapitel 11 charakterisiert dann die Kommunikatoren Sozialer Netzwerkseiten (who). Dazu werden die Kommunikatoren in einem ersten Schritt anhand ihrer Nutzungsmotive in Gruppen unterteilt und in einem zweiten Schritt im Hinblick auf Aspekte der Persönlichkeit beschrieben: Big Five, Evolutionary Two und Soziales Geschlecht. Die Arbeit schließt mit einer Gesamtdiskussion und einem Ausblick in Kapitel 12, das die zentralen Ergebnisse zusammenfasst, diskutiert und Implikationen ableitet. Der Ausblick zeigt abschließend Ansatzpunkte für zukünftige Forschung auf und skizziert diese auch mit Blick auf die Teilaspekte channel und effects der Lasswell-Formel 2.0 des medialen Kommunikationsprozesses. Thematisiert werden in diesem Zusammenhang die Auswirkungen des „Phänomens Soziale Netzwerkseiten“ auf Mikroebene (reinforcing spirals) sowie auf Meso- und Makroebene (Soziales Kapital), insbesondere die Konsequenzen für das Soziale Kapital einer Gesellschaft, deren Mitglieder immer mehr Zeit online verbringen.
![]()
2 Überblick: Mediale
Kommunikationsprozesse
Aspekte medialer Kommunikationsprozesse: Lasswell-Formel 2.0
Begriffsbestimmung: Soziale Netzwerkseiten als Web 2.0-Anwendung
Forschungsüberblick: (Soziale) Kommunikation im Web 2.0
Formulierung der Fragestellungen entlang der Lasswell-Formel 2.0
Gliederung der Arbeit
Dieses Kapitel dient dazu, den Forschungsgegenstand der vorliegenden Arbeit einzugrenzen. Ausgehend von der grundsätzlichen Frage nach den Kommunikationsprozessen in Sozialen Netzwerkseiten soll im Folgenden ein Überblick über die wesentlichen Aspekte medialer Kommunikationsprozesse gegeben werden. Dazu wird mit der Lasswell-Formel 2.0 in einem ersten Schritt ein Ordnungsschema eingeführt, das zum einen diesen einführenden Überblick gliedern, zum anderen die gesamte Arbeit strukturieren wird. Die sich anschließende Begriffsbestimmung sowie der Forschungsüberblick folgen bereits dieser Struktur und auch die Formulierung der Forschungsfragen, die dieses Kapitel abschließt, erfolgt entlang der Lasswell-Formel 2.0.
2.1 Aspekte medialer Kommunikationsprozesse: Lasswell-Formel 2.0
Fragt man nach dem Kommunikationsprozess in Sozialen Netzwerkseiten, öffnet sich ein weites Feld wissenschaftlicher Bemühungen. Aus verschiedenen Traditionen heraus wurde und wird versucht, menschliche Kommunikation zu verstehen, den Kommunikationsprozess zu beschreiben und zu erklären. Mit dem Ziel, den medial vermittelten Kommunikationsprozess in Sozialen Netzwerkseiten (SNS) zu systematisieren, werden Ausschnitte dieser Forschung im Folgenden knapp präsentiert.
Die in der Literatur genannten Kommunikationsmodelle konzeptualisieren und systematisieren den Kommunikationsprozess, wobei sich die Ansätze nicht nur in Bezug auf ihren Fokus, sondern auch in Bezug auf das zugrundeliegende Verständnis von Kommunikation unterscheiden. Dieses rangiert zwischen der schlichten Vermittlung von Signalen (Shannon & Weaver, 1949) bis hin zu einer wechselseitigen Interaktion mindestens zweier Akteure1, die sowohl das Zeichensystem als auch das Verständnis der Situation, Vorwissen und Intentionen (zumindest ausschnittsweise) teilen (Kunczik, 1979). Ein Großteil der Überlegungen rekurriert dabei auf das genannte Modell von Shannon und Weaver, die 1949 Grundmerkmale von Kommunikation erkannten und diese als Signalübertragung von einem Sender über einen störanfälligen Kanal zu einem Empfänger konzeptualisierten. Dass die Autoren dabei wesentliche Merkmale des Prozesses ignorierten bzw. stark vereinfachten kann dabei mit Blick auf das Ziel ihrer Arbeit verstanden werden: als Nachrichtentechniker beschränkten sich Shannon und Weaver auf technische Mängel (Rauschen) bei der Nachrichtenübertragung. Psychologische Faktoren sind daher nicht Gegenstand des Modells. Zentral für die vorliegende Arbeit ist die Idee Shannon und Weavers, den Kommunikationsprozess in einzelne Aspekte zu zerlegen und auf diese Weise zu systematisieren. Ähnlich geht der US-amerikanische Politik- und Kommunikationswissenschaftler Harold D. Lasswell vor, der bereits 1948 den Massenkommunikationsprozess modellierte. Die nach ihm benannte Lasswell-Formel nennt ebenfalls Sender, Nachricht, Kanal und Empfänger, integriert aber bereits den Effekt oder die Wirkung von Kommunikation. Damit erkennt Lasswell an, dass Kommunikation immer auch Wirkung ist, die wiederum nicht notwendigerweise der Intention des Senders entsprechend muss (vgl. Watzlawick, Beavin & Jackson, 1969). Die Lasswell-Formel fragt:
Who says what in which channel to whom with what effect?
Wer sagt was in welchem Kanal zu wem mit welchem Effekt?
Im Folgenden wird nun gefragt, ob diese Formel auch auf die Kommunikation in Sozialen Netzwerkseiten übertragbar ist und damit auch in diesem vergleichsweise neuen Kommunikationssetting den medial vermittelten Kommunikationsprozess strukturieren kann. Da sich dieses Setting von der „klassischen“ medialen Massenkommunikation unterscheidet, ist anzunehmen, dass Modifikationen an der Formel erforderlich sind. Diese Modifikationen sollen im Folgenden herausgearbeitet und begründet werden.
Beginnend mit der Frage nach dem who und dem whom der Kommunikation ist für Netzwerkseiten festzustellen, dass Kommunikation hier nicht mehr nur in eine Richtung vom Sender zum Empfänger verläuft, sondern der Empfänger einer Nachricht auf diese antworten bzw. eigene Nachrichten verfassen kann und somit selbst zum Sender wird. Die Verteilung der Rollen ist folglich aufgehoben, sodass die zwei Aspekte, wer etwas zu wem sagt, zusammenzufassen sind: Im Netzwerk kann who sowohl senden als auch empfangen. Die Abgrenzung zwischen who und whom kann damit wegfallen, sodass sich im Folgenden auf who beschränkt wird. Da sich diese gesendeten Botschaften nicht allein auf das gesprochene bzw. gesendete Wort beschränken und neben dem Senden auch das Empfangen von Botschaften zu integrieren ist, soll says im Folgenden durch das umfassendere kommuniziert ersetzt werden. What entspricht der Nachricht oder der Information, die kommuniziert wird, sodass dieser Aspekt für Netzwerkseiten beizubehalten ist. Wie im folgenden Kapitel weiter ausgeführt wird, kann die Vermittlung von Informationen in Netzwerken auf vielfältige Weise erfolgen: Die Anwender können auf ihren eigenen Profilen, aber auch auf den Profilen anderer Informationen ablegen, sie können diese aber beispielsweise auch über integrierte Chat- oder Mailfunktionen austauschen. Das what soll folglich diese unterschiedlichen Kommunikationsinhalte umfassen. Channel fragt nach dem Kanal, über den die Nachricht gesendet wird und zielt damit auf die technische Komponente bzw. die technische Grundlage der Kommunikation ab. Da Netzwerkseiten mehrere Funktionen vereinen, könnte channel folglich weiter ausdifferenziert werden: Handelt es sich um Bild- oder um Textinformation? Wird diese über die Pinnwand oder den Chat kommuniziert? Aufgrund der psychologischen Perspektive dieser Arbeit sind diese Fragen nicht wesentlich, sodass auf eine Ausdifferenzierung der technischen Details verzichtet wird. Stattdessen wird festgelegt, dass als channel in dieser Arbeit die Soziale Netzwerkseite bzw. die SNS-Profilseiten verstanden werden, über die Kommunikationsinhalte ausgetauscht werden. Der effect zielt abschließend auf die Wirkung inhaltlicher und formaler Aspekte der Nachricht ab. Darunter fallen neben der zu vermittelnden Information, die vielfältigen Auswirkungen sowohl auf Kognitions- als auch auf Emotions- und Verhaltensebene. Da Studien zu Mediennutzungsdaten zeigen, dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit online verbringen und damit auch immer mehr Kommunikation computervermittelt erfolgt (vgl. z. B. ARD/ZDF-Onlinestudie, 2011 unter: www.ard-zdf-onlinestudie.de)2 ist die Frage nach den Effekten der Kommunikation via Sozialer Netzwerkseiten auch auf gesellschaftlicher Ebene zu stellen. Effekte dieser vergleichsweise neuen Kommunikationsform ergeben sich daher nicht nur auf der Mikroebene, sondern auch auf der Meso- und Makroebene. Gefragt werden kann folglich nach den Folgen der Kommunikation für das Individuum, die Kleingruppe und die Gesellschaft (Winterhoff-Spurk, 1999). Von den effects der Kommunikation sollen die (beabsichtigten) Funktionen für den Kommunikator abgegrenzt werden. Denn während effect alle denkbaren Folgen der Kommunikation auf den drei genannten Ebenen zusammenfasst und damit auch die Auswirkungen auf den Kommunikator selbst einschließt, sollen im Folgenden die Funktionen, die die Kommunikation für den Kommunikator erfüllt, gesondert betrachtet werden. Entsprechend ist das Why und damit die Frage nach den Motiven der Kommunikation für den Kommunikator in der Formel zu ergänzen.
Für die Kommunikationssituation in Sozialen Netzwerkseiten resultiert demnach eine modifizierte Variante der Lasswell-Formel, die in Abbildung 1 dargestellt ist. Sender (who) und Empfänger (whom) werden zu einem who zusammenfasst, das nicht mehr nur sendet, sondern auch empfängt, also kommuniziert (communicates). Da der Fokus dieser Arbeit auf psychologischen Aspekten liegt, werden technische Fragen weitestgehend ausgeklammert. Folglich wird für den channel festgelegt, dass dieser die Netzwerkseiten bzw. die Teilbereiche der Profilseiten meint. Auf eine detailliertere Ausdifferenzierung wird verzichtet. Zuletzt wird die Frage nach dem why ergänzt, die auf die Motive des Kommunikators abzielt.
Who communicates why and what (in which channel) with what effect?
Abbildung 1: Lasswell-Formel 2.0: Lasswell-Formel im Kontext Sozialer Netzwerkseiten
Die Lasswell-Formel 2.0 dient für die vorliegende Arbeit als Ordnungsschema, das die theoretischen und empirischen Ausführungen im Folgenden strukturiert. In einem ersten Schritt sollen nun die Sozialen Netzwerkseiten als channel bzw. Kommunikationskanal betrachtet und knapp vorgestellt werden. Auch hier wird dem psychologischen Schwerpunkt dieser Arbeit gefolgt, deswegen wird sich auf die wesentlichen technischen Begriffe und Funktionen beschränkt. Der sich anschließende Forschungsüberblick thematisiert die Lasswell-Formel 2.0 in ihren Teilaspekten (what, why, who). Im darauf folgenden Kapitel 3 beginnt dann der Theorieteil dieser Arbeit, der diese Teilaspekte aufgreift und vertieft sowie offene Fragen ableitet.
2.2 Soziale Netzwerkseiten als Anwendung des Web 2.0
Der Begriff „Web 2.0“, häufig synonym verwendet mit „Social Web“ oder „Social Media“ nimmt Bezug auf die Veränderungen, die das Internet seit dem Zusammenbruch der New Economy im Jahr 2000 prägen. Dabei meint der Begriff keine grundlegende Innovation, sondern bezeichnet eher die Summe neuer Internettechnologien und -anwendungen, die sich im Wesentlichen durch einen grundlegenden sozialen Charakter (Schmidt, 2008) beschreiben lassen und den Nutzer als aktiven Gestalter begreifen (Hippner, 2006). Um diesen sozialen Charakter zu betonen und die Abgrenzung zu bisherigen Internettechnologien und -diensten hervorzuheben, wird die Bezeichnung Web 2.0 verwendet. Dabei bezieht sich der Begriff in dieser Arbeit weniger auf eine exakte Abgrenzung von technischen Entwicklungen, sondern vielmehr auf die aus (medien-) psychologischer Sicht wesentlichen Charakteristiken der Technologien: Wie noch weiter ausgeführt wird, sind Anwender nun auch ohne wesentliches technisches Vorwissen in der Lage, Inhalte zu generieren und im Internet anderen zugänglich zu machen. Hier wird das für diese Arbeit zentrale Unterscheidungsmerkmal zu den bisherigen Internettechnologien erkannt. Denn auch in den Zeiten vor dem Web 2.0 war es den Nutzern möglich, eigene Inhalte zu generieren, allerdings war dazu meist ein wesentlich differenzierteres Vorwissen nötig: Ein Profil in einem Sozialen Netzwerk ist deutlicher einfacher zu realisieren als die Erstellung einer privaten Homepage in den 1990er Jahren, die spezifisc...