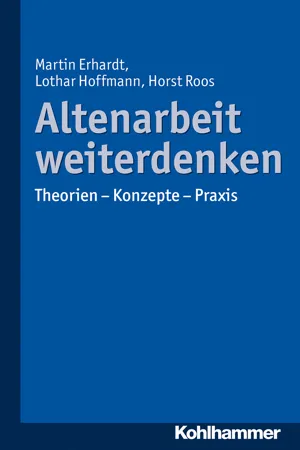![]()
Teil I:
Zusammenhänge erkennen
Braucht die Praxis der Altenarbeit ein theoretisches Hintergrundwissen? Wir meinen: ja. Allzu viel hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Es ist gut, diese Veränderungen zur Sprache zu bringen, um daraus Schlüsse für die Altenarbeit ziehen zu können. Wir gehen auf eine Gesellschaft des langen Lebens zu, eine historisch noch nie dagewesene Situation. Die späte Lebensphase wird nicht nur länger, sie differenziert sich auch mehr und mehr aus. Das Alter hat heute viele Gesichter. Dies wollen wir in 14 Kapiteln entfalten.
Wir gehen darauf ein, welche Auswirkungen die Gesellschaft des langen Lebens auf die Altenarbeit hat (Kap. 1) und wie sich innerkirchlich unsere Wahrnehmung der Lebensphase Alter ändern muss (Kap. 2). Die Theorie des dritten Lebensalters (Kap. 3) verdeutlicht, dass Altenarbeit immer auch spezifische Arbeit für die unterschiedlichen Altengenerationen bedeutet.
Das Kapitel über das Lebenslagenkonzept (Kap. 8) macht auf die Individualität des Alterns aufmerksam und ist die Grundlage für die notwendige Differenzierung auch der Altenarbeit. Unterschiedliche Altersdefinitionen (Kap. 6), das Denken in Milieuperspektiven (Kap. 7) und der Blick auf Genderaspekte (Kap. 4) verdeutlichen, wie komplex und mehrdimensional die Lebensphase Alter sich heute darstellt.
Das Kapitel über die Alter(n)stheorien (Kap. 5) zeigt, wie sehr das Alter auch Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung ist. In den Kapiteln über Alter(n) und Bildung (Kap. 9) und selbstorganisiertes Lernen im Prozess des Alterns (Kap. 10) geht es darum, wie Ältere sich mit ihrem Älterwerden auseinandersetzen. Ein Teil dieses Lernprozesses kann auch das bürgerschaftliche Engagement sein (Kap. 14).
Das Kapitel „Altenarbeit und Kirche im Wandel“ zeigt, dass sich mit der Öffnung für die „jüngeren Älteren“ auch die Kirche selbst verändert (Kap. 11), dabei geht es auch um einen anderen Umgang mit spirituellen Fragen (Kap. 12). Auch von den Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen gibt es viel zu lernen (Kap. 13).
Unsere Hoffnung ist, dass durch die Lektüre Zusammenhänge und Herausforderungen deutlicher werden, dass sich neue Wege in der Altenarbeit zu erkennen geben und dass Lust und Neugierde für eine solche innovative Altenarbeit geweckt werden.
1. Hurra, wir werden älter!? – der soziodemografische Wandel
Die Lebenserwartung hat sich in den vergangenen einhundert Jahren mehr als verdoppelt. Wir leben in Zeiten des demografischen Wandels. Es sind gerade die sogenannten „jungen Alten“, die Verantwortung in der Gesellschaft suchen und wahrnehmen. Für die Kirche sind sie wichtige Träger einer neuen Engagementkultur, werden aber als solche noch zu wenig wahrgenommen. Die Altenarbeit der Zukunft ist eine Altenarbeit von, mit und für alte Menschen.
Hurra! Ja, wir werden immer älter. Zu dieser Entwicklung haben Fortschritte in der medizinischen Versorgung, vor allem der Rückgang der Kindersterblichkeit, die Verbesserung der Hygiene und der gestiegene materielle Wohlstand beigetragen. Diejenigen, die heute in Rente gehen, haben Gott sei Dank auch keinen Krieg erlebt. Ist es nicht wunderbar, die Lebenserwartung der Menschen steigt stetig an? Zum Zeitpunkt der ersten regelmäßigen statistischen Erfassung im Jahr 1871 lag die durchschnittliche Lebenserwartung eines neugeborenen Mädchens bei 38,5 Jahren und die eines Jungen bei 35,6 Jahren.
Heute sieht das so aus: Wir werden immer älter. Die Lebenserwartung „explodiert“ geradezu, während die Bevölkerung in diesem Land schrumpft. Das System Gesellschaft – „Einer trage des anderen Last“ (Galater 6,2) – steht Kopf. Der sogenannte Generationenvertrag bedarf einer Revision. „Das Altern der heute stark besetzten mittleren Jahrgänge führt zu gravierenden Verschiebungen in der Altersstruktur. Im Ausgangsjahr 2008 bestand die Bevölkerung […] zu 20 Prozent aus 65-Jährigen und Älteren. Im Jahr 2060 wird bereits jeder Dritte (34 %) mindestens 65 Lebensjahre durchlebt haben und es werden doppelt so viele 70-Jährige leben, wie Kinder geboren werden.“1 Die Zahl der Hochbetagten wird voraussichtlich von 4 Millionen im Jahr 2008 auf über 10 Millionen im Jahr 2050 anwachsen. Es wird bereits prognostiziert, dass Menschen bald 120 Jahre alt werden könnten.
Paul B. Baltes bringt es so auf den Punkt: „Die heutigen Alten sind, was ihre Vitalität angeht, ‚jünger‘ als die Gleichaltrigen aus früheren Generationen. Die heutigen 70-Jährigen sind geistig und körperlich so fit wie die 60 – 65-Jährigen vor 30 Jahren.“2
Bevölkerungsprognose 2060
In Deutschland werden nach einer Prognose des Statistischen Bundesamtes3 bis 2060 hochgerechnet nur noch 16 Prozent der deutschen Bevölkerung jünger als 20 Jahre sein. Über ein Drittel der Bevölkerung ist zum gleichen Zeitpunkt über 65 Jahre.
Für diese Entwicklung gibt es drei Gründe:
- Die Geburten gehen zurück.
Gegenwärtig liegt die Geburtenrate bei 1,4 Kindern je Frau. Diese Zahl reicht bei weitem nicht aus, um die derzeitige Bevölkerungszahl zu halten.
- Die Lebenserwartung steigt.
Die Menschen bleiben länger körperlich und geistig fit und gesund. 2060 werden voraussichtlich 14 Prozent älter als 80 Jahre sein. Und die Zahl der Hundertjährigen wird einen nie gekannten Höchststand erreichen.
- Zuwanderung und Integration haben keine Basis.
Deutschland ist kein Einwanderungsland. Die Migrationspolitik hat einen schlechten Ruf. Diskriminierung führt dazu, dass dringend gebrauchte Fachkräfte aus dem Ausland wegbleiben.
Politiker und Statistiker ziehen nicht immer die gleichen Schlüsse
Natürlich lassen sich solche weit in die Zukunft reichenden Prognosen auch kritisch hinterfragen. Unvorhersehbare Ereignisse können die Vorausberechnungen auf den Kopf stellen. Für Gerd Bosbach sind solche Vorausberechnungen „moderne Kaffeesatzleserei“.4 Er weist darauf hin, wie fraglich solche Bevölkerungsprognosen sein können, wenn er die vergangene 50-Jahres-Prognose (von 1950 – 2000) bilanziert. Wer hätte 1950 abschätzen können, dass die Antibabypille, der Zuzug von ausländischen Arbeitskräften, der Trend zur Kleinfamilie, die Überwindung der deutschen Teilung oder die Öffnung der osteuropäischen Grenzen eintreten würden?
Bernhard Braun merkt kritisch an, dass Politiker und Wirtschaftsmanager mit dem Schlagwort demografischer Wandel argumentieren, um mit diesen „Kernbehauptungen seit Jahren den faktischen und geplanten Umbau von Sozialsystemen [zu] rechtfertigen“.5 Es dient nur dazu, die Ungerechtigkeit in den Verteilungssystemen zu verschleiern. Am demografischen Wandel entscheidet sich die Gerechtigkeitsfrage in der Gesellschaft. Umverteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse und „Verbesserung der Qualifizierung und Bildung“6 tragen nach Braun zur Stabilisierung der Lebensverhältnisse bei und zwar für alle – für jung und alt gleichermaßen. „Ein Teil der Debatte dient offensichtlich dazu, dem Alter Effekte anzuhängen, die in Wirklichkeit entweder Folgen von Umverteilungsprozessen oder von politischem Immobilismus oder massiv interessengeleiteter Prioritätensetzung sind.“7 Und das alles auf den Schultern der älterwerdenden Generation?
Die Konsequenzen sind schon lange sichtbar
Unternehmen haben sich aus der Ausbildung des Berufsnachwuchses zurückgezogen, klagen aber selbst über die schlechte Schulpolitik, statt die eigene soziale Verantwortung wahrzunehmen. Sozialleistungen schießen in unbezahlbare Höhen.
Die in gleichen Anteilen aufzubringenden Sozialleistungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind seit 2009 Geschichte. Wenige Profiteure reiben sich die Hände. Die Armut im Alter, aber auch besonders die von Kindern, nimmt ständig zu. Der Generationenvertrag funktioniert nicht mehr. Viele befürchten, dass sie ihre Pflege nicht mehr bezahlen können, während andere in komfortablen Seniorenresidenzen wohnen. Beitragszahler in die Sozialversicherung können heute schon nicht mehr das Defizit für die Rentenempfänger ausgleichen. Die Jungen sind gefordert, schon heute zusätzlich privat für ihre Zukunft vorzusorgen.
Möglicherweise steuern wir auf einen Arbeitskräftemangel zu, vergleichbar mit den 60er Jahren. Damals kamen Gastarbeiter, heute kommen zu wenige. Durch schlechte Bildungschancen hierzulande wird die Zahl unqualifizierter Kräfte auf dem Arbeitsmarkt nicht abgemildert. Eine bessere Integrationspolitik würde Chancen eröffnen und dazu beitragen, Arbeitskräfte zu qualifizieren.
Frauen haben es nach wie vor schwer, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren. „Die Bevölkerung im Erwerbsalter geht […] nach 2020 deutlich zurück. Eine höhere Zuwanderung würde diesen Rückgang bremsen, aber nicht verhindern. […] Insgesamt nimmt das Arbeitskräfteangebot ab und die älteren Menschen im Erwerbsalter werden wichtiger für den Arbeitsmarkt.“8
Sicher gibt es genügend Menschen, die einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und noch gern länger arbeiten würden. Andererseits gibt es Bereiche, in denen Menschen über 55 Jahre durch Arbeit ausgezehrt sind. Die einen würden gern sinnvoll tätig sein und weiter arbeiten (eventuell in Teilzeit). Es sind aber keine Anreize in Sicht, auch zu wenig Angebote vorhanden. Kompetenzen aus langjähriger Berufserfahrung gehen verloren. Das Rentenalter lässt keine Flexi...