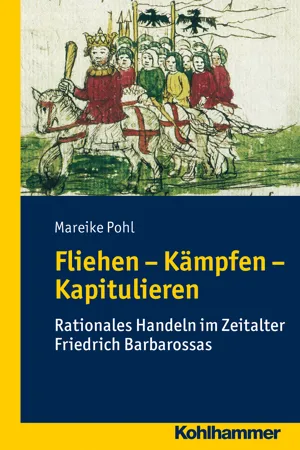![]()
1 EINLEITUNG
1.1 Menschliches Handeln – Alterität oder Kontinuität?
Als Vinzenz von Prag, böhmischer Chronist und Teilnehmer des zweiten Italienzugs Barbarossas im Jahr 1158 an den Ufern der Adda vor den reißenden Fluten stand, die es zu überqueren galt, gingen seine Gedanken in folgende Richtung:
„Ich aber, Vinzenz, sah es für schlecht an, mich in solche Gefahr zu stürzen und zögerte. Ich dachte darüber nach, was in solch einer Situation zu tun nötig sei, und ließ mir eher vom Wohlergehen als vom Wagemut raten. Und so zog ich mit meinen Reisegefährten weiter, zusammen mit den Pavesen, die das Heer mit Lebensmitteln versorgten, und denen Wege und Brücken bekannt waren, zum Lager des Herzogs von Kärnten, der flussaufwärts eine starke Festung gegenüber der Burg Trezzo bezogen hatte, und verbrachte so die Nacht, wie es die Umstände erforderten. Am nächsten Morgen, am Fest des Heiligen Jakobus, überschritten ich und meine Gefährten unbeschadet all unserer Habe auf der Brücke des Kaisers sicher den Fluss. So kamen wir zum Lager unseres Königs [der Böhmen] und des Herrn Bischofs [von Prag], wo wir erfuhren, dass viele ertrunken waren, darunter auch Mladorka, der Schildträger unseres Bischofs.“1
Vinzenz hatte Angst, sich in die Fluten zu stürzen. Sein Leben, sein physisches Wohlbefinden war gefährdet. Dieses Risiko beurteilt er als malum, die Sicherung seines Lebens (salus) erhält den Vorzug vor Kühnheit (audacia). Die naheliegende Alternative, an Ort und Stelle den Fluss zu überqueren, war wenig verheißungsvoll. Die Wahrscheinlichkeit dabei zu ertrinken erschien Vinzenz viel zu hoch, so dass er begann, über mögliche Alternativen nachzudenken. Was konnte er tun, um das Risiko zu minimieren? Es musste einen besseren, einfacheren Weg über den Fluss geben. Und was ist in solch einer Situation naheliegender, als sich um weitere Informationen an Ortskundige zu wenden, in diesem Fall an einige im Heer mitziehende Bewohner der Stadt Pavia.
In der Tat offenbarte sich die Entscheidung als weise. Der sichere Übergang, ohne Verlust an Leben und Gütern, gelang über die flussaufwärts gelegene Brücke bei Cassano, über die auch Barbarossa selbst zog, der sich ebenfalls nicht blindlings in Gefahr begab.2 Die Nachricht vom Ertrinken einiger Landsleute bestätigte Vinzenz im Nachhinein, dass sein Handeln klug war. Diese sehr persönliche Beschreibung von Vinzenz‘ Ängsten, seinen Überlegungen und Bemühungen, der womöglich lebensgefährlichen Situation zu entrinnen, und schließlich die Strategie, mit der er die Lage meisterte, sind für den heutigen Leser unmittelbar eingängig und bedürfen eigentlich keiner weiteren Interpretation, um verstanden zu werden. Die „Fremdheit“ des mittelalterlichen Akteurs und seiner Handlungsweise sucht man in dieser Stelle vergeblich.
In der jüngeren Forschung wurde und wird wiederholt diese Fremdheit und Andersartigkeit, die „Alterität“ des Mittelalters betont.3 Im Wissen um die Gefahr, die eigenen Verhältnisse unkritisch auf die Vergangenheit zu übertragen, betonten Mittelalterhistoriker oft mehr die Unterschiede zur eigenen Gegenwart als die Gemeinsamkeiten. Diese Forschungstradition lenkte den Blick auf bis dahin kaum wahrgenommene, wichtige Aspekte des mittelalterlichen Lebens und half, das Bewusstsein der Forschung für das Risiko anachronistischer Fehlschlüsse zu sensibilisieren.
Die Fremdheit und bunte Exotik des Mittelalters erklärt auch, warum sich gerade diese Epoche, gewissermaßen als Utopie ferner Zeiten, in breiten Schichten der Bevölkerung so großer Beliebtheit erfreut. Nicht nur in unzähligen historischen Romanen, sondern auch auf „mittelalterlichen“ Events werden Klischees und Vorstellungen über das Mittelalter kolportiert. Damals habe man noch im Einklang mit der Natur gelebt, alles war bunt, das Leben einfach und überschaubar. Es war eine Welt, in der es noch echte Helden gab, die auf edlen Rössern in schimmernder Rüstung mit bunten Wimpeln in die Schlacht zogen, um für die Ehre zu kämpfen. Eine Zeit, in der es noch echte Werte gab, fernab von Kapitalismus und Zweckdenken. Der andere Aspekt, der den Erfolg des Mittelalters besonders in Buch und Film möglich macht, ist aber genau der der Ähnlichkeit. Handlungen, Entscheidungen und Gefühle müssen nachvollziehbar sein, damit sich der heutige Betrachter mit der Roman- oder Filmfigur identifizieren kann. Der Mensch des Mittelalters war eben doch nicht zu anders, hatte im Prinzip dieselben Probleme wie wir heute, so die Botschaft vieler historischer Romane und Filme.
Gerne wird in der Forschung die Fremdheit des Mittelalters betont, die Schwierigkeit, das Denken und Handeln mittelalterlicher Menschen nachzuvollziehen. Einen Herrscher etwa als Individuum zu fassen, sei fast unmöglich, man müsse ihn „aus seiner Zeit heraus“ verstehen.4 Doch so lange niemand eine Zeitmaschine erfindet, mit der wir eventuell bessere Chancen dazu hätten, ist doch sehr fraglich, ob wir das überhaupt können und ob es auf Dauer Sinn macht, eine solche Forderung wieder und wieder zu stellen. Unter der Prämisse der Alterität läuft man auch als Historiker Gefahr, das Mittelalter als scheinbaren Gegenentwurf zu unserer Zeit wahrzunehmen oder gar zu konstruieren. Hier beginnt sich langsam eine Trendwende abzuzeichnen. Der Germanist Manuel Braun aus Stuttgart setzt sich kritisch mit dem Alteritätskonzept auseinander und warnt: „Die Mediävistik verzeichnet das Bild vom Mittelalter, wenn sie dieses nur noch unter der Perspektive der Alterität wahrnimmt.“5 Er fordert daher „die Gegenperspektive einzunehmen und zu fragen, ob unser Bild vom Mittelalter nicht klarer und kompletter wird, wenn wir wieder stärker auf Konstanten achten.“6
Die vorliegende Dissertation befasst sich unter anderem auch mit dieser eigentlich grundlegenden methodischen Frage: Wenn das Mittelalter wirklich so anders war, haben wir dann überhaupt eine Chance, mittelalterliche Akteure und ihr Handeln zu verstehen? Und wenn ja, warum? Es erscheint daher sinnvoll, nach der Kontinuität von Handeln, nach Gemeinsamkeiten und anthropologischen Konstanten zu suchen, und nicht unbedingt in erster Linie nach dem, was „anders“ war. Denn wirkliche, nicht nur konstruierte Alterität, können wir heute sowieso nur schwer verstehen und erklären, wir können sie oft nur feststellen.7 Wir haben kein Problem, einem römischen Feldherrn wie Cäsar rationales Zweckdenken und kaltes Kalkül zu unterstellen, bei mittelalterlichen Akteuren tun wir uns damit viel schwerer. Ist es vielleicht an der Zeit, sich von beliebten und unbewusst gehegten Klischees zu befreien?
In meiner Dissertation geht es, kurz gefasst, um Handeln und Entscheiden in der Zeit Kaiser Friedrich Barbarossas. Im Gegensatz zu vielen anderen mediävistischen Forschungen, die der Alterität des Mittelalters Rechnung tragen wollen und die Fremdheit dieser Epoche betonen, geht die vorliegende Arbeit eher den umgekehrten Weg und sucht nach der Kontinuität von Handlungsmotiven und Entscheidungsprozessen. Hier ist der Blick über den eigenen fachlichen Horizont auf die Nachbardisziplinen besonders lohnend, denn mit menschlichem Handeln haben sich vor allem Soziologen ausführlich beschäftigt. Wichtige methodische Orientierungshilfe leisten daher sogenannte soziologische Handlungstheorien. Damit sind Theorien gemeint, „die sinnhaftes Handeln von Individuen oder Gruppen in sozialen Interaktionen erklären.“8 Oder anders formuliert: Soziologische Handlungstheorie bedeutet „die Summe der Einzelansätze zur Erklärung sozialen Handelns“.9 Im Vordergrund steht dabei auch die Frage nach der „Rationalität“ menschlichen Handelns. Was damit genau gemeint sein mag, bleibt noch zu klären. Auch die Rolle der „Ehre“ als auf den ersten Blick scheinbar typisches Handlungsmotiv mittelalterlicher Akteure – besonders Barbarossas und seiner Ritter – wird in der Arbeit thematisiert.
Durch die Verwendung eines übergeordneten, soziologischen Modells könnte es gelingen, Handeln über das in den einzelnen Quellen Dargestellte hinaus zu deuten, bzw. ein Muster zu finden, wie in der Zeit Barbarossas in bestimmten Situationen Entscheidungen getroffen und erklärt wurden.
Manchem mag es paradox erscheinen, eine moderne Handlungstheorie auf das Mittelalter anzuwenden. Aber „gerade ferne Zeiten wie das Mittelalter sind enorm theoriebedürftig, weil die Erklärungen der damaligen (meist kirchlich denkenden) Zeitgenossen uns heute kaum befriedigen können.“10 Implizit gehen letztlich auch viele Mediävisten davon aus, dass mittelalterliches Handeln prinzipiell nachvollziehbar ist, dass es gewisse anthropologische Konstanten gibt, meist jedoch ohne sich theoretisch und methodisch damit auseinanderzusetzen und ohne diese implizite Annahme kenntlich zu machen. Das in der Mediävistik weit verbreitete mangelnde Theoriebewusstsein wurde schon mehrfach kritisiert, etwa von Hans-Werner Goetz, „denn es bedeutet keineswegs Theorielosigkeit, sondern unreflektierte Theorieimmanenz.“11
Ziel der Darstellung ist es, am Beispiel Friedrich Barbarossas und seiner Zeitgenossen alternative Ansätze zur Erklärung mittelalterlichen Handelns zu finden. Es wird geprüft, ob soziologische Modelle wie die Austauschtheorie und besonders die Rational-Choice-Theorie eine neue Sichtweise ermöglichen, bisherige Ansichten widerlegen oder eingliedern können. Bei den verwendeten Modellen geht es um bewusstes, intentionales Handeln in einer konkreten Situation. Die Rational-Choice-Theorie ist die Theorie der rationalen Wahl. Das Grundprinzip lautet, dass ein Akteur in einer Entscheidungssituation immer die Handlungsalternative wählt, die abzüglich der Kosten den größtmöglichen Nutzen zu bringen verspricht.
Die oben zitierte Textstelle aus Vinzenz von Prag enthält in ihrer klaren Nachvollziehbarkeit bereits einen Großteil dessen, was Rational-Choice-Theorie ausmacht: In jeder Situation gibt es Handlungsalternativen, zwischen denen ein Akteur wählen kann. Ist eine Alternative wenig vielversprechend, wie etwa der Übergang eines reiß...