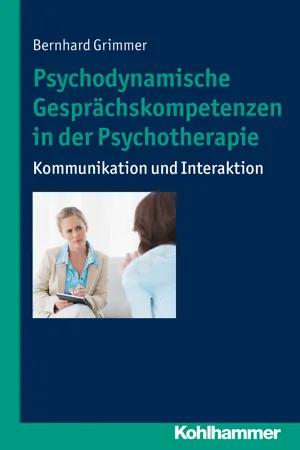
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Psychodynamische Gesprächskompetenzen in der Psychotherapie
Kommunikation und Interaktion
- 184 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Psychodynamische Gesprächskompetenzen in der Psychotherapie
Kommunikation und Interaktion
Über dieses Buch
Die meisten Psychotherapieverfahren und Beratungen finden in Form von Gesprächen statt. Dafür werden spezifische Kompetenzen benötigt, denn jede Intervention muss in Gesprächshandeln übersetzt werden. Der Prozess konstituiert sich über sprachliche und nichtsprachliche Kommunikation. Was eine gelingende psychodynamische Gesprächssteuerung ausmacht, wie sich eine neutrale Haltung kommunikativ realisieren lässt, wie es zu einer stabilen und kooperativen Gesprächssituation kommt und wann zu Störungen und Irritationen derselben, wird in diesem Buch anhand von zahlreichen Ausschnitten aus Erstgesprächen erläutert.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Psychodynamische Gesprächskompetenzen in der Psychotherapie von Bernhard Grimmer im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychologie & Psychotherapie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
1.1 Psychotherapie als Gespräch
Was immer auch Psychotherapie ist – ob Körpertherapie, Psychodrama mit Rollenspiel, Konfrontation- oder Expositionstherapie: Psychotherapie ist immer auch Gespräch, jedenfalls sofern sie noch im unmittelbaren, direkten und persönlichen Kontakt stattfindet und nicht mittelbar in Form moderner Kommunikationstechnologie wie im Falle der Internettherapie. Meistens ist Psychotherapie vor allem ein Gespräch (Gesprächstherapie, bestimmte Formen kognitiver Verhaltenstherapie, psychodynamische Therapien). In den Behandlungstheorien und -techniken finden sich verschiedene sprachliche Interventionen und Empfehlungen zur Gesprächsführung, wie das aktive Zuhören und empathische Spiegeln in der klientenzentrierten Gesprächsführung, der sokratische Dialog in der rational-emotiven Therapie oder die Deutung in der Psychoanalyse. Besonders die schon von einer frühen Patientin Freuds als Talking Cure bezeichnete klassische Psychoanalyse sieht ihre Wirkung in Deutungen des Analytikers, die die Bewusstwerdung bisher unbewusster Konflikte des Analysanden ermöglichen sollte, indem sie zur Sprache kommen.
Die behandlungstheoretischen Empfehlungen der verschiedenen Therapieverfahren beschäftigen sich mit der sprachlichen Kommunikation im Therapieprozess vor allem als bewusst und geplant eingesetzte, lernbare verbale Interventionsformen der Therapeuten. Basierend auf Theorien und Konzepten werden sie als heute zum Teil manualisierte Techniken verstanden, mit denen die Patienten behandelt werden.
Psychotherapie als Gespräch zu verstehen und zu untersuchen, geht darüber hinaus. In der internationalen Gesprächsforschung (Ten Have, 2004; Silvermann, 2006) unterscheidet man verschiedene Dimensionen, die für das Zustandekommen und den Ablauf von Gesprächen konstitutiv sind. Sie lassen sich nach Deppermann (2001, S. 8–9) wie folgt charakterisieren.
Gespräche sind
• prozesshaft: Sie entwickeln sich in der Zeit; sie sind flüchtig und offen; sie sind nur bedingt planbar.
• methodisch produziert: Die Teilnehmer benutzen kulturell verbreitete und erwartete Praktiken, um den Gesprächsablauf zu organisieren.
• pragmatisch orientiert: Sie dienen der Bearbeitung von Aufgaben und Zielen, individuellen oder gemeinsamen.
• sprachlich und nichtsprachlich konstituiert: Sie entstehen durch Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen (Sprache, Stimme, Mimik, Gestik).
• interaktiv hergestellt: Sie werden aus dem Wechselspiel von Handlungen aufeinander bezogener Teilnehmer hervorgebracht.
Ein psychotherapeutisches Gespräch entsteht Zug um Zug aus sprachlichen und nichtsprachlichen Handlungen der Teilnehmer, die ihre jeweils eigene Form von Kommunikation interaktiv herstellen und sich dabei an Zielen und Aufgaben orientieren. Sie definieren und konstruieren ihre soziale Situation »Psychotherapie« im zeitlichen Verlauf als Produkt ihres gemeinsamen Handelns. Wie dies abläuft und was sie dabei tun, dass es zu einem psychoanalytischen oder einem kognitiv-verhaltenstherapeutischem Gespräch wird, lässt sich rekonstruieren, wenn man Therapiegespräche audiovisuell aufnimmt und die Prozesse gesprächsanalytisch untersucht. Die therapeutischen Techniken der verschiedenen Verfahren, die in Form sprachlicher Interventionen eingesetzt werden, müssen in Gesprächsverhalten übersetzt werden, um wirksam zu werden. Da der Gesprächsablauf immer Produkt aller Beteiligter ist, können sie auch nur gemeinsam eine Gesprächssituation realisieren, in der therapeutische Konzepte von Interventionen sprachlich Gestalt annehmen. Beispielsweise kann eine Deutung nur stattfinden, wenn ein Patient vorher Material berichtet hat, auf das sich die Deutung beziehen kann. Sie kann nur eine Wirkung entfalten, wenn sie für den Patienten in irgendeiner Weise anschlussfähig, verständlich, nachvollziehbar ist und sich als Thema etablieren lässt.
1.2 Psychodynamik und Kommunikation im Erstgespräch
Psychodynamische Psychotherapien sind die ältesten und in der Praxis nach wie vor am häufigsten zur Anwendung kommenden psychotherapeutischen Verfahren.1 Sehr verallgemeinert gesprochen soll in psychodynamischen Psychotherapien die psychische Dynamik des Patienten zum Thema werden, indem sie in der Beziehung zum Therapeuten interpsychisch inszeniert, erfahrbar wie verbalisierbar und so der Veränderung zugänglich gemacht wird. Neben den allgemein gültigen Richtlinien gibt es besondere vorgegebene Rahmenbedingungen und Handlungsschemata der psychodynamischen Verfahren, die die Kommunikationsmöglichkeiten in der Therapiesituation beeinflussen. Beispielsweise verändert die behandlungstechnische Vorgabe des liegenden Settings in der klassischen Analyse die Möglichkeiten, nichtsprachliches Verhalten zur Kommunikationsregulierung und Gesprächsorganisation einzubeziehen. Oder eine Realisierung der behandlungstechnischen Maxime der Übertragungsanalyse, die das gegenwärtige Beziehungsgeschehen fokussiert, führt zwangsläufig zu einer Intensivierung von Metakommunikation – also der Kommunikation über die gerade stattfindende Kommunikation zwischen Therapeut und Patient.
Das Erstgespräch einer psychodynamischen Psychotherapie lässt sich als eigenständige Einheit betrachten, die gegenüber späteren Sitzungen spezifische Funktionen zu erfüllen hat:
• Es dient der Diagnostik und Indikationsstellung, was vor allem bedeutet, die grundsätzliche Eignung eines Patienten für ein analytisches Verfahren zu prüfen.
• Dem Patienten soll ein Raum zur Verfügung gestellt werden, in dem er seine Psychodynamik in Grundzügen bereits inszenierend zur Darstellung bringen kann.
• Der Patient soll die analytische Arbeitsweise von Anfang an erleben, um einen Eindruck davon zu erhalten, worauf er sich einlässt.
• Schließlich soll eine gegenseitige Beziehungsaufnahme stattfinden, um zu prüfen, ob beide zusammenpassen und Aussicht besteht, dass sich mit der Zeit ein stabiles Arbeitsbündnis entwickeln kann.
Es bestehen zahlreiche behandlungstheoretische Beschreibungen, in denen idealtypisch und oft normativ vorgegeben wird, wie ein psychodynamisches Erstgespräch abzulaufen hat, unterlegt mit einzelnen retrospektiv formulierten Fallbeispielen (Shapiro, 1984; Armstrong, 2000; Argelander, 1970; Eckstaedt, 1995). Es gibt aber kaum detaillierte empirische Untersuchungen, wie solche Erstgespräche realiter ablaufen und interaktiv hergestellt werden (Wilke, 1992). Allgemein gilt für Psychotherapien, dass oft schon der Verlauf der Erstgespräche darüber entscheidet, ob Patienten sich für eine Therapie motivieren lassen, ob sie die passende Therapieempfehlung erhalten und Hoffnung gewinnen, ihre Probleme lösen zu können. Gleichwohl sind all diese Prozesse, wie Eckert, Barnow, Richter (2010, S. 10) konstatieren, in der ersten Begegnung bisher noch nicht ausreichend erforscht.
In der psychoanalytischen Tradition der Beschäftigung mit dem Erstgespräch stand bisher die Inszenierung der inneren Psychodynamik des Patienten im Zentrum des Interesses. Das Gespräch soll so gestaltet werden, dass bereits im Erstkontakt eine nicht direkt beobachtbare und als konflikthaft gedachte psychische Realität aus dem sprachlichen und nichtsprachlichen Interaktionsverhalten erschlossen werden kann (Argelander, 1970; Laimböck, 2000; Wegner, 2000). Der Charakter des Gesprächs und die gemeinsame Kommunikation interessierten insofern, wie sie diesen Prozess ermöglichen oder behindern. Folgerichtig wurden vor allem normativ therapeutische Haltungen formuliert (Abstinenz, Neutralität, gleichschwebende Aufmerksamkeit), aus denen dann die passende Gesprächsführung des Therapeuten entstehen soll.
Die neueren Entwicklungen innerhalb der Psychoanalyse führen dazu, kommunikative Prozesse vielmehr als gemeinsames Produkt von Therapeuten und Patienten zu begreifen. Das frühe monadische Denken, in dem ein Psychoanalytiker unabhängig und abstinent von außen die Dynamik zwischen den psychischen Instanzen im Inneren des Patienten deutet und bewusst macht, ist mehr und mehr einem intersubjektiven Verständnis gewichen, das alles, was im therapeutischen Prozess geschieht, als gemeinsame intersubjektive Konstruktion wechselseitiger Beeinflussung ansieht (Stolorow, Branchaft & Atwood, 1996; Mitchell, 2000; Altmeyer, 2011). Diese veränderte Sichtweise wurde zwar inzwischen hinlänglich mit ganz unterschiedlichen Konzepten und Begrifflichkeiten theoretisch beschrieben und anhand von Fallberichten aus Sicht der Analytiker erläutert, die empirische Analyse interaktioneller Prozesse des Therapiegeschehens steht aber noch am Anfang. Nachdem die Wirksamkeit psychodynamischer Therapien inzwischen belegt ist (Shedler, 2011), gilt das Verständnis dieser Prozesse als zentrales Forschungsdesiderat in der Psychoanalyse (Fonagy, 2010, zitiert nach Altmeyer, 2011, S. 110). Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung reicht es nicht mehr, psychodynamische Erstgespräche nur unter der einseitigen Perspektive normativ formulierter Anleitungen für ein therapeutisches Handeln zu betrachten, das günstige Bedingungen für die Beobachtung der Psychodynamik des Patienten schafft. Es sollte vielmehr darum gehen, die interaktionellen Konstruktionsprozesse, aus denen psychodynamische Erstgespräche im aufeinander bezogenen Handeln von Therapeuten und Patienten entstehen, zu untersuchen und zu verstehen.
Schon länger existiert eine Tradition linguistischer Erforschung von Psychotherapie (Labov & Fanshels, 1977; Koerfer & Neumann, 1982; Flader & Grodzicki, 1982; Egbert & Bergmann, 2004; Deppermann & Lucius-Hoene, 2005; Heritage & Maynard, 2006; Scarvaglieri, 2011; Gülich, 2012; Streeck, 2012). Allerdings verlief diese Forschung bisher unsystematisch und mit wenig wechselseitigen Bezügen. Die verschiedenen Autoren untersuchten unabhängig voneinander verschiedene Aspekte der Gespräche, wobei die Ergebnisse kaum integriert wurden (Scarvalgieri, 2011). Detaillierte Interaktionsprozesse mit qualitativen Forschungsmethoden gesprächsanalytisch zu untersuchen ist aufwendig, zudem dauern psychoanalytische Therapien oft sehr lange und liefern entsprechend viel Untersuchungsmaterial. Dies sind zwei Gründe, warum sich bisherige linguistische Arbeiten zur Psychoanalyse entweder auf einzelne Phänomene wie Schweigen, Hörersignale oder Deutungen konzentriert haben oder nur Einzelfälle als Datengrundlage heranzogen. Erstgespräche, die sich wie beschrieben als besondere und eigenständige Einheiten innerhalb einer psychodynamischen Psychotherapie betrachten lassen, bieten sich deshalb als klar abgrenzbarer Untersuchungsgegenstand an, um unterschiedliche Aspekte psychodynamischer Gesprächskompetenzen erfassen und integrieren zu können.
Es lassen sich zwei unterschiedliche Perspektiven auf psychodynamische Erstgespräche unterscheiden: Auf der einen Seite interessieren sich psychoanalytische Forscher vor allem für die Psychodynamik im Inneren des Patienten, die in der Begegnung sichtbar gemacht werden sollte, und vernachlässigen dabei den Gesprächscharakter und die gemeinsame Kommunikation. Auf der anderen Seite interessieren sich die sprachwissenschaftlichen Untersuchungen für die Besonderheiten dieses Gesprächstyps, untersuchen die beobachtbare Kommunikation und klammern die psychodynamischen und intentionalen Prozesse im Patienten aus. Die psychoanalytischen Abhandlungen nehmen somit vor allem das »Was« in den Blick, den Inhalt der Gespräche und die unbewusst wirksamen Motive des Patienten, während sprachwissenschaftliche Untersuchungen das »Wie«, die Form und die Kommunikation zwischen Therapeut und Patient beleuchten.
1.3 Kompetenzen in der psychodynamischen Psychotherapie
Seit einiger Zeit lässt sich in verschiedenen wissenschaftlichen und (wissenschafts-) politischen Kontexten wie zur Beschreibung von »good practice« in unterschiedlichen Berufsfeldern eine häufige und weit verbreite Verwendung des Kompetenzbegriffs beobachten. In den letzten 15 Jahren sind im Zuge der sogenannten »kompetenzorientierten Wende« vor allem in der Soziologie, der Pädagogik und der Psychologie zahlreiche Arbeiten erschienen, die sich der inzwischen häufig auch kritisch reflektierten Verwendung des Kompetenzbegriffs widmen (Pfadenhauer, 2010, S. 149). In den einzelnen Disziplinen existieren engere oder umfassendere Definitionen von Kompetenz (Pfadenhauer, 2010; Vonken, 2005), dabei lassen sich allgemein drei Komponenten des Kompetenzbegriffs bestimmen, von denen jeweils bestimmte Aspekte in den verschiedenen Definitionen mehr oder weniger betont werden: die Fähigkeit, die Bereitschaft und die Zuständigkeit zur Aufgabenbewältigung oder zum Handeln in einem bestimmten Kontext.
In der Psychologie fand der Kompetenzbegriff lange insbesondere in der differentiellen und der pädagogischen Psychologie Anwendung. Dort ist er vor allem im Kontrast zur Intelligenzmessung bestimmt als erlernbare »kontextspezifische Leistungsdispositionen« (Klieme, Maag-Merki & Hartig, 2007, S. 6).
Seit einigen Jahren erfährt der Kompetenzbegriff eine verstärkte Verwendung und hohe Wertschätzung, vor allem von Amerika ausgehend, mit dem Ziel, Fähigkeiten zu professionellem psychologischem Handeln zu definieren und zu messen. Eine Wende hin zu einer »Kultur der Kompetenz« (Roberts, Borden & Christiansen, 2005) wird gefordert. Die Amerikanische Psychologische Vereinigung (APA), hat eine Task Force ins Leben gerufen, um zu bestimmen, was die zentralen Kompetenzen professioneller Psychologen ausmacht und wie diese Kompetenzen gemessen werden können (APA Task Force, 2006). Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in der Medizin. In den USA und England (Lemma, Roth & Pilling, 2012) gab es Bestrebungen, Basiskompetenzen professionellen ärztlichen und psychologischen Handelns zu bestimmen. Besonders berufspolitische Entscheidungen haben diese vorangetrieben. Je allgemeiner die Definitionen von professionellen psychologischen oder medizinischen Kompetenzen sind, umso eher finden Aspekte von Kommunikation und Gesprächsführung Berücksichtigung (Rider & Keefer, 2006, S. 626).
Kompetenzen in der psychodynamischen Psychotherapie
Auch für psychodynamische Therapien gibt es inzwischen einige Ansätze, eine kompetente von ei...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Copyright
- Inhalt
- 1 Einleitung
- 2 Psychodynamische Erstgespräche
- 3 Gesprächsanalyse psychodynamischer Psychotherapie
- 4 Therapeutische Gesprächskompetenzen in Erstgesprächen
- 5 Psychodynamische Gesprächskompetenzen
- Literaturverzeichnis
- Anhang: Transkriptionsregeln
- Register