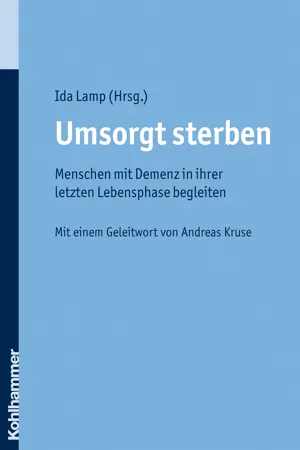![]()
1 Sterben und Demenz
1.1 Wann und woran sterben Menschen mit Demenz?
Martin Haupt
Die Häufigkeit von Demenzerkrankungen, also von ausgeprägten Störungen der Hirnleistung, wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten mit dem steigenden Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung weiter zunehmen. Auch wenn Demenzen bereits im 3. oder 4. Lebensjahrzehnt vorkommen können, tritt die weitaus größte Zahl der Krankheitsfälle doch nach dem 70. Lebensjahr auf. Insbesondere diejenigen Demenzursachen, die zu einem fortschreitenden Verlust von Nervenzellen in unterschiedlichen Gebieten des Gehirns führen (sog. degenerative Formen), und diejenigen, die eine allmählich zunehmende Beeinträchtigung der Durchblutung des Gehirns nach sich ziehen (sog. vaskuläre Formen), sind mit Abstand die häufigsten Ursache für Demenzen im hohen Lebensalter. Insofern konzentriert sich die ärztliche Erkennung der Demenzursache nach dem 70. Lebensjahr v. a. auf diese beiden Formengruppen, da andere Demenzursachen seltener werden, beispielsweise Stoffwechselstörungen (z. B. Vitaminstoffwechsel), hormonelle Erkrankungen (z. B. Schilddrüsenunterfunktion), Bluterkrankungen (z. B. Vermehrung von Blutkörperchen: Polyzytämie) oder langsam wachsende Tumoren (z. B. Hirnhauttumore: Meningeom). Gleichwohl stehen bei diesem diagnostischen Zugangsweg nicht allein die Alzheimer-Demenz und vaskuläre Demenz sowie Mischformen aus beiden Erkrankungen im Mittelpunkt der Betrachtung, sondern durchaus auch Demenzen bei Parkinson Krankheit, die Demenz mit Lewy-Körperchen oder Demenzformen bei Stirnhirnerkrankungen. Auch in der letzten Lebensphase können auftretende depressive Verstimmungen so stark ausgeprägt sein, dass bei dem Betroffenen das Symptombild mit Antriebs- und Interesselosigkeit sowie Störungen der Merkfähigkeit und der Konzentrationsleistung wie eine Demenz erscheinen kann.
Dies bedeutet einerseits, dass sich die ärztliche Diagnostik im Praxisalltag auf einige Kernursachen der Demenzprozesse beschränken darf, auch wenn seltenere Ursachen mit zu bedenken sind. Die Erkennung der Erkrankung wird sich zudem besonders im höheren Lebensalter und in Anbetracht des hier im Mittelpunkt stehenden Zeitraums der letzten Lebensphase auf die Einbußen konzentrieren, die noch vorhandene Funktionen und Fertigkeiten im täglichen Leben beeinträchtigen oder zu einer Verschlechterung von bereits gestörten Funktionsbereichen führen. Hier sind innerhalb der Demenzsymptomatik die Stimmungs- und Verhaltensauffälligkeiten gemeint, zu denen Unruhezustände, unvermittelte abwehrende, unter Umständen auch aggressive Verhaltensweisen gehören, wie auch Antriebs- und Teilnahmslosigkeit oder auch wahnhafte Verkennungen und Sinnestäuschungen. Darüber hinaus muss bei der Einordnung solcher Auffälligkeiten bei Menschen mit Demenz sorgfältig die meist gleichzeitig bestehenden körperlichen Erkrankungen und die damit verknüpfte Medikation, auch hier in der Regel eine begleitende Mehrfachmedikation, berücksichtigt werden.
Die hieraus getroffenen ärztlichen Entscheidungen zur Behandlung sollten in der letzten Lebensphase und bei schwerem Demenzgrad mit den körperlichen und psychischen Leistungsreserven des Kranken abgeglichen und gemeinsam auf ihre mögliche Umsetzung überprüft werden, v. a. im Hinblick auf Angemessenheit, Zumutbarkeit und Sicherheit der jeweiligen Maßnahme für den schwerkranken Menschen.
Tab. 1: Häufigkeit ausgewählter Demenzerkrankungen
| Häufige Erkrankungen (85 %) | Seltenere Erkrankungen (10 %) | Potenziell umkehrbare Demenzen (5 %) |
| Alzheimer-Demenz (60 %) | Stirnhirnbezogene
Demenzen | Kommunizierender
Hydrozephalus |
| vaskuläre Demenz | Demenz mit Lewy-
Körperchen | Schilddrüsenunterfunktion |
| Mischdemenz (Alzheimer
und vaskulär) | Parkinson-Krankheit
mit Demenz | Depression |
1.1.1 Symptome der Demenz in der letzten Lebensphase
Die leichten und mittelschweren Stadien von Demenzerkrankungen werden hier in ihrem klinischen Erscheinungsbild nicht näher dargestellt. Die folgende Schilderung orientiert sich an den Symptomen der letzten Stadien einer Demenz.
Im Übergang vom mittelschweren zum schweren Stadium der Demenz ist in der Regel die Fähigkeit zur selbstständigen Vornahme alltäglicher Handlungen verloren gegangen, etwa sich selbst zu baden oder anzuziehen. Die Toilette wird kaum noch ohne Hilfe aufgesucht, es entwickelt sich eine zunehmende Inkontinenz (Kontrollschwäche), meist zunächst der Blase, dann des Darms. Selbst einfache Aufgaben (Nachsprechen von Wörtern oder Zahlen, Rückwärtszählen von zehn bis eins o. ä.) können nicht mehr erbracht werden, nicht selten versteht der Kranke bereits die Aufgabenstellung selbst nicht mehr. Es werden aktiv nur noch Bruchstücke der eigenen Adresse erinnert, biografische Daten kommen nur noch sehr lückenhaft und meist ungeordnet. Selbst die nächsten Angehörigen werden häufig bereits mit Namen nicht gekannt, in der Begegnung mitunter nicht mehr erkannt. Verwechslungen von Bezügen zu vertrauten Menschen sind im Gespräch feststellbar (Eltern mit Partner oder Kindern), der eigene Name ist oft noch erinnerlich. In diesem Stadium ist die Häufigkeit von herausfordernden Verhaltensstörungen am höchsten. Phasenhafte Erregungszustände, motorische Unruhe, unerwartet auftretende aggressive Impulse, ebenso wie erhebliche Verunsicherungen bei gewöhnlichen und wiederkehrenden Situationen können auftreten, ferner plötzliche und mitunter nur schwer zu beruhigende Ängste, Panikattacken in unterschiedlichen sozialen Situationen, labile Emotionen mit wechselnden Phasen von Weinen, Traurigkeit und Wehklagen oder stillem Rückzug. Auch Beeinträchtigungen des Tag-Nacht-Rhythmus beginnen sehr häufig erst in diesem Stadium der Demenz. Manchmal ist es erst das gestörte Einschlafen, manchmal der unterbrochene Schlaf mit Umhergeistern und Erregung in der Nacht, dann bei fortgesetzter nächtlicher Schlafstörung auch der Beginn von Tagesmüdigkeit mit gelegentlichem Einnicken (sog. „naps“) und erschwerter Orientierungsfähigkeit beim Aufwachen. Bei rund einem Viertel der Betroffenen kommt es zu wahnhaften Symptomen und Trugwahrnehmungen (sog. Halluzinationen). Hierzu gehören auch die Verkennungen von Personen, auch der eigenen im Spiegelbild, die Verkennung des im Fernsehen verfolgten Filmgeschehens als tatsächlich sich ereignend oder auch die Verkennung von vertrauter Umgebung (etwa der eigenen Wohnung) als fremd.
Bei den körperlichen Funktionen ist es in diesem fortgeschrittenen Stadium ebenfalls bereits zu Störungen gekommen. Die Fähigkeit zur Handlungskoordination, die Möglichkeit, mehr als eine Wahrnehmung gleichzeitig verarbeiten zu können, die sinnvolle Aufeinanderfolge von Einzelhandlungen zu einem Ziel sind durch die Störung der Hirnleistung nicht mehr abrufbar. Daher können immer mehr auch einfachste Handlungen in der Selbstversorgung (z. B. Haare kämmen, einen Rasierer führen, Zähne mit der Zahnbürste putzen, mit einem Waschlappen den Körper reinigen) nicht mehr eigenständig und erfolgreich ausgeführt werden. Einfach erscheinende, im Prinzip aber komplexe Handlungen, wie das Glas zum Mund führen und trinken, einen Tisch decken, ein Handtuch falten u. ä., werden immer weiter erschwert. Die Gangmotorik, die Koordination bei der Aufeinanderfolge der Schritte und der Aufrechterhaltung der Körperachse sowie die Wahrnehmung der Bodenbeschaffenheit und der Räumlichkeit sind schwer beeinträchtigt und führen zu Gleichgewichtsproblemen und einer Verlangsamung der Fortbewegung. Mitunter wissen die Betroffenen nicht mehr, wie sie vom Stuhl aufstehen und die ersten Schritte voreinander setzen müssen; das Ändern der Laufrichtung, das Ausweichen bei Hindernissen (z. B. Personen, Mobiliar) wird problematisch, Stufen oder Unebenheiten am Boden werden weniger erkannt. Viele Menschen mit einer solch ausgeprägten Demenz können nur noch schwer alleine auf einem Stuhl Platz nehmen, da sie entweder den Zweck des Gegenstands nicht mehr wissen oder ihren Körper nicht mehr angemessen zur Sitzgelegenheit ausrichten können. Sie setzen sich dann auf die Lehne oder drohen zu stürzen, da sie den Stuhl verfehlen.
Bei einigen Demenzprozessen treten andere Störungen typischerweise auf, z. B. häufige Stürze bei Demenz mit Lewy-Körperchen, motorische Schwächen oder Sensibilitätsstörungen bei vaskulären Demenzen; epileptische Anfälle und Myoklonien, also unwillkürliche abrupte, kurzzeitige Bewegungen von Extremitäten, können bei Alzheimer-Demenz auftreten.
Bestehen gleichzeitig Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems mit Blutdruckschwankungen oder Herzrhythmusstörungen und einer insgesamt geringeren Belastbarkeit, dann wirkt sich diese Funktionseinschränkung zusätzlich verschlechternd auf die neurologischen und psychischen Funktionen aus.
Das gleiche gilt für die häufig im höheren Lebensalter und bei vorhandenen körperlichen Beeinträchtigungen aufkommenden Schmerzzustände. Wegen der großen Häufigkeit von Schmerzen im späten Verlauf einer Demenz bei hochaltrigen Menschen muss die ärztliche Untersuchung des Kranken immer auch eine Überprüfung der Körperfunktionen auf Schmerzhaftigkeit umfassen. Schmerzhafte Bewegungseinschränkungen oder Gewebe- und Gelenkdruckpunkte sind zu bestimmen.
1.1.2 Erläuterung zu verschiedenen Demenzursachen
Die Alzheimer-Krankheit steht unter den Ursachen der Demenz mit rund 60 % an erster Stelle; häufig bestehen zusätzliche Schädigungen der Hirngefäße (siehe Tabelle 1). Zerebrovaskuläre (hirngefäßbezogene) Krankheiten machen 10–15 % aus. Seltenere irreversible Ursachen sind die weitgehend auf das Stirnhirn bezogenen Demenzen einschließlich der sog. Pick-Krankheit sowie die Lewy-Körperchen-Krankheit oder die Demenz bei Parkinson Krankheit. Behebbare Ursachen, die insgesamt wohl nicht mehr als 5 % aller Demenzfälle ausmachen, wegen ihrer grundsätzlich bestehenden Heilbarkeit in der ärztlichen Untersuchung aber besonders bedeutsam sind, beziehen sich auf Hormon- oder Vitamin-Mangelzustände, Abflussstörungen des Nervenwassers, wie den sog. kommunizierenden Hydrozephalus, oder die depressive Krankheit.
Die Alzheimer-Krankheit als weitaus häufigste Form irreversibler Demenzen steht für alle diejenigen degenerativen Erkrankungsformen des Gehirns, die durch einen Verlust von Nervenzellen sowie durch weit verbreitete krankhafte Eiweißveränderungen (sog. Plaques und Neurofibrillen) in zahlreichen Hirnregionen gekennzeichnet sind. Die Erkrankung kann im frühen Erwachsenenalter auftreten, beginnt aber in der Mehrzahl der Fälle jenseits des 65. Lebensjahres. Gegenwärtig gibt es, auch wenn ausgewählte Eiweiße im Nervenwasser (A-beta1-42 -Protein, Gesamt-tau-Protein und phspho-tau-Protein) zur Bestimmung allgemein verfügbar sind, noch keine verlässlichen klinisch-biologischen Krankheitsmarker, sodass die Diagnose mit letzter Sicherheit nur durch Gewebeuntersuchung des Gehirns (autoptisch) nach dem Tode gestellt werden kann. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit für den kundigen Facharzt, die Alzheimer-Krankheit klinisch zutreffend zu erkennen, mit > 90 % außerordentlich hoch. Charakteristisch für die Krankheit sind ein schleichender Beginn und ein chronisch fortschreitender Verlauf. Das führende Symptom zu Beginn ist die Gedächtnisstörung. Der Antrieb ist nahezu ausnahmslos gestört, häufig im Sinne einer Antriebsverarmung (siehe Tabelle 2). Die Persönlichkeit des Kranken bleibt in den ersten Jahren erhalten und ist meist durch eine Liebenswürdigkeit in den Umgangsformen sowie durch eine Verbindlichkeit im Sozialverhalten gekennzeichnet. Später treten unter den herausfordernden Verhaltensweisen nicht selten Unruhezustände, aggressives Verhalten und psychotische Auffälligkeiten hinzu. Neurologische Symptome sind in den ersten Jahren der Krankheit selten. In späteren Stadien entwickeln sich bei einem Teil der Betroffenen unwillkürliche Muskelbewegungen (Myoklonien), bei rund jedem siebten Kranken epileptische Anfallserscheinungen. Gangstörungen bis zum Auftreten von Immobilität und Bettlägrigkeit kommen bei schwerer Demenz hinzu. Insgesamt dauert die Krankheit rund 8 Jahre, nach den bisherigen Erkenntnissen rund vier bis fünf Jahre nach ärztlicher Diagnosestellung. Der Symptomverlauf schwankt jedoch erheblich mit recht kurzen Verläufen von nur drei Jahren bis zu mehr als 20 Jahren Krankheitsdauer. Der Tod tritt meist in der Folge der Bettlägrigkeit durch Infektionen der Lunge oder der Harnwege ein, seltener führt wohl die Alzheimer-Demenz direkt zum Tode, indem ihre krankhaften Eiweißablagerungen entscheidend in die lebenswichtigen Regulationszentren im Hirnstamm eindringen.
Häufige Todesursachen bei Demenzerkrankungen:
- Entzündungen der Lunge,
- Entzündungen der ableitenden Harnwege,
- Herz-Kreislaufversagen bei Hochaltrigkeit,
- Versagen zentral regulierender Hirnfunktionen.
In den vergangenen Jahren sind wichtige Erkenntnisse zu den genetischen Ursachen und den Risikofaktoren der Krankheit gewonnen worden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind rund 1–2 % aller Fälle von Alzheimer-Krankheit auf eine Mutation innerhalb von drei heute bekannten Genen zurückzuführen. Diese Veränderungen finden sich auf den Chromosomen 21 (APP-Mutation), 14 (Präsenilin I) und 1 (Präsenilin II). Diese familiären Formen der Alzheimer-Krankheit folgen alle einem autosomal-dominanten Erbgang und zeichnen sich durch einen frühen Beginn der Krankheit aus. Das Alter bei Manifestation ist innerhalb einer Familie relativ konstant, und der Krankheitsverlauf, die Zusammensetzung der Symptomatik und die Überlebenszeit bei erkrankten Familienmitgliedern sind sehr ähnlich (Brodaty 1995). Als wichtigster Risikofaktor für ein gehäuftes Auftreten der Krankheit wurde das Apolipoprotein E (APO-E), das auf Chromosom 19 codiert, erkannt. Einen wesentlichen Beitrag zur Diagnose der Krankheit leistet der Nachweis aber nicht. Darüber hinaus hat die neue...