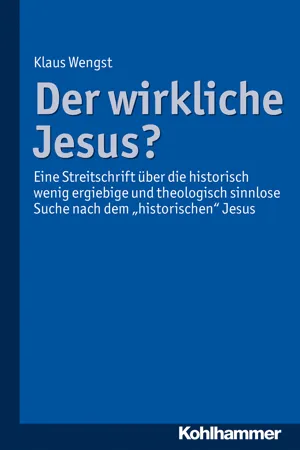![]()
I. Von Reimarus bis Käsemann Blicke zurück auf rund 200 Jahre Suche nach dem „historischen“ Jesus
Ich setze ein mit Reimarus, der mit der Unterscheidung zwischen der „Lehre der Apostel“ und der „Lehre Jesu“ die Suche nach dem „historischen“ Jesus, bei ihm noch nicht so benannt, der Sache nach im deutschen Sprachraum eröffnete. Diese Suche ist bei ihm kein selbständiges Programm, sondern ergibt sich im Zusammenhang eines ebenso umfassenden wie fulminanten Angriffs auf die gesamte Bibel. Bereits an diesem ersten Versuch können die leitende Intention dieser Suche und ihre Perspektive deutlich werden, aber auch die Probleme, vor die sie sich gestellt sieht. An diesen Problemen hat sich im Grundsätzlichen nichts geändert und kann sich angesichts der Quellenlage – die vier kanonischen Evangelien sind die einzig relevanten Quellen – auch nichts ändern. Bevor weitere Forscherpersönlichkeiten mit ihren Beiträgen zur Sache dargestellt werden, geht es deshalb im zweiten Kapitel als einer theologischen Grundlegung darum, die Eigenart der Evangelien zu bedenken und ihr eigenes Recht herauszustellen. Sie zeichnen den irdischen Jesus, d.h. sie setzen es als selbstverständlich voraus, dass Jesus als jüdischer Mensch in seinem Volk gelebt und gewirkt hat. Aber dabei geht es ihnen nicht um das chronistische Verzeichnen von Fakten, sondern sie wollen zeigen, was Gott mit dieser Geschichte zu tun hat und wie er in ihr zur Wirkung kommt. Wer nach dem „historischen“ Jesus fragt und also die „tatsächlichen“ Fakten sucht, muss mit für dieses Unternehmen äußerst widerständigen Texten rechnen. Schon David Friedrich Strauß – er wird im dritten Kapitel besprochen – hat gezeigt, dass sich so mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr als „das einfache historische Gerüst des Lebens Jesu“ ergibt. Was darüber hinausgeht, sind Hypothesengebilde mit eher geringer Wahrscheinlichkeit. Wer nach dem „historischen“ Jesus fragt, verlässt vor allem die für die Evangelisten entscheidende Perspektive, die das Leben Jesu für sie theologisch relevant sein lässt. Die theologische Kritik an der Leben-Jesu-Forschung ist grundlegend von Martin Kähler geleistet worden. Er kommt im fünften Kapitel zu Wort. Zuvor wird im vierten Kapitel sein Hallenser Kollege und – in dieser Sache – Antipode Willibald Beyschlag vorgestellt, der meinte, David Friedrich Strauß historisch überwinden und damit den Wahrheitsbeweis für das Christentum wissenschaftlich führen zu können. Albert Schweitzer – das wird im sechsten Kapitel deutlich – war kein neutraler Berichterstatter, sondern ein höchst engagierter Mitstreiter in der Sache. Nur so konnte er auch meinen, das Chaos in der Geschichte der Leben-Jesu-Forschung geordnet zu haben. Im siebten und achten Kapitel werden Bultmann und Käsemann dargestellt, der Lehrer und sein mit ihm nicht nur in der Frage des „historischen“ Jesus streitender Schüler. Jenseits des unmittelbaren Kampfgetümmels tritt deutlich hervor, dass sie mehr verbindet, als es scheint. Vor allem aber lässt sich an diesen späteren Beiträgen erkennen, dass neue Methoden an der Problemlage nichts ändern. Im abschließenden neunten Kapitel wird versucht, ein vorläufiges Fazit zu ziehen.
1. „Die wahre einfache und thätige Religion Jesu“ Jesus als Helfer der „vernünftigen Verehrer Gottes“ HERMANN SAMUEL REIMARUS (1694–1768)
a) Skizze seines Lebens und Wirkens
Für den deutschen Sprachraum wird die Suche nach dem „historischen“ Jesus üblicherweise mit Hermann Samuel Reimarus angesetzt.2 Er wuchs in einem Pfarrhaus in Hamburg auf und besuchte dort das Akademische Gymnasium, bevor er ab 1714, zunächst in Jena, Theologie, Philosophie und orientalische Sprachen studierte. Er sollte und wollte Pfarrer werden, orientierte sich aber während des Studiums um. Ab 1727 war er Professor für orientalische Sprachen am Akademischen Gymnasium seiner Heimatstadt.3
Reimarus wirkte als Aufklärer; seine Intention war die Verbindung von Religion und Vernunft. 1754 veröffentlichte er sein sehr erfolgreiches Werk: „Die vornehmsten Wahrheiten der natürlichen Religion“, das gleich im folgenden Jahr eine zweite Auflage erlebte und von ihm selbst noch einmal 1766 in einer erweiterten dritten Auflage herausgegeben wurde. Auch nach seinem Tod wurde es bis 1791 noch weitere drei Male aufgelegt. In seinem „Vorbericht“ deutet Reimarus eine bestimmte Beziehung der natürlichen Religion zum Christentum an, wenn er schreibt: „Das Christenthum setzet die Wahrheiten der natürlichen Religion, von Gottes Daseyn, Eigenschaften, Schöpfung, Vorsehung, Absicht und Gesetze, von der Seele geistigem Wesen, Natur und Unsterblichkeit u. s. w. nicht allein voraus, sondern es leget dieselben auch zum Grunde, und flicht sie mit in das Lehrgebäude seiner Geheimnisse ein.“4 Gawlick, der Herausgeber der Neuausgabe der „vornehmsten Wahrheiten“ von 1985, meint in seiner Einleitung, Reimarus habe damit „den Eindruck erweckt, als betrachtete er die natürliche Religion nur als Vorstufe zu etwas Höherem“ (11), und so getan, als stünde er in der Tradition, die „in einem ersten Schritt vernünftige Annahmen über Gott und die Welt entwickelte, um danach in einem zweiten Schritt zu den eigentlichen Glaubenswahrheiten des Christentums aufzusteigen“ (11f.). Es trifft gewiss zu, dass Reimarus verschwiegen hat, was er wirklich über das Christentum denkt. Aber er hat sich bei seiner Formulierung auch nicht verbogen, wenn er „die Wahrheiten der natürlichen Religion“ als Grundlage des Christentums bezeichnet und nebulos sagt, es flechte sie „mit in das Lehrgebäude seiner Geheimnisse“ ein, und hinsichtlich dieser Geheimnisse auch nicht die Spur einer positiven Wertung andeutet.5
Ein paar Seiten weiter im „Vorbericht“ schreibt er: „Man setze, daß einer in einer Kirche erzogen worden, worinn das Wesentliche der Religion durch vielen Tand und Aberglauben ersticket wird. Er fängt bey heranwachsendem Alter an zu denken, und diese Thorheiten einzusehen; er gerät an Gesellschaften und Bücher, die ihn darinn bestätigen. Was folget daraus? Er bekömmt eine Verachtung und einen innern Haß gegen seine Religion; und weil er keine andere hat, als die abergläubische, und von keiner andern weis, so verwirft er alle Religion ohne Unterschied“ (59). Er setzt hier einen hypothetischen Fall, über dessen Gegebenheit er sich nicht weiter auslässt. Aber genau dieser Fall ist weithin seine eigene Erfahrung,6 aus der er als tiefe Überzeugung gewonnen hat, dass „das Wesentliche der Religion“ die vernünftigen Wahrheiten der natürlichen Religion sind und dass das Christentum – und auch das Judentum –, sofern sie darüber hinausgehen, nichts als „Tand und Aberglauben“ sind.
Die Destruktion von Christentum und Judentum als „Tand und Aberglauben“ unternimmt er in seinem großen Werk: „Apologie oder Schutzschrifft für die vernünftigen Verehrer Gottes“. An dieser Schrift hat er über 30 Jahre lang, von 1736 bis kurz vor seinem Tod, heimlich gearbeitet. Er brachte sie nicht zur Veröffentlichung – aus berechtigter Furcht, dadurch seine berufliche Stellung und bürgerliche Existenz zu verlieren.7 Nur nahen Freunden gab er jeweilige Fassungen zum Lesen. In seinen beiden letzten Lebensjahren schrieb er in einer klaren und schönen Handschrift die endgültige Fassung nieder.8 Sie erschien erst im Jahr 1972 im Druck. Nach seinem Tod erhielt Lessing Kenntnis von dessen Werk und veröffentlichte zwischen 1774 und 1778 aus einer „Handschrift, die […] ein erheblich früheres Stadium des Werkes wieder(gibt)“,9 sieben Fragmente eines „Ungenannten“. Die Gesamtschrift ergibt ein deutlich anderes Bild, als es die von Lessing herausgegebenen Fragmente vermitteln. Das gilt gerade auch im Blick auf die Frage nach Jesus. Es erscheint deshalb als angemessen, diese Schrift im Ganzen in ihren wesentlichen Intentionen und Aspekten darzustellen. Dabei werden grundsätzliche Probleme deutlich, die auch die weitere Suche nach Jesus bis in die Gegenwart begleiten.
b) Die Intention der „Apologie“
In seinem ausführlichen „Vorbericht“ gibt Reimarus als erste Intention seiner Schrift an, dass er sie lediglich für die „eigene Gemühts-Beruhigung“ verfasst habe. Sie möge „im Verborgenen, zum Gebrauch verständiger Freunde liegen bleiben; mit meinem Willen soll sie nicht durch den Druck gemein gemacht werden, bevor sich die Zeiten mehr aufklären“ (I 41). Die Zeit dafür sei noch nicht reif, „da solches ohne des Pöbels Ungestühm, und ohne Verwirrung in dem Staat und der Kirche abgehen könnte“ (I 56). Er hofft aber auf eine nicht mehr ferne Zeit, „daß die Welt eine Verschiedenheit der Meynungen mit mehrer Sanftmuht duldet“ (I 57). „Eine Scheydung beider Heerden, und eine völlige Freyheit, daß ein jeder seinem Gott nach seiner Erkenntniß, nach dem Glauben oder nach bloßer Vernunft, ungehindert und öffentlich dienen könne“, hält er für „das allereintzigste Mittel“, das für alle hilfreich wäre (I 58).10 Im Blick auf den Gebrauch seiner Schrift in dieser „Zeit der öffentlichen Trennung“, in der es immer noch „schwartze Beschuldigungen“ geben werde, nennt Reimarus sie „eine Apologie oder Schutzschrifft für die vernünftige Verehrer Gottes“ (I 59). Er ist sich seiner Leistung bewusst, für diese Verehrer sei ihre „Rechtfertigung hier schon mit der benöhtigten Überlegung, und Kenntniß von Sprachen und Sachen, so vorgearbeitet, als noch bisher von niemanden geschehen ist“ (I 60).
So unternimmt er es zunächst für sich selbst und Freunde, aus den eigenen entstandenen Zweifeln heraus „den Glauben, welcher mir so manche Anstöße gemacht hatte, von Grund aus zu untersuchen, ob er mit den Regeln der Wahrheit bestehen könne oder nicht“ (I 41). Bei dieser „mit einer gleichgültigen Wahrheits-Liebe“ (I 53) durchgeführten Untersuchung zeigt es sich, dass er nicht bestehen kann; und so wird schonungslos destruiert, „was uns sowohl in der Bibel selbst, und denen darin aufgeführten Personen, Reden und Thaten, als in dem daraus erbauten Glaubens-System, wiedersprechend, anstößig und ärgerlich vorgekommen ist“ (I 61).11 Diese Destruktion fällt so heftig aus, dass er bei späterer Veröffentlichung den Einwand erwartet: „Wie könnt ihr das eine Apologie oder Schutzschrifft heissen, was eigentlich in den heftigsten Anfällen auf die Jüdische und Christliche Religion besteht? Celsus und Porphyrius haben es ja vorzeiten nicht ärger machen können“ (I 60f.).12 Er begründet diese Heftigkeit mit seiner Existenz „in Statu passionis“ durch den noch bestehenden „angedrungenen Glaubens-Zwang“ (I 61) und vergleicht sein Unternehmen mit dem der frühchristlichen Apologeten (I 62).
Reimarus intendiert „eine allgemeine Religion für das gantze menschliche Geschlecht“. Eine solche „aus dem Christenthum zu machen“, müssten „die Herrn Theologi“ unternehmen (I 171). Er spricht sich entschieden dagegen aus, „alle, die anders denken, mit Gewalt und Zwangsmittel zum Beyfall und zum Glauben zu nöhtigen“, und formuliert positiv: „Wir müssen einander durch die Vernunft, welche allen Menschen und Völkern gemein ist, zu überführen suchen, und wo das nicht helffen will, einer des andern Schwachheit ertragen, und wegen der Verschiedenheit unsrer Meynungen von dem verborgenen unendlichen Wesen nicht aufhören, als Menschen, menschlich und gesellig mit einander zu leben“ (I 178). Für diese Sicht gilt Reimarus aller Respekt.13
c) Kriterien für die Prüfung positiver Religionen
Dass die Prüfung der ihm von Kindheit an eingepflanzten Religion als deren Destruktion ausfällt, ergibt sich nicht zuletzt aus ihrem angelegten Hauptkriterium, das Reimarus klar benennt: „Eine vernünftige Religion muß vor allen Dingen in jeder sogenannten Offenbarung der Grund- und Prüfe-Stein werden, als welche gewiß durch die Natur von Gott abstammet“ (I 54). Damit sind „andere unwiedersprechliche Wahrheiten“ verbunden, „besonders die unendliche Vollkommenheiten Gottes, seine Weißheit, Vorsehung, Güte und Allmacht, seine ewige Regeln des Natur- und Sittengesetzes“. Wenn etwas dem widerspricht, „so mag auch ein Engel vom Himmel der Prediger eines solchen Evangelii seyn, wir können ihm dennoch unmöglich glauben“ (I 55).14
Reimarus setzt den Fall, „wenn es Gott gefallen hätte eine übernatürliche und seligmachende Offenbarung durch gewisse Mittelspersonen oder göttliche Boten an das menschliche Geschlecht zu bringen“, und folgert daraus: „so würde er solche dazu ausersehen, welche selbst den Endzweck hätten die ihnen offenbarte Religion allen Menschen so viel möglich kund zu machen und unter ihnen zu befördern“ (I 184).15 Ein solcher „Endzweck“ wäre aber nur mit einer vernünftigen Religion zu erreichen. Ihm dürfen die Boten auch „durch ihre Reden und Handlungen“, durch ethisches Fehlverhalten, nicht widersprechen (I 192), etwa dem von Reimarus oft genannten „Natur- und Völkerrecht“ nicht zuwiderhandeln. Sofern sie das dennoch tun, ist das von ihnen als Offenbarung Ausgegebene als „ein Betrug oder grober Irrthum“ zu werten (ebd.).
Ein weiteres wichtiges negatives Kriterium ist, dass „eine vorgegebene Offenbarung etwas enthält, das sich selbst klar und deutlich wiederspricht“ (I 54). Das gilt insbesondere für die Erzählung von Wundern. Für sie trifft nicht nur zu: „Der Schreiber kann mir keine positive Beweise der Wahrheit seiner Factorum geben“ (I 190). Reimarus meint, auch „den äussern und innern Wiederspruch einiger Wunder aus der Erzehlung selbst gantz klärlich“ erweisen zu können (I 191), wobei er sich ausschließlich auf die Ebene der Fakten bezieht. Darauf wird bei Besprechung der Evangelien näher einzugehen sein.
Von seinem Ansatz und seinen Kriterien her kann er schon vor der ausführlichen Besprechung nur vom Anreißen der ersten Kapitel der Bibel her feststellen, es habe „wohl der Geschichtschreiber selbst, geschweige die Helden, welche er aufführt, nicht einmal einen Begriff von der Seligkeit und seligmachenden Religion, oder von einer wahren Tugend und Frömmigkeit gehabt; weil keine Spuhr von der Seelen Unsterblichkeit und einem künftigen Leben in der gantzen Geschichte vorhanden ist, und weil er denen, welche Männer Gottes gewesen seyn sollen, viele schändliche Handlungen, als ob sie wohl und göttlich gethan wären, beylegt“ (I 193).
d) Kritik des Alten Testaments
Die Letztfassung seiner Apologie hat Reimarus als einen kritischen Durchgang durch die gesamte Bibel angelegt. So bespricht er im umfangreicheren ersten Teil das Alte Testament hinsichtlich der in ihm erzählten Geschichte und hinsichtlich der in ihm enthaltenen Lehren. Er findet an ihm kaum ein gutes Haar; und was an Gutem da ist, kommt woanders her: „Die Lehre von der Einheit Gottes, und dessen Anbetung ohne Bilder, welche Moses aus der geheimen Weißheit der Egyptischen Priester mitgebracht hatte, aber ohne vernünftige Gründe bloß als ein Gebot vortrug, hatte bey den Israeliten nicht eher Eingang, als bis sie in der Gefangenschaft mit vernünftigen Heyden umgegangen waren. Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seelen und von den Belohnungen und Strafen nach diesem Leben haben die Juden nicht einmal von Mose und den Propheten empfangen, sondern von den Weltweisen der Heyden […] angenommen“ (I 112f.). Durch den eitlen „Tand Levitischer Cerimonien“ habe Mose „das Wesentliche der Religion gantz überschwemmt und verstellt“ (I 113), also auch die guten ethischen Forderungen.16 Aus der vernichtenden Kritik am Alten Testament sei nur Weniges hervorgehoben. Mose gilt als ein Trickbetrüger, der „das Volk glauben machte, alle seine Anschläge und Befehle kämen unmittelbar von Gott“, und der sich zudem „durch Mord und Blutvergiessen“ durchsetzte (I 283).17 Als das Volk gemäß Ex 17,1–6 nach Wasser schreit, konnte Mose „bald Raht schaffen“, da er die Gegend von seiner früheren Hirtentätigkeit her kannte „und dem Volke einen Bach anwies, der auf einer Seite aus dem felsigten Berge entsprung und der ihnen nicht sogleich in die Augen gefallen war. Aber, da er Wunder machen wollte: so muste das mit Ceremonie geschehen; als ob er den Bach jetzt erst durch das Schlagen seines Stabes hervorbrächte“ (I 355). Die Erzählung vom goldenen Kalb deutet Reimarus als einen Konflikt zwischen Mose und Aaron, der zu einem Kompromiss zwischen ihnen in der Machtaufteilung führte. Aaron erpresste Mose, zahlreiche Gesetze zu erlassen, die für die Priester vorteilhaft waren (I 390), „diese fetten und faulen Bäuche“ (I 393). Die mitziehende Wolken- und Feuersäule wird auf natü...