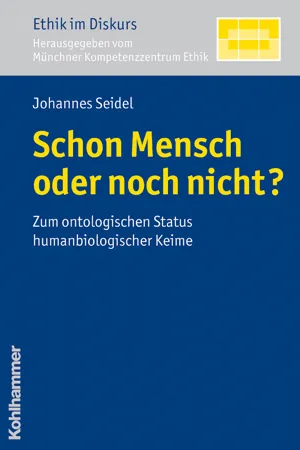
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Schon Mensch oder noch nicht?
Zum ontologischen Status humanbiologischer Keime
- 438 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Schon Mensch oder noch nicht?
Zum ontologischen Status humanbiologischer Keime
Über dieses Buch
Wann habe ich zu existieren begonnen? Mit der Geburt? Mit der "Empfängnis"? Oder noch davor? Wenige Fragen berühren unser Selbstverständnis so sehr wie diese. Diesen Fragen wird transdisziplinär theologisch-philosophisch-naturwissenschaftlich nachgegangen. Gezeigt wird, welcher Status dem Vorgeburtlichen in Geschichte und Gegenwart zugeschrieben wurde bzw. wird; Begriffe wie "biologisches Individuum", "Spezies" und "aktive Potenz" werden geklärt; sodann wird diskutiert, welche ontogenetischen Ereignisse als "Beginn" - sei es des Organismus, des Individuums, des Menschen oder der Person - taugen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Schon Mensch oder noch nicht? von Johannes Seidel, Münchner Kompetenz Zentrum Ethik (MKE) im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Medizin & Ethik in der Medizin. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Wenige Fragen der angewandten Ethik werden gegenwärtig derart kontrovers diskutiert wie die nach dem rechten Umgang mit und – damit impliziert – die Frage nach dem ontologischen Status humanbiologischen Keimmaterials, von Oocyten, Embryonen, Föten und Neugeborenen.
1.1 Zur Themenstellung und ihrem systematischen Hintergrund
Theologische Ethik oder Moraltheologie hat die Aufgabe, angesichts konkreter Handlungssituationen auf die ethische Frage „Was sollen wir tun?“ (Lk 3,10–14) konkrete Antworten zu geben.1 Konkrete ethische Antworten umfassen deskriptive und präskriptive Momente. Präskriptive Momente betreffen die Erkenntnis sittlicher Prinzipien. Deskriptive Momente umfassen u. a. Aussagen über den ontologischen Status von Handlungssubjekten und -objekten sowie über Handlungsumstände. Christliche Ethik versteht sich als Ethik im Horizont gelebten christlichen Glaubens2, sie steht in der Tradition kirchlichen Denkens. Wie jede ernst zu nehmende Ethik steht sie unter dem Anspruch, dem gegenwärtigen philosophisch-theologischen sowie empirisch-wissenschaftlichen Erkenntnisstand gerecht zu werden. „In eine Kurzdefinition gefasst: Theologische Ethik ist die wissenschaftliche Reflexion auf das moralisch-sittliche Urteilen und Handeln des Menschen im Horizont christlichen Glaubens.“3
Im Unterschied zur gelebten Moral geht es der Ethik um rational verantwortete theoretische Begründungen sittlichen Urteilens und Handelns.4 Dabei ist zwischen allgemeiner und angewandter Ethik zu unterscheiden.5 Während die allgemeine Ethik nach ethischen Prinzipien und Handlungsmaximen, nach der Letztbegründung des Ethischen sowie nach dem Verhältnis von Normen und Gewissen (Stichwort: Epikie)6 und – im Fall theologischer Ethik – nach dem Verhältnis von geschichtlicher Offenbarung und ethischer Erkenntnis7 fragt, bezieht die angewandte oder spezielle Ethik die allgemeinen ethischen Prinzipien auf konkrete Handlungsfelder.8
Indem angewandte Ethik sich auf konkrete individuelle oder soziale Handlungsfelder (Individual- oder Sozialethik) bezieht9, fällt sie „gemischte Urteile“: Das heißt, neben präskriptiven Momenten oder Prämissen sind immer auch deskriptive Momente oder Prämissen Teil ihrer Urteile als angewandter Ethik10:
Für die Lösung konkreter, sittlich-moralischer Probleme ist die praktisch-stellungnehmende Vernunft [...] auf den Beitrag der theoretisch-kenntnisnehmenden Vernunft in Form von empirischen Daten und Fakten angewiesen. Das heißt: Sittliche Einsichten und empirisches Wissen fließen gleichermaßen in pragmatische Erkenntnisse zur Bewältigung eines bestimmten Problems ein und schaffen eine konkrete Handlungsnorm.11
Deskriptive Sätze als Teil der angewandt ethischen Urteilsbildung zu formulieren, ist also keine der angewandten Ethik äußerliche Tätigkeit, sondern Teil ihrer ureigensten Aufgabe und hat nichts mit naturalistischen oder normativistischen Fehlschlüssen zu tun – solange klar unterschieden bleibt, was Deskription und was Präskription ist.12 Deskriptive Momente angewandter Ethik betreffen (1.) den ontologischen Status des Menschen als Handlungssubjekt, (2.) den ontologischen Status von Handlungsobjekten und (3.) die speziellen Umstände einer konkreten Handlung.13
- Ad (1.): Zur ontologischen Statusbestimmung eines Menschen als Handlungssubjekt gehört seine Personalität – theologisch vertieft: seine Gottesbildlichkeit14 – und seine je eigene Natur mit ihren vorgegebenen Grundbedürfnissen und Handlungsdispositionen (traditionell: die Lehre von den inclinationes naturales)15 – theologisch vertieft: seine Geschöpflichkeit.
- Ad (2.): Ethisches Geboten- oder Verbotensein entscheidet sich sodann daran, um wen oder was es sich bei dem oder den menschlichen Handlungsobjekten handelt: um Personen, um leidensfähige Kreaturen, um nicht lebende Dinge oder um was sonst?
- Ad (3.): Die Umstände einer konkreten Handlung (traditionell: die Lehre von den circumstantiae) betreffen die „Vielfalt ihrer jeweiligen person-, sach- und situationsspezifischen Bedingungen und Konsequenzen“16; sie betreffen nicht nur den Bereich der Normanwendung, sondern auch den Bereich der Normgestaltung.17
Vorliegende Untersuchung fragt nach dem ontologischen Status humanbiologischen Keimmaterials18, von Oocyten, Embryonen, Föten, Neugeborenen als möglichen Handlungsobjekten. Anders als in Zeiten spekulativer Naturbetrachtung und eines damit einhergehenden Naturrechts19 ist dieses „Material“ heute Gegenstand empirisch arbeitender Biologie und – weil empirische Daten als solche noch keine Ontologie erzeugen20 – einer naturwissenschaftlich geläuterten Naturphilosophie.21 Will die angewandte Ethik in der Frage nach dem rechten Umgang mit humanbiologischem Keimmaterial heute ernst zu nehmende Antworten geben, ist sie essentiell und elementar auf den interdisziplinären Diskurs mit der Biologie und einer empirisch orientierten Naturphilosophie angewiesen.
Ethik sieht sich nicht mehr wie früher auf empirische Zufallsinformation und gängige Evidenzerfahrungen verwiesen, sondern kann erstmals auf Informationen rekurrieren, die im Rahmen methodisch gesicherter wissenschaftlicher Forschung erbracht werden. Diese wissenschaftlichen Informationen machen als solche zwar nicht Ethik überflüssig, binden sie aber ihrerseits stärker an die Einzelwissenschaften zurück. Dies zeigt sich besonders deutlich im Bereich materialer ethischer Sachfragen. Je mehr Ethik konkrete Ethik wird, um so mehr gewinnen die von den verschiedenen Einzeldisziplinen erschlossenen Gesetzlichkeiten [...] für den Normfindungsprozeß im Hinblick auf die jeweiligen Handlungsfelder Gewicht.22
In klarer Unterscheidung der Ebenen des Seins und des Sollens fließen hier „sowohl empirische Erkenntnisse als auch sittliche Einsichten gleichermaßen in die ethische Reflexion ein [...].“23 Angesichts solcher Verwiesenheit von Ethik auf Empirie ist allerdings daran zu erinnern, dass empirische Daten und Deutungen prinzipiell der Falsifizierbarkeit ausgesetzt sind.
Dennoch sollte dies [...] nicht dazu verleiten, die Lösung des Normproblems erneut in einem empirieenthobenen Konzept von Ethik zu suchen. Ethik und empirische Wissenschaft stehen nun einmal in unabdingbarem Verweisungszusammenhang. Menschliches Handeln vollzieht sich im Bedingungsfeld ethisch bedeutsamer, weil auf den Menschen bezogener Sachverhalte. [...] Korrekturen im Bereich empirischer Erkenntnisse ziehen dann aber auch zwangsläufig Korrekturen auf der sittlichen Entscheidungsebene nach sich. Es läßt sich nun einmal nicht prinzipiell ausschließen, daß man sich zur Begründung sittlicher Weisungen guten Glaubens auf empirisch verbürgte und jahrzehntelang als unumstritten gesichert geltende Einsichten in Sachverhalte beruft, deren tatsächliche Zusammenhänge erst durch weitere Forschung aufgedeckt werden, die dann gegebenenfalls zu neuen ethisch negativen oder auch positiven Bewertungen führen.24
Ethische Erkenntnis ist also notwendig unabgeschlossen, „weil sie immer nur vorläufig begreifen kann, nämlich: auf dem Niveau der jeweiligen Gegenwart, im Blick auf bestimmte Problemkonstellationen und auf dem Stand des aktuellen Wissens.“25
Theologische Ethik versteht sich als Ethik im Horizont gelebten christlichen Glaubens. Damit ist sie – stärker als philosophische Ethik – auf die Tradition verwiesen, was in christlichem Kontext heißt: auf die jüdisch-abendländischkirchliche Tradition, vor allem auf die „Schrift“, die Lehramts- und Theologiegeschichte sowie auf die gelebte jüdisch-christliche Moral. Dies nicht in dem Sinne, dass biblische oder lehramtliche Vorgaben aus sich heraus normativ zwingend wären26 –
[d]er christliche Glaube ist keine instrumentalisierbare Instanz, die Gebote und Verbote unhinterfragbar macht und zur Befolgung von bestimmten Regeln zwingt. Das christliche Menschenbild macht es gerade umgekehrt [...] zwingend erforderlich, sittliches Urteilen und Handeln in der Autonomie des Menschen [...], seiner Vernunft [...], seinem Gewissen [...] und seiner Verantwortung [...] zu verankern27
–, wohl aber in dem Sinne, dass das, was Christen in Jahrhunderten bedacht haben, nicht leichtfertig in Frage gestellt werden darf.28 Theologische Ethik hat sich also nicht nur gegenüber der Vernunft, sondern auch gegenüber der Tradition zu verantworten. Diese Vorgabe verpflichtet jede an heutiger Entscheidungsfindung interessierte theologisch-ethische – im Unterschied zu einer rein philosophisch-ethischen29 – Untersuchung dazu, die Tradition als Ausgangspunkt ihrer Untersuchung umfänglich zur Kenntnis zu nehmen.
Die christliche Tradition einschließlich ihrer Wurzeln und ihrer säkularen Fortentwicklungen zur Kenntnis zu nehmen, öffnet zugleich den Blick auf die geschichtliche Bedingtheit vieler in Vergangenheit und Gegenwart vertretenen Positionen und führt damit von selbst zu einem kritischen Umgang mit eben dieser Tradition:
Dem Traditionsbeweis kommt [...] insofern eine Bedeutung zu, als der geschichtliche Aufweis sittlichen Verhaltens und sittlicher Vorstellungen vergangener Zeiten unter Berücksichtigung der zeitbedingten Umstände zur Erkenntnis verhilft, was als eigentlicher Kern der jeweiligen Weisungen zu gelten hat und was angesichts neuer Umstände und Situationen eine andere Ausprägung zu erfahren vermag.30
Soll traditio nicht zu bloßer conservatio verkommen31, muss sie – den jeweils aktuellen, falsifizierbaren (!) wissenschaftlichen Erkenntnisstand integrierend – je neu fortgeschrieben und gegebenenfalls umgeschrieben (!) werden:
Indem der Theologe um die Endlichkeit und Zeitbedingtheit menschlicher Erfahrung weiß, wird er seine sittlichen Forderungen auch immer wieder neu ‚in Frage stellen‘, um eine noch bessere, vertieftere und seiner Zeit entsprechendere Begründung geben zu können – oder aber, so die Begründungen nicht mehr tragen, um die Ungültigkeit bisheriger Forderungen festzustellen.32
Sachkonflikte sind in einem recht verstandenen Traditionsprozess vorprogrammiert.33 Sachkonflikte sind als Konflikte in der Sache zu führen, also mit Sachargumenten, rational, ergebnisoffen – so auch der Sachkonflikt um d...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1 Einleitung
- 2 Vorstellungen zur Beseelung und Ontogenese in Geschichte und Gegenwart
- 3 Begriffe
- 4 Ontogenetische Einzelereignisse unter ontologischer Rücksicht
- 5 Schlussüberlegungen
- Abkürzungen bei Literaturangaben
- Literaturverzeichnis