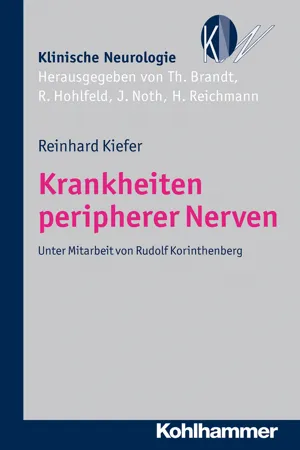
Krankheiten peripherer Nerven
- 365 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Krankheiten peripherer Nerven
Über dieses Buch
Dieses klinisch orientierte Buch bietet eine praxisnahe Darstellung der Diagnostik und Therapie peripherer Nervenkrankheiten und deren neurobiologischer Grundlagen. Es richtet sich an neurologische Fachärzte, angehende Neurologen und interessierte Kolleginnen und Kollegen anderer Fachdisziplinen.Der allgemeine Teil beschreibt die klinischen und technischen Möglichkeiten, sich einem Patienten mit einer peripheren Nervenerkrankung zu nähern. Die verschiedenen Erkrankungen werden im zweiten Teil u. a. im Hinblick auf ihre klinische Bedeutung, die neurobiologischen Grundlagen, die klinischen Merkmale und die Therapie ausführlich beschrieben. Es folgen Kapitel über fokale Nervenläsionen, die symptomatische Therapie und Besonderheiten im Kindesalter. Wichtige Informationen werden zusätzlich in Tabellen und Übersichten zusammengefasst, um dem Leser einen schnellen Zugriff zu ermöglichen. Schließlich enthält das Buch noch illustrative Falldarstellungen spezieller oder auch ganz typischer Krankheitsverläufe aus der täglichen Praxis.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Information
B Krankheiten peripherer Nerven
7 Guillain-Barré-Syndrom
Klinische Bedeutung
Ein Syndrom, keine Krankheit
| Klinisches Syndrom | Klinische und neurophysiologische/pathologische Merkmale |
| Akute inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie |
|
| Akute motorische axonale Neuropathie |
|
| Akute motorische und sensible axonale Neuropathie |
|
| Miller-Fisher-Syndrom |
|
| Oropharyngeale Variante |
|
| Brachiale Variante |
|
| Sensibles GBS |
|
| Ataktisches GBS |
|
| Akute Pandysautonomie |
|
| Andere |
|
Neurobiologische Grundlagen
- Zunächst kommt es zu einer Infektion mit einem die Krankheit triggernden Erreger, am häufigsten Campylobacter jejuni. In 32–66 % der Fälle folgt die Erkrankung einer durch Campylobacter jejuni (C. jejuni) verursachten Durchfallerkrankung. Atemwegsinfekte sind der zweithäufigste klinische Trigger. Weitere Erreger, deren überzufällig häufige Assoziation mit einem GBS gut belegt ist, sind Zytomegalie-Virus (CMV), Epstein-Barr-Virus (EBV), Mycoplasma pneumoniae und Haemophilus influenzae (Jacobs et al. 1998, Hadden et al. 2001). Die Infektion geht dem GBS in der Regel ein bis drei Wochen voraus.
Nicht immer kann ein ursächlicher Erreger bestimmt werden und weitere Trigger traten historisch auf, beispielsweise die H1N1- Influenzaimpfung 1976. Spätere epidemiologische Studien zur Assoziation eines GBS mit Impfungen konnten allerdings entweder überhaupt keinen Zusammenhang oder eine zahlenmäßig nur sehr geringe Assoziation zwischen einem GBS und einer vorausgegangen Influenzaimpfung nachweisen (van Doorn et al. 2008). Darüber hinaus sind in der Literatur zahllose weitere Triggerfaktoren eines GBS beschrieben, bei denen die Kausalität nicht belegt ist. - Falls bestimmte genetische Merkmale dieser Erreger und eine genetische Prädisposition seitens der infizierten Person zusammentreffen, kann sich die Immunantwort nicht nur gegen den Erreger selbst richten. Es kann vielmehr zu einer als molekulares Mimikry bezeichneten molekularen Verwechslung und Fehlsteuerung kommen, sodass sich die Immunantwort auch gegen Strukturen peripherer Nerven richtet. Gangliosidepitope (s. Kap. 4) spielen hier eine zentrale Rolle und sind mitverantwortlich für den klinischen Phänotyp der Erkrankung. Grundlage dieser Hypothese sind folgende zentrale Beobachtungen:
- Autoantikörper gegen verschiedene Ganglioside oder Gangliosid-Komplexe treten bei Patienten mit GBS überzufällig häufig auf (van Doorn et al. 2008). Die Art der Antikörper korreliert dabei mit dem klinischen Syndrom: Antikörper gegen GM1, GD1a, GalNac-GD1a und GM1b werden insbesondere bei der Akuten Motorischen Axonalen Polyneuropathie gefunden. Beim Miller-Fisher-Syndrom werden insbesondere Autoantikörper gegen das Gangliosid GQ1b, GD3 und GT1a gefunden. Die ataktische Variante des GBS ist mit Autoantikörpern gegen das Gangliosid GM2 assoziiert.
- Bestimmte Gangliosid-ähnliche Lipo-Oligosaccharidepitope können sowohl in bestimmten Stämmen von C. jejuni als auch in peripheren Nerven vorkommen. Deren Expression in C. jejuni-Stämmen ist genetisch determiniert: Man kennt Campylobacter-Gene (Godschalk et al. 2004, Koga et al. 2006), die für die Expression GM1- und GD1a-ähnlicher Lipo-Oligosaccharid-Epitope auf C. jejuni verantwortlich sind, die wiederum eine entsprechende Immunantwort triggern können. Dabei gibt es erneut eine Assoziation zwischen dem klinischen Syndrom und bestimmten Expressionsmustern für Gangliosid-ähnliche Lipo-Oligosaccharid-Strukturen auf C. jejuni-Stämmen. Isolate von AMAN -Patienten exprimieren GM1- und GD1a-ähnliche Epitope, und Isolate von Miller-Fisher-Patienten exprimieren GD3- und GT1a-ähnliche Epitope. Die hierdurch getriggerten Antikörperantworten sind mit den jeweiligen klinischen Syndromen assoziiert.
- Eine Immunisierung mit LPS von C. jejuni bei Kaninchen kann eine GBS-ähnliche Erkrankung erzeugen, die durch GM1-Antikörper vermittelt ist (Yuki et al. 2001).
Für eine genetische Prädisposition seitens der Erkrankten spricht, dass nur etwa jede eintausendste Person mit einer C. jejuni-Enteritis an einem GBS erkrankt. Die genetischen Ursachen sind allerdings weitgehend unbekannt. Bestimmte Polymorphismen in den Genen des Immunglobulin-Fc-Rezeptors, des T-Zell-Rezeptors und bestimmter Zytokine treten bei GBS-Patienten gehäuft auf.
- Autoantikörper gegen verschiedene Ganglioside oder Gangliosid-Komplexe treten bei Patienten mit GBS überzufällig häufig auf (van Doorn et al. 2008). Die Art der Antikörper korreliert dabei mit dem klinischen Syndrom: Antikörper gegen GM1, GD1a, GalNac-GD1a und GM1b werden insbesondere bei der Akuten Motorischen Axonalen Polyneuropathie gefunden. Beim Miller-Fisher-Syndrom werden insbesondere Autoantikörper gegen das Gangliosid GQ1b, GD3 und GT1a gefunden. Die ataktische Variante des GBS ist mit Autoantikörpern gegen das Gangliosid GM2 assoziiert.
- Der nächste Schritt ist dann die Bindung pathogenetischer Antikörper im peripheren Nerven, gefolgt von Komplementbindung und Komplementvermittelter Zellschädigung. Diese kann sich bei der AMAN gegen das Axon und bei der AIDP gegen Schwannzellen richten. Zum einen kann es zu einer Komplement-vermittelten Attacke gegen terminale Nervenendigungen führen, die zunächst zu einer funktionellen Blockade und dann einer strukturellen Zerstörung führt, sowie zu einer Blockade von Natriumkanälen im Ranvier’schen Schnürring. Zum anderen kommt es zu einer Bindung von Makrophagen über den Fc-Rezeptor der Autoantikörper, die wiederum zu einer Attacke der Makrophagen auf die jeweiligen Zielstrukturen im peripheren Nerve...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- A Diagnostik peripherer Nervenerkrankungen
- B Krankheiten peripherer Nerven
- Abkürzungen
- Literatur
- Autorenverzeichnis
- Stichwortverzeichnis