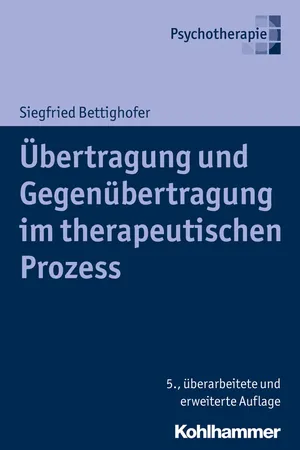![]()
1 Die hilfreiche Beziehung in der Psychoanalyse
Das wichtigste Anliegen der empirischen Psychotherapieforschung war es immer, die Effektivität von Psychotherapie nachzuweisen. Zugleich ging es um die Untersuchung der unterschiedlichen Wirksamkeit verschiedener Therapiemethoden im Hinblick auf die spezifische Störung und die Patientenpersönlichkeit. Diese Fragestellung wurde bald erweitert, und so ging man im Rahmen von Prozessuntersuchungen der Frage nach, warum Psychotherapie eigentlich wirkt und welches die entscheidenden Faktoren sind, auf denen diese Wirksamkeit beruht.
Whitehorn und Betz (1960) konnten als erste hinsichtlich der Effektivität in der Behandlung von schizophrenen oder neurotischen Patienten zwei globale Therapeutentypen A und B unterscheiden. Nun waren es nicht mehr vorwiegend Patientenvariablen oder Merkmale der jeweiligen Therapiemethode, denen das Interesse der Forscher galt. Der Schwerpunkt verlagerte sich jetzt zunehmend auf die Untersuchung der Persönlichkeit des Therapeuten, deren Bedeutung für günstige Behandlungsverläufe allmählich erkannt wurde (Beutler et al. 1995). Diese Untersuchung einzelner Merkmale der Therapeutenpersönlichkeit war ein bedeutender Fortschritt hin zu einer differenzierteren Betrachtungsweise des therapeutischen Prozesses; sie war jedoch schon nach der großen Literaturübersicht von Beutler et al. (1995, s. a. Kächele 1992) in dieser Form nicht mehr zu halten.
Insbesondere seit den Untersuchungen von Luborsky (1976, 1985) gilt die hilfreiche therapeutische Beziehung als der grundlegende und übergeordnete therapeutische Wirkfaktor, der weitaus mehr als einzelne Patienten-, Therapeuten- oder Methodenmerkmale über Erfolg oder Misserfolg von Behandlungen entscheidet (Kächele 1992, 2007, Orlinsky et al. 1995, Rudolf 1991). Es geht dabei im Wesentlichen um die Fähigkeit des Therapeuten, sich auf den jeweiligen Patienten einzustellen und zu ihm eine Beziehung herzustellen, die dieser als therapeutisch hilfreich empfindet. Auf der Basis dieser Befunde konnte es nicht mehr als ausreichend angesehen werden, nur bestimmte als therapeutisch relevant geltende Interventionsstrategien wie beispielsweise Empathie, Kongruenz oder das Geben von Deutungen einzusetzen. Denn es kommt immer darauf an, dass auch der Patient ein bestimmtes Therapeutenverhalten als für sich und seine Entwicklung hilfreich empfindet. Obwohl das sehr eng mit der Störung und der Persönlichkeit des Patienten sowie mit bestimmten Merkmalen der Therapeutenpersönlichkeit zusammenhängt, kommt hier doch der Faktor der Interaktion zwischen beiden bestimmend hinzu. Ob eine hilfreiche und »heilende« (Frick 1996) Beziehung zwischen Therapeut und Patient entsteht, ist im Wesentlichen immer auch das Resultat eines interaktiven Prozesses zwischen ihnen (Luborsky et al. 1985).
In diesem Zusammenhang zeigt die Psychotherapieforschung der letzten Jahre eindeutig, dass dabei die interpersonelle Kompetenz des Therapeuten der entscheidende Faktor ist, der es ihm ermöglicht, auch mit schwierigen therapeutischen Situationen konstruktiv umzugehen. Diese interpersonelle Kompetenz erwies sich auch als der entscheidende Prädiktor für den Therapieerfolg (Hermer 2012, Körner 2013). Auch Lambert (2010) fand einen großen Einfluss hilfreicher zwischenmenschlicher Fähigkeiten, die es dem Therapeuten erlauben, auch schwierige Beziehungssituationen gut zu bewältigen. Für Strupp (1989) »ist die größte Herausforderung, der der Therapeut gegenüber steht, die geschickte Handhabung des Enactments, das ihn häufig in die Defensive treibt und Langeweile, Irritation, Ärger und Feindseligkeit hervorruft und ihn unter Druck setzt, so dass er sich auf eine Art verhält, die mit seiner Haltung als einfühlsamer Zuhörer und Erklärender nicht vereinbar ist.« (S. 719, zit. n. Schore 2003, S. 126) Die Ergebnisse von Willutzki et al. (2013) zeigen ebenfalls, dass »das interpersonelle Funktionsniveau und interpersonale Merkmale einschließlich der nonverbalen Kommunikation innerhalb der Sitzungen am wichtigsten zu sein« (S. 431) scheinen.
Die Psychoanalyse als therapeutische Behandlungsmethode hat sich seit ihren Anfängen intensiv mit der Frage befasst, wie eine hilfreiche Beziehung zwischen Therapeut und Patient hergestellt und über den gesamten therapeutischen Prozess hinweg aufrechterhalten werden kann. Sie hat dem Aspekt der therapeutischen Beziehung immer schon einen zentralen Stellenwert eingeräumt. So hat Freud mit seinen Empfehlungen (1913), dem Patienten »Zeit zu lassen« (S. 473), einen »moralisierenden« (S. 474) Standpunkt zu vermeiden und stattdessen den Standpunkt »der Einfühlung« (S. 474) einzunehmen, eine Grundhaltung und eine Art des Zuhörens beschrieben, die für die Entwicklung einer hilfreichen Beziehung eine unverzichtbare Grundbedingung ist und die heute allgemein als einer der wesentlichen therapeutischen Wirkfaktoren gilt. Will (2006) beschreibt aus unserer heutigen Perspektive diejenigen psychoanalytischen Kompetenzen, die für die Gestaltung und Aufrechterhaltung einer konstruktiven Beziehung zum Patienten notwendig sind.
Auch anderen psychotherapeutischen Methoden ist daran gelegen, einen hilfreichen Kontakt zum Patienten herzustellen. Dies wurde im Allgemeinen verstanden als Realisierung einer positiven Beziehung wie z. B. in der Gesprächspsychotherapie (Biermann-Ratjen, Eckert 2003). Hier geht man davon aus, dass die durch Empathie getragene Grundbeziehung, die der Therapeut zum Patienten herstellt, von diesem im Sinne eines guten Objekts introjiziert und somit zur Grundlage für eine positivere Einstellung zu sich selbst wird.
In der Verhaltenstherapie wurde die positive therapeutische Beziehung über lange Zeit rein instrumentell als positiver Verstärker eingesetzt, um ein im Hinblick auf das Therapieziel erwünschtes Verhalten zu unterstützen. Erst neuere Entwicklungen verfolgen einen differenzierteren Umgang im Hinblick auf den Umgang mit der Beziehung zwischen Therapeut und Patient. So berücksichtigen z. B. Grawe, Donati und Bernauer (1994) im Rahmen ihrer umfangreichen Arbeit zur Grundlegung einer Allgemeinen Psychotherapie explizit auch diese »Beziehungsperspektive« (S. 775). Grawe (1995) hält es für eine wichtige Voraussetzung wirksamer psychotherapeutischer Arbeit, dass im Rahmen der sog. »Problemaktualisierung« (S. 136) die pathologischen Beziehungsmuster und neurotischen inneren Schemata des Patienten in der Beziehung zum Therapeuten aktualisiert werden, und kommt damit dem analytischen Übertragungsbegriff ziemlich nahe. Die Aufgabe des Therapeuten sehen sie infolgedessen darin, sich gezielt um eine »komplementäre« (Grawe et al., 1994, S. 782) oder bedürfnisorientierte Beziehungsgestaltung (Caspar 2015) zu bemühen, die dem Patienten hinsichtlich der »wichtigsten erschlossenen positiven Ziele des Patienten« (Grawe et al., S. 782) eine neue und korrektive Erfahrung vermittelt.
Damit bleiben sie letztlich bei einem instrumentellen Gebrauch der therapeutischen Beziehung und vertreten einen direktiven Ansatz, wie er in ähnlicher Form auch schon in der Geschichte der Psychoanalyse von Alexander und French (1946) beschrieben worden war, der allerdings als manipulativ angesehen wurde und deshalb immer schon höchst umstritten war und auch heute weitgehend abgelehnt wird (Walter 2010).
Im Gegensatz dazu besteht der originäre und emanzipatorische Beitrag der Psychoanalyse zur Gestaltung einer hilfreichen Beziehung zwischen Therapeut und Patient nicht in der gezielten Beeinflussung, sondern in der Reflexion und im Verstehen dessen, was in der Begegnung zwischen ihnen geschieht und über den Vorgang der Externalisierung innerer Konflikte in Szene gesetzt wird. Wenn Grawe et al. (1994) und die heutigen beziehungsorientierten Verhaltenstherapeuten (Caspar 2015) davon sprechen, die Probleme des Patienten in der Beziehung zum Therapeuten zu aktualisieren, so bewegen sie sich noch in einem relativ engen und traditionellen Übertragungsbegriff, in dem z. B. die Persönlichkeit des Therapeuten völlig ausgespart bleibt und nur dem zielgerichteten instrumentellen Einsatz dient. Sie gehen auch nicht darauf ein, inwiefern und auf welche Art die Arbeit mit der Gegenübertragung und ihre Reflexion im konkreten therapeutischen Vorgehen einbezogen wird. Gerade hier nun liegt aber einer der Schwerpunkte der modernen Psychoanalyse. Gerade hinsichtlich der Bedeutung, die sowohl der Übertragung wie auch der Gegenübertragung beigemessen wird, hat sich während der letzten Jahre ein tiefgreifender Wandel vollzogen (Bettighofer 2001, 2003, 2007, 2014, 2015, Hartmann und Milch 2000, Kernberg 1993, Pulver 1990, Rohde-Dachser 1993, Thomä 1999 u. 2001, Wallerstein 1998). Der traditionelle objektivistische Übertragungsbegriff, der zunächst im folgenden Abschnitt umrissen werden soll, wurde zunehmend erweitert um eine konstruktivistische und eine interaktionelle Komponente, so dass Übertragung und Gegenübertragung nun als eine »funktionale Einheit« (Kemper 1969) oder als eine »Einheit im Widerspruch« (Körner 1990) gesehen werden können.
In der modernen psychoanalytischen Behandlungstechnik hat sich der Schwerpunkt dementsprechend auch etwas verlagert. War früher eher die genetische Rekonstruktion der neurotisierenden Kindheitssituation und die rationale Einsicht in die unbewussten Konflikte der zentrale Kern der analytischen Behandlung, so steht heute gleichberechtigt die Aktualgenese neurotischen und nichtneurotischen Erlebens in der therapeutischen Beziehung daneben, die Frage also, inwiefern das Erleben des Patienten mit dem Therapeuten zusammenhängt und eine Reaktion auf ihn sein könnte. Die Psychoanalyse hat sich so während der letzten Jahre zunehmend zu einer »Beziehungsanalyse« (Bauriedl 1994) entwickelt, in der die Beziehungssituation zwischen Analytiker und Patient zunehmend zum Fokus wurde und die im Hier und Jetzt abgebildeten Konflikte gezielt bearbeitet werden (Bettighofer 2007). Die immer mehr an Einfluss gewinnenden intersubjektiven und relationalen Ansätze in der Psychoanalyse (Altmeyer und Thomä 2006, Benjamin 2007, Jaenicke 2006, 2010, 2014, Mitchell 1997, Orange 2004) bewegen sich alle im Rahmen einer konsequenten Zwei-Personen-Psychologie (Bettighofer 2014) und beruhen auf einem grundsätzlichen interaktionellen Verständnis der therapeutischen Beziehung und von Übertragung und Gegenübertragung, das ich hier in seinen einzelnen Komponenten darstellen werde.
![]()
2 Das ursprüngliche Übertragungskonzept
Die Grundlogik des ursprünglichen Übertragungsbegriffes ist leicht aus einem einfachen Fallbeispiel von Greenson (1967) ersichtlich.
Bei der Durcharbeitung einer libidinösen ödipalen Vaterübertragung beschreibt die Patientin auf die Aufforderung des Analytikers hin ihre Fantasien, von ihm geliebt, geküsst und penetriert zu werden. Nach einer Pause fährt sie fort: »Ein komisches Detail ist mir eingefallen, als ich dies alles beschrieb. Ihr Gesicht war unrasiert und Ihr Bart hat mich im Gesicht gekratzt. Das ist seltsam, Sie scheinen immer glatt rasiert zu sein« (S. 312). Beim Nachdenken fielen Greenson bestimmte Zusammenhänge aus der Kindheit der Patientin auf und er fragt: »Wer hat Sie immer mit dem Bart gekratzt, als Sie ein kleines Mädchen waren?« Daraufhin schreit die Patientin fast: »Mein Stiefvater, mein Stiefvater, er pflegte mich mit Genuß zu quälen, in dem er sein Gesicht an meinem rieb …« (S. 312).
Greenson hat zur Erläuterung seiner Darstellung der Übertragung sicherlich bewusst ein sehr einfaches Beispiel gewählt, aber es trifft dennoch exakt den Kern des ursprünglichen Übertragungsbegriffes. Der Analytiker als klar und eindeutig abgegrenzter Beobachter hält aufgrund seiner objektiven Erkenntnis der Realität die Fantasie der Patientin, dass er einen Bart habe, für unangemessen, da er offenbar zu dieser Zeit keinen Bart getragen hatte. In dieser Unangemessenheit der fantasierten Wahrnehmung liegt das zentrale Kriterium für das Vorliegen einer Übertragung, die dann auch konsequent hinsichtlich ihrer infantilen Vorlage bearbeitet wird.
2.1 Übertragung als Störung der Realitätswahrnehmung
Übertragung im traditionellen und auch heute noch etwas erweiterten Sinne führt also zu einer Verkennung der Realität, zu einer Störung hinsichtlich des Realitätsprinzips. Im Beispiel von Greenson kann der Wahrheitsgehalt der Wahrnehmung und ihre Verzerrung aufgrund des leicht beobachtbaren Faktums problemlos erkannt werden. In den meisten Übertragungsfantasien, denen wir bei Patienten begegnen, ist diese Eindeutigkeit jedoch nicht oder nur ansatzweise gegeben.
2.2 Übertragung als Regression
Die durch die Übertragungsfantasie gestörte Wahrnehmung der Realität beruht auf einer Regression der Patientin. Ihr Ich wie auch das gerade aktualisierte Objektbeziehungsniveau bewegen sich auf einer kindlichen Ebene. Es findet also eine zeitliche und strukturelle Regression statt, wodurch kindliche und archaische, undifferenziertere und normalerweise unbewusste Erlebnisweisen, Fantasien und Affekte vorherrschen. Diese Regression kann mehr oder weniger weite Bereiche von Ich, Es und Überich einbeziehen. Während bei den meisten neurotischen Störungen nur eine partielle und somit potentiell ichdystone und bearbeitbare Regression vorliegt, erfasst diese Regression in einer Psychose ausgedehnte Teile der Gesamtpersönlichkeit, so dass ein völliger Bruch im Verhältnis zur Realität stattfindet und der Patient vorübergehend wie ein Kind auf Unterstützung und Pflege von außen angewiesen ist.
2.3 Übertragung als Verschiebung
Der Hauptmechanismus, auf dem die Übertragung beruht, ist die Verschiebung. Dabei werden Erfahrungen vom ursprünglichen Objekt auf ein anderes, z. B. den Analytiker verschoben, d. h., es werden energetische Besetzungen von einer inneren Objektrepräsentanz auf eine andere verlagert. Die Verschiebung ist einer der zentralen Abwehrmechanismen und wurde schon von Freud (1900) als ein Hauptmechanismus der Traumarbeit beschrieben. Auch in der Fallgeschichte vom kleinen Hans diente ihm die Verschiebung dazu, dessen Angst vor Pferden zu erklären, die »ursprünglich gar nicht den Pferden galt, sondern sekundär auf sie transponiert wurde« (Freud 1909, S. 286). Damals hatte sich Freud begrifflich offensichtlich noch nicht endgültig festgelegt, denn er gebraucht sowohl in der Traumdeutung (1900, S. 313) wie auch in der Arbeit über die Phobie (1909, S. 49) beide Begriffe, um ein und denselben Sachverhalt zu benennen.
Die Tatsache, dass sich der Übertragungsbegriff aus dem Begriff der Verschiebung heraus entwickelt hat, macht auch deutlich, wie sehr im ursprünglichen Übertragungsbegriff dessen defensive Natur gesehen wurde. Übertragung galt in diesem Konzept als Abwehr, als Schutz des Ichs vor dem Erinnern der pathogenen frühen Objektbeziehungen, auch wenn dies früher wohl selten so eindeutig und konkret formuliert worden war, wie es Körner (1995) aus seiner eigenen Ausbildungserfahrung erinnert, wo Übertragung »als ein besonders diffiziler, wenn auch kaum vermeidbarer Widerstand« (S. 341) gegolten habe. Auch wenn dieser Widerstandsaspekt im Allgemeinen mehr oder weniger auf das Agieren der Übertragung oder des Übertragungswiderstandes bezogen wurde, so schwingt er doch implizit mit. Der Patient überträgt seine introjizierten frühen Objekterfahrungen auf den Analytiker und wiederholt sie in der Beziehung mit ihm, anstatt sie als Erinnerung zu reproduzieren. Es hat historisch gesehen auch sehr lange gedauert, bis der Begriff des Agierens etwas von seinem negativen Bedeutungsgehalt verloren hatte (Gill 1982). Erst seit wenigen Jahren wird das Agieren nicht mehr primär als Widerstand gegen den Fortschritt, sondern als ein unvermeidbarer und konstruktiver Vorgang betrachtet
Das behandlungstechnische Vorgehen bestand gemäß dieser Logik darin, dem Patienten die Unangemessenheit seiner Reaktion aufzuzeigen, sie über genetische Deutungen auf die ursprünglichen kindlichen Erfahrungen zurückzuführen und sie auf dieser Ebene weiter zu bearbeiten. Die Übertragung hatte also somit mehr einen instrumentellen Charakter und diente dazu, Gefühlsreaktionen aus ihren neurotischen Nischen zu locken und sie auf die Person des Analytikers zu verschieben, um sie dann möglichst umgehend auf die »eigentlichen« Ursachen zurückführen zu können, deren Rekonstruktion und Durcharbeitung lange Zeit als der wesentliche therapeutische Wirkfaktor angesehen wurde. Nach Freud (1912) sollte der analytische Sieg auf dem Felde der Übertragung (S. 374) gewonnen werden. Ob er dabei diesen eher instrumentellen Gebrauch im Auge hatte oder ob er eventuell empfohlen hätte, die Reaktionen des Patienten länger im Bereich der aktuellen Übertragung und in der Beziehung zum Analytiker zu halten, können wir heute trotz interessanter Arbeiten über Freuds Arbeitsweise (z. B. Cremerius 1981, Roazen 1999) und trotz historischer Berichte von Analysanden (Blanton 1971, Pohlen 2006) nicht mehr definitiv entscheiden. Aus der Untersuchung von Zeugnissen über Freuds Behandlungstechnik schließt Cremerius (1981) jedoch, dass Freud in seinem praktischen Vorgehen der Übertragung und ihrer Durcharbeitung vermutlich keinen sonderlich großen Stellenwert eingeräumt hat und mit Übertragungsprozessen eher sehr unbedarft, unreflektiert und eher pragmatisch umgegangen sein dürfte.
2.4 Übertragung als Projektion
Ein während der letzten Jahre immer häufiger diskutierter Abwehrmechanismus, der Übertragungsprozessen zugrundeliegen kann, wurde zunächst von Melanie Klein (1942) als projektive Identifikation beschrieben und u. a. von Bion (1970), Gilch-Geberzahn (1994), Jimenez (1992), Kernberg (1987), Mertens (1991), Ogden (1979), Porder (1987) und Schore (2003) weiter differenziert und ausgearbeitet. Dabei werden unbewusste und wegen ihres starken Affektgehaltes unerträgliche Anteile des eigenen Selbst bzw. der Selbstrepräsentanzen auf das andere Objekt verlagert und im Falle der reinen Projektion bei einem relativ hoch strukturierten und gut integrierten neurotischen Patienten als ein Gedanke über den anderen wahrgenommen. Bei Patienten mit mäßigem und geringem Integrationsniveau (OPD 2006), also bei ichstrukturellen Störungen, nimmt dieser Vorgang mehr die Form einer typischen projektiven Identifikation an. Hier beste...