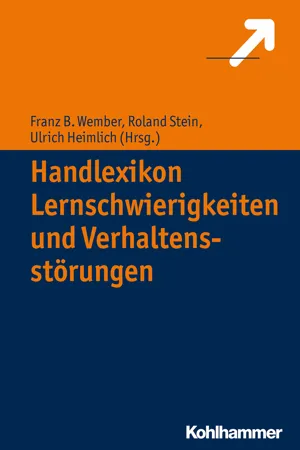
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen
- 364 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen
Über dieses Buch
Das Buch liefert zu den Schlüsselbegriffen der Pädagogik bei Lernschwierigkeiten und Verhaltensproblemen grundlegende Information aus erziehungswissenschaftlicher Sicht. Inhaltlich konzentriert sich das Buch auf die Themen, die für Studierende der beiden Fächer und für die dem Studium folgenden Tätigkeitsbereiche relevant sind. Es werden repräsentative und aktuell handlungsleitende Begriffe behandelt, die die Quintessenz der pädagogischen Theoriebildung und Praxisreflexion erläutern und klären. Der Band bietet so insgesamt eine Einführung in das "wissenschaftliche Grundvokabular" der beiden Fächer. Das Handlexikon reagiert auf die immer wieder geäußerte Klage über die uneinheitliche begriffliche Ausgangslage der Fächer.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Handlexikon Lernschwierigkeiten und Verhaltensstörungen von Franz B. Wember, Roland Stein, Ulrich Heimlich, Franz B. Wember,Roland Stein,Ulrich Heimlich im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Bildung & Lernschwierigkeiten. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
II Förderkonzepte und therapeutische Ansätze
Arbeitslehre
Arbeitslehre ist ein Lernfeld in der Sekundarstufe I und sieht, je nach Bundesland, die Lernbereiche Technik, Haushalt, Ökonomie und Berufsorientierung in einem integrativen Fach oder als kooperierende (Partial-)Fächer vor. Nur in Brandenburg wurde Arbeitslehre nach der Wiedervereinigung als integratives Pflichtfach auch im Gymnasium eingeführt, ansonsten ist es je nach Bundesland unterschiedlich in Haupt-, Real-, Gesamt- und Förderschulen verbreitet. Die Schulfachbezeichnung Arbeitslehre wurde in den vergangenen Jahren zunehmend abgelöst durch »Wirtschaft – Arbeit – Technik« (WAT) oder »Arbeit – Wirtschaft – Technik« (AWT). Im fachdidaktischen Diskurs setzt sich für das Lernfeld seit Anfang der 1990er Jahre die Bezeichnung »Arbeitsorientierte Bildung« durch, verbunden mit einer curricularen Betonung von Erwerbsarbeit, Eigenarbeit und Bürgerarbeit (Duismann & Oberliesen 1995; Meschenmoser 2009a).
Historische Entwicklung
Aufgrund des wirtschaftlichen Wandels mit zunehmender Automatisierung und Rationalisierung der Arbeitswelt resultierten in den 1960er Jahren deutlich höhere Qualifikationsanforderungen an Fachkräfte. Traditionelle Fächer wie Werken (auch Technisches Werken) für Jungen sowie Hauswirtschaft und Textilarbeit für Mädchen konnten diesen Ansprüchen nicht mehr genügen (Dedering 2000). Mit der Arbeitslehre erlangte insbesondere an Hauptschulen die Vorbereitung auf Erwerbsarbeit sowie die Berufsorientierung einen höheren Stellenwert, ab den 1980er Jahren erweitert um die Informations- und Kommunikationstechnologien. In sozialistischen Staaten gab es vergleichbar zum Lernfeld Arbeitslehre die Polytechnische Bildung, in anderen europäischen Staaten sind entsprechende Lernfelder unbekannt (→ Berufliche Bildung).
Typische Methoden der Arbeitslehre sind Betriebserkundung, Betriebspraktikum, Herstellungsaufgabe, Lehrgang, Projektlernen (→ Projektunterricht) und zunehmend Schülerfirmen (Meschenmoser 2009b).
In Folge der TIMSS- und PISA-Erhebungen gab das Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007) zur Qualitätssicherung »Empfehlungen für Nationale Bildungsstandards« heraus, eine Interdisziplinäre Arbeitsgruppe (2006) mehrerer Fachverbände erstellte einen Orientierungsrahmen für ein »Kerncurriculum Beruf-Haushalt-Technik-Wirtschaft« mit Kompetenzmodellen zur Arbeitsorientierten Bildung (Duismann & Meschenmoser 2007; Meschenmoser 2009c). Der durch den sich abzeichnenden demografischen Wandel resultierende gravierende Fachkräftemangel bewirkt für die Arbeitsorientierte Bildung in der öffentlichen Diskussion größere Aufmerksamkeit. Ein »Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs« verständigte sich auf einen »Kriterienkatalog für Ausbildungsreife« (Agentur für Arbeit 2006), der einerseits bundesweite Standards setzt für den Übergang von der Schule in Ausbildung, anderseits zur Qualitätssicherung von schulischen wie von schulergänzenden Maßnahmen zur »vertieften Berufsorientierung« dient.
In der Lehrerbildung wurde mit der Arbeitslehre Neuland betreten, da sich durch die Konstruktion eines Lernfeldes ein weites Spektrum an Bezugswissenschaften ergibt aus Technikwissenschaften, Fachgebieten der Ökonomie, Arbeits- und Haushaltswissenschaften. Erst Mitte der 1990er Jahre wurden die ersten integrativen Studiengänge zugelassen. In den Schulen gibt es einerseits noch immer eine weit verbreitete geschlechtsstereotype Arbeitsteilung zwischen Technik und Haushalt, anderseits großen Qualifizierungsbedarf, um fachdidaktisch angemessene Unterrichtskonzepte zu realisieren.
Arbeitslehre in der Sonderpädagogischen Förderung
Die Sonderpädagogik orientierte sich zunächst an der »Hauptschul-Arbeitslehre«. Den folgenden Diskurs der 1970er Jahre analysierte Vetter (1979), dem zufolge drei unterschiedliche Richtungen zu beobachten sind:
• Böhm (1982) und Hiller (1994) entfalten in ihren Überlegungen besondere Konzepte, die bei Hiller hin zur Forderung nach einer eigenen Schulform verbunden mit einem weitgehenden Verzicht auf traditionelle Berufsbildung führen.
• Zur möglichst optimalen berufsbezogenen Förderung Lernbeeinträchtigter entwickelt Scharff ein auf differenzierter Diagnostik von Basisqualifikationen (Dieterich 1988) beruhendes »Berufsvorbereitendes Funktionstraining« (Schardt & Scharff 1998).
• Ein dritter Ansatz betont schließlich eine fachdidaktisch begründete und methodisch verankerte individualisierte Förderung allgemeinbildender und berufsvorbereitender Kompetenzen mit der Perspektive schulischer und beruflicher Integration (Duismann 1981).
Letzterem Anspruch folgend wurde im Rahmen eines mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanzierten Projekts »Netzwerk Berliner Schülerfirmen« zur Verbesserung der Anschlussfähigkeit von Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Lernen ein Konzept zur Förderung »arbeitsrelevanter Basiskompetenzen« entwickelt (Duismann 2007). Es setzt Kulturtechniken (u. a. Leseverständnis, Mathematische Kompetenz, Problemlösefähigkeit und Medienkompetenz) mit Selbst- und Sozialkompetenzen (u. a. Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Kontaktfähigkeit, Pünktlichkeit) und arbeitsbereichsspezifische Kompetenzen (u. a. ökonomische, technische Kompetenzen) in Beziehung und folgt somit einem weit gefassten Ansatz arbeitsorientierter Bildung zur Vorbereitung auf den Übergang von Schule in Arbeit, Ausbildung und möglichst selbstständige Lebensführung. Ein erster Versuch zur Verankerung von indikatorengestützten Kompetenzmodellen in Rahmenlehrplänen und auf Zeugnissen erfolgte in Berlin zunächst für ausgewählte Selbst- und Sozialkompetenzen, die sich einerseits am »Kriterienkatalog für Ausbildungsreife« (Agentur für Arbeit 2006) orientieren, anderseits an Hand valider und reliabler Beschreibungen auf unterschiedlichem Niveau lernerfolgsorientierte Diagnostik, Lernplanung, Zertifizierung und die Evaluation der Entwicklung arbeitsrelevanter Basiskompetenzen ermöglichen (Duismann & Meschenmoser 2007; Meschenmoser 2008). Für die weiteren fachdidaktischen Forschungen liefert schließlich eine groß angelegte Lernstandserhebung – BELLA – eine breite empirische Basis (Lehmann & Hoffmann 2009). An BELLA nahmen alle Berliner Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen der Jahrgänge 7–10 sowie der berufsqualifizierenden Lehrgänge teil (N = 5.000). Die Auswertungen belegen u. a. die Wirksamkeit sonderpädagogischer Förderung zur Arbeitsorientierten Bildung (Duismann & Meschenmoser 2009; Meschenmoser 2009b). BELLA wirft insbesondere auch mit Blick auf die Bestrebungen zur Inklusion vielfältige Fragen zur weiteren Qualitätssicherung individueller Förderung auf (→ Integration in Arbeit).
Helmut Meschenmoser
Literatur
Agentur für Arbeit (Hrsg.) (2006): Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland: Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife. Nürnberg. Im Internet unter: http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a21_PaktfAusb-Kriterienkatalog-AusbReife.pdf (30.08.2012)
Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2007): Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards – Eine Expertise. Berlin.
Böhm, O. (1982): Zur Konzeption des Lernbereichs Arbeitslehre (Arbeit/Wirtschaft/Technik) in der Schule für Lernbehinderte. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 33, 577–580.
Dedering, H. (2000): Einführung in das Lernfeld Arbeitslehre. 2. Auflage. München.
Dieterich, M. (1988): Diagnostik und Förderung beruflicher Basisqualifikationen. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, Beiheft 15, 37–47.
Duismann, G. H. (1981): Arbeitslehre für zukünftige Hilfsarbeiter, Arbeitslose, Asoziale und Kriminelle? Voraussetzungen für den Arbeitslehreunterricht an der Lernbehindertenschule (Sonderschule). In: Gesellschaft für Arbeit, Technik und Wirtschaft im Unterricht (Hrsg.): Arbeit, Technik, Wirtschaft. Zum Verhältnis von Fachwissenschaft und Didaktik. Bad Salzdetfurth. 291–298.
Duismann, G. H. (2007): Arbeitsrelevante Basiskompetenzen – ein Weg zur Qualitätssicherung in der Arbeitslehre. In: Oberliesen, R. & Schulz, H.-D. (Hrsg.): Kompetenzen für eine zukunftsfähige arbeitsorientierte Allgemeinbildung. Baltmannsweiler. 151–167.
Duismann, G. H. & Meschenmoser, H. (2007): Berufsorientierung systematisch begleiten. Ein Kompetenzstufenmodell für die Unterrichtspraxis. In: Unterricht – Arbeit + Technik, 35, 22–47.
Duismann, G. H. & Meschenmoser, H. (2009): Technisches Verständnis und Problemlösen. In: Lehmann, R. & Hoffmann, E. (Hrsg.): BELLA: Berliner Erhebung arbeitsrelevanter Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf »Lernen«. Münster. 65–88.
Duismann, G. H. & Oberliesen, R. (Hrsg.) (1995): Arbeitsorientierte Bildung 2010. Szenarien – Kontinuität und Wandel. Baltmannsweiler.
Hiller, G. G. (1994): Ausbruch aus dem Bildungskeller. Pädagogische Provokationen. 3. Auflage. Langenau-Ulm.
Interdisziplinäre Arbeitsgruppe BHTW (2006): Kerncurriculum Lernbereich Beruf – Haushalt – Technik – Wirtschaft/Arbeitslehre. In: Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik/Journal of Social Science Education, 3, Im Internet unter: www.jsse.org/2006/2006-3/interdisziplinaere-arbeitsgruppe-bhtw (05.07.2012)
Lehmann, R. & Hoffmann, E. (Hrsg.) (2009): BELLA. Berliner Erhebung arbeitsrelevanter Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf »Lernen«. Münster.
Meschenmoser, H. (2008): Berufsorientierung von Jugendlichen mit Lernproblemen – Ausgangslage und Ansätze für Kompetenzmodelle in der Praxis. In: Jung, E. (Hrsg.): Zwischen Qualifikationswandel und Marktenge. Konzepte und Strategien einer zeitgemäßen Berufsorientierung. Baltmannsweiler. 224–237.
Meschenmoser, H. (2009a): Arbeitsorientierte Bildung 2010. Arbeitslehre im Zentrum – Arbeitslehre im Abseits. In: Unterricht – Arbeit und Technik, 44, 5–10.
Meschenmoser, H. (2009b): Rahmen- und Gelingensbedingungen der Schülerfirmenarbeit. In: Lehmann, R. & Hoffmann, E. (2009): BELLA. Berliner Erhebung arbeitsrelevanter Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderbedarf »Lernen«. Münster. 175–196.
Meschenmoser, H. (2009c): Nationale und internationale Kompetenzbereichs- und Kompetenzstufenmodelle zur technischen Allgemeinbildung. Der Beitrag der Technikdidaktik zur Erfassung individueller Lernentwicklung und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen. In: Theuerkauf, W. E., Meschenmoser, H., Meier, B. & Zöllner, H. (Hrsg.): Qualität Technischer Bildung: Zur Entwicklung von Kompetenzmodellen und Kompetenzdiagnostik. Berlin. 11–37.
Schardt, M. & Scharff, G. (1998): Wege zur Verbesserung der beruflichen Eingliederung für Jugendliche mit Lernbehinderungen. Würzburg.
Vetter, K.-F. (1979): Vergleich der Entwicklung im Bereich Arbeitslehre an Sonderschulen (speziell für Lernbehinderte und Körperbehinderte) mit Entwicklungen im allgemeinen Bildungswesen. München.
Beratung
Unter dem Begriff Beratung bzw. Counselling sind alle spezifischen Interaktions- und Kommunikationsformen zwischen einem Ratsuchenden und einem Berater zu subsumieren, die strukturiert, planvoll, fachkundig und methodisch geschult durchgeführt werden (Mutzeck 2007, 38 f.). Als besonders bedeutsam erweisen sich hier die Freiwilligkeit, eine beidseitige Verbindlichkeit und Verantwortung sowie ein arbeitsförderndes Vertrauensverhältnis. Schulz von Thun (2010) betont, dass alle Botschaften während eines Kommunikationsprozesses neben dem Inhalts- und Beziehungsaspekt ebenso einen Appell- und Selbstkundeaspekt beinhalten. Unter dem Blickwinkel des Konstruktivismus präsentieren Ratsuchender und kompetenter Beratungspartner wechselseitige Ko-Konstruktionsleistungen, um als Experten auf ihrem jeweiligen Gebiet neue Entwicklungsergebnisse zu evozieren (Bundschuh 2008, 158 f.). Die hinter einem solchen Verständnis von Beratung liegende Menschenbildannahme charakterisiert Personen als reflexive Subjekte, die sich durch Rationalität bzw. Intentionalität auszeichnen sowie Sinnorientierung, Erkenntnisfähigkeit, Emotionalität, Verbalisierungs- und Kommunikationsfähigkeit, Handlungskompetenz und Autonomie (Mutzeck 2008, 12). Inzwischen hat sich die Auffassung von Beratung weg von einer vertikalen, direktiven, hierarchischen hin zu einer eher horizontalen, nicht-direktiven und kooperativen Sichtweise entwickelt (Hillenbrand 2008, 156; Stein 2011, 163).
Theorie und Praxis der Beratung gehen ursprünglich auf verschiedene psychologische Konzepte und Therapieansätze zurück. Als die wichtigsten gelten folgende (Diouani-Streek & Ellinger 2007; Schnebel 2007, 36 ff.; Schmid & Garufo 2012, 369 f): die psychoanalytisch bzw. tiefenpsychologisch orientierte Beratung, verhaltenstheoretisch-kognitiv orientierte Ansätze, Ansätze humanistischer Psychologie, die personzentrierte Beratung, systemische Ansätze sowie ressourcen- und lösungsorientierte Beratungsansätze. In praxisnahen Veröffentlichungen werden meist eklektisch Elemente unterschiedlicher Ansätze kombiniert. Trotzdem wird häufig ein integrativer Ansatz in der Beratung bevorzugt, da...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Förderschwerpunkte und Störungsbilder
- II Förderkonzepte und therapeutische Ansätze
- III Förderorte und Organisationsformen
- IV Geschichte
- V Theoriekonzepte und Grundbegriffe
- VI Forschungskonzepte
- VII Internationale Aspekte
- Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
- Sachregister