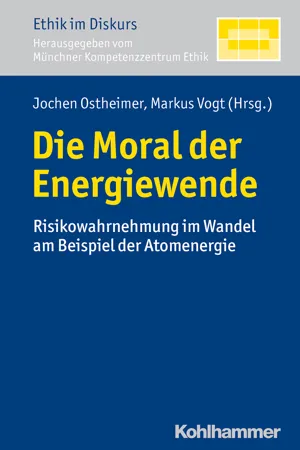![]()
II. Die Energiewende als wirtschaftliches und rechtliches Risiko
Energiewende, Klimaschutz, Schuldenbremse – Vorbild Deutschland?
Reiner Kümmel
„Der Beschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie hier
in Deutschland war richtig. [...] Wir haben jetzt
die Chance, der Welt zu zeigen, dass ein hoch
industrialisiertes Land in der Lage ist, seine
Wirtschaft auf eine Energieform umzustellen, die
sich mit der Bewahrung der Natur vereinbaren lässt.“
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm118
„Die Energiewende ist nichts anderes als eine Operation am
offenen Herzen der Volkswirtschaft.“
Bundesumweltminister Peter Altmaier119
1 Energiewende
Wahrnehmung und Einschätzung der Kernenergie-Risiken haben sich in Deutschland seit den frühen 1970er Jahren sehr gewandelt. Damals hatte die Politik unter großer Zustimmung der Bevölkerung die zögerlichen, teils im Besitz der öffentlichen Hand befindlichen Energieversorgungsunternehmen gedrängt, Kernreaktoren zur Erzeugung elektrischer Energie einzusetzen. Wiederum mit großer Zustimmung der Bevölkerung beschloss die deutsche Bundesregierung nach dem 11. März 2011, unter dem Eindruck der Fukushima-Katastrophe und unter Rückgängigmachung der 2010 von ihr eingeführten Laufzeitverlängerungen der Kernkraftwerke, acht Atommeiler sofort und die verbleibenden neun deutschen Kernspaltungsreaktoren bis zum Jahre 2022 für immer abzuschalten. Was sich Deutschland damit vorgenommen hat, beschreibt die Kanzlerin mit folgenden Worten:
Eine wirtschaftliche, umweltschonende und zuverlässige Energieversorgung – das ist eine Aufgabe, die zu den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zählt. Für die Bundesregierung steht außer Frage: Wir wollen unser Land bei wettbewerbsfähigen Energiepreisen und hohem Wohlstandsniveau zu einer der effizientesten Volkswirtschaften der Welt entwickeln und das Zeitalter der erneuerbaren Energien schneller als ursprünglich geplant erreichen (Merkel 2012, S. 10).
Diese Herausforderung zu meistern wird dadurch erschwert, dass in den wohlhabenden Industrieländern, und ganz besonders in Deutschland, die Risiken einer Energiequelle umso intensiver wahrgenommen und als nicht akzeptabel bewertet werden, je stärker diese Quelle zur Deckung des Energiebedarfs beiträgt. Die Kernenergie ist dafür ein Beispiel, dem im Zuge der deutschen Energiewende weitere folgen dürften.
Die Gefahr ist groß, dass sich Deutschland mit der Energiewende übernimmt. Dafür gibt es zwei Gründe. Deren erster liegt im „Grundgesetz des Universums“, wie die ersten zwei Hauptsätze der Thermodynamik auch genannt werden. Sie zeigen den Januskopf der Energienutzung: Sie schafft materiellen Wohlstand und belastet die Umwelt. Werkeln doch für jeden Deutschen in unseren Maschinen und Verbrennungsanlagen etwa 45 Energiesklaven, von denen jeder rein rechnerisch so viel leistet wie ein Schwerstarbeiter (Kümmel 2011, S. 58 f.). Deren Energieumwandlung in Arbeit und Wärme geht unvermeidbar einher mit Entropieproduktion. Dabei ist Entropie das physikalische Maß für Unordnung, und ihre Produktion ist mit Emissionen von Teilchen und Wärme verkoppelt. Sind diese Emissionen so stark, dass sie die molekulare Zusammensetzung der Biosphäre und die Energieflüsse durch dieselbe spürbar verändern, und erfolgen die Veränderungen schneller als sich die Lebewesen und ihre Gesellschaften daran anpassen können, wirken sie als Umweltbelastungen. Zudem vermindert die Entropieproduktion den Exergie genannten, wertvollen, für jede Energiedienstleistung verwendbaren Anteil einer Energiemenge und erhöht den wertlosen, Anergie genannten Anteil, z. B. an die Umgebung abgegebene Wärme. Damit sind Effizienzsteigerungen der Energieumwandlungsprozesse unüberwindbare physikalische Grenzen gesetzt.
Der zweite Grund für Energiewende-Sorgen liegt in dem gewaltigen Unterschied zwischen der Energiedichte fossiler und nuklearer Energieträger einerseits und den Dichten der uns von der Sonne – direkt über ihre Strahlung und indirekt über Wasser, Wind und Biomasse – gelieferten Energien andererseits. Gewiss wird in Zukunft die Verschmelzung von Wasserstoff zu Helium in immer stärkerem Maße den Weltenergiebedarf decken, und geschieht diese nukleare Energieerzeugung in dem 150 Millionen km von der Erde entfernten Fusionsreaktor Sonne, verliert sich die damit verbundene Entropieproduktion in den Weiten des Weltalls. Nur ein winziger Teil der Sonnenstrahlung trifft und belebt unsere Erde. Doch für das Sammeln und Nutzen der solaren Energien bedarf es wegen ihrer geringen Dichten großer Flächen und großer Materialmengen. Werden zur Produktion der Materialien hauptsächlich fossile Energien eingesetzt, handelt man sich deren klima- und gesundheitsschädlichen Emissionen ein. Landknappheit ist ein weiteres Problem. Darum muss die Gesellschaft beschließen, wie die Risiken und Lasten der Energieversorgung zwischen den Bevölkerungsgruppen und Generationen verteilt werden sollen, und langfristig-vorausschauend komplexe Energie-, Emissions- und Kostenoptimierungen durchführen. Deren ökologische, soziale, wirtschaftliche und technische Rahmenbedingungen sind gesetzlich festzulegen. Geschmeidige Anpassungen dieser Rahmenbedingungen an neue Erfahrungen fördern die nachhaltige Entwicklung. Für überstürzte Revisionen und Kehrtwendungen hingegen gilt „Eile mit Weile“.
1.1 Tokay Mura
„Wir orientieren uns doch sehr an dem, was die entwickelten Länder machen“, sagte mir Shigeru Yasukawa, der Leiter des „Energy System Assessment Laboratory“ im japanischen Kernforschungszentrum Tokay Mura an der Pazifikküste zwischen Tokyo und Fukushima, als wir 1994 im Zusammenhang mit der Erhebung japanischer Wirtschaftsdaten vor dem dortigen Hochtemperaturreaktor standen. Zuvor hatte ich erklärt, wie gut ich es fände, dass dieser in Deutschland mit vier Milliarden DM Steuergeldern bis zur kommerziellen Stromproduktion entwickelte und nach einem Brennelemente-Problem und dem Tschernobyl-Unfall aufgegebene Kernreaktor wenigstens anderswo weiterentwickelt wird; bietet doch dieser Reaktortyp ein Höchstmaß an Sicherheit, weil bei einem Ausfall der aktiven Kühlsysteme natürliche Kühlung durch Konvektion und Wärmeabstrahlung eine Kernschmelze verhindert. Yasukawa hatte geantwortet: „Ja, beinahe hätten wir in Japan dann auch die Weiterarbeit an diesem Reaktor aufgegeben“, und auf mein erstauntes: „Warum sollte Japan den Fehler Deutschlands wiederholen?“ kam von ihm der eingangs zitierte Satz. Da Japan eines der höchstentwickelten Industrieländer ist, blieb mir diese Aussage ein Rätsel – bis zur Fukushima-Katastrophe.
1.2 Fukushima
Eines der schwersten Erdbeben in der Geschichte Japans und der davon verursachte Tsunami mit Wellenhöhen zwischen 13 m und 15 m zerstörten am 11. März 2011 vier Reaktorblöcke des Kernkraftwerks (KKW) Fukushima 1. In den Blöcken 1, 2 und 3 kam es wegen des Ausfalls der Kühlsysteme zum Schmelzen der metallischen Brennelemente im Reaktorkern („Kernschmelze“).
Reaktor 4 war wegen Wartungsarbeiten abgeschaltet. Seine sehr viel Nachwärme entwickelnden Brennelemente lagerten im Abklingbecken im Inneren des Reaktorgebäudes. Auch dessen Kühlung fiel aus. Das Wasser im Abklingbecken erhitzte sich. Am 15. März 2011 explodierte Block 4, wohl aufgrund von Wasserstofffreisetzung und Zündung des mit Sauerstoff gebildeten Knallgases. Insgesamt verursachte die Zerstörung der Blöcke 1 bis 4 etwa 10 bis 20 % der radioaktiven Emissionen des Tschernobyl-Unfalls.
Nach allgemeinem Bekanntwerden der Konstruktions- und Sicherheitsmerkmale des KKW Fukushima 1 verstehe ich jetzt besser Yasukawas Bemerkung über die japanische Orientierung an den „entwickelten Ländern“. Auf dem Gebiet der Kernenergie trifft sie insofern zu, als man sich bei der Errichtung der japanischen KKW zu sehr auf ausländisches Know-How verlassen hatte. Denn die Kraftwerksblöcke von Fukushima 1 wurden zwischen 1970 und 1978 auf dem japanischen Küstenteil des pazifischen Feuerrings nach Konstruktionsplänen für Siedewasserreaktoren errichtet, die die Firma General Electric primär für die KKW entwickelt hatte, die in den 1960er Jahren in den USA in Betrieb gegangen waren. Störfälle in drei japanischen Kernkraftwerken durch Erdbeben zeigten schon in den Jahren 2005 und 2007, dass bei der Auslegung von Reaktoren, insbesondere derer aus den 1970er Jahren, die in Japan möglichen Erdbebenstärken nicht einkalkuliert worden waren. Doch man nahm das in Kauf. Gleiches gilt für die Tsunami-Risiken. Japanische klassische Gemälde sowie Filme aus dem 20. Jahrhundert zeigen Tsunami-Wellen, die sich höher als 20 m aufsteilen. Für den meerseitigen Teil des Fukushima-1-Geländes existierte jedoch nur eine 5,70 m hohe Schutzmauer, und vorgeschrieben waren lediglich 3,12 m. Die 10 m über dem Meeresspiegel gelegenen Reaktorblöcke 1 bis 4 wurden bis zu 5 m tief überschwemmt. Die Notstromgeneratoren im Untergeschoss der Turbinengebäude lagen nur wenige Meter über dem Meeresspiegel und waren unzureichend vor Überflutung geschützt. So zerstörte das Erdbeben die Verbindung der Reaktorblöcke zum Stromnetz, und der Tsunami legte die Notstromgeneratoren lahm. Trotz Schnellabschaltung der Blöcke 1–3 konnte die Nachwärme der Brennelemente mangels Kühlung nicht mehr abgeführt werden, und es kam zur Katastrophe.120
1.3 Restrisiko
Nach der Unfallserie in Fukushima 1 nannte die deutsche Bundesregierung das unterschätze „Restrisiko“ der Kernenergie als Begründung für die Rücknahme der zuvor beschlossenen KKW-Laufzeitverlängerungen121 und den Beschluss zum vollständigen Ausstieg aus der Kernspaltungs-Energie. Vor der Bundestagswahl 2009 hatten Union und FDP keinen Zweifel an ihrer Absicht gelassen, den rot-grünen Atomkonsens aus dem Jahr 2002, der eine Befristung der Regellaufzeiten der KKW auf 32 Jahre seit Inbetriebnahme vorgesehen hatte, durch die Laufzeitverlängerungen zu ersetzen. Die Wähler hatten sie dann auch mit einer komfortablen Mehrheit im Bundestag ausgestattet. Eine vergleichbar große Mehrheit der deutschen Bevölkerung dürfte dann aber auch den abrupten Schwenk in der Kernenergiepolitik nach dem März 2011 mitvollzogen haben. Was immer diese Mehrheit dazu bewogen haben mag – von Fukushima 1 auf bisher unbekannte und weit unterschätzte Restrisiken deutscher KKW zu schließen, ist irrational. Beschreibt doch das Restrisiko Gefahren eines Systems trotz vorhandener Sicherheitssysteme. Es besteht aus einem abschätzbaren und einem unbekannten Anteil. Abschätzbar ist z. B. der gleichzeitige, zufällige Ausfall von Sicherungssystemen. Unbekannt ist z. B. die Wahrscheinlichkeit von Terroranschlägen. Doch für die Fukushima-Katastrophe war nicht die Realisierung eines Restrisikos verantwortlich, sondern eine falsche, nicht ausreichende Auslegung der Anlage gegen Erdbeben und Tsunamis, m.a.W.: die bewusste Inkaufnahme eines bekannten Risikos. In Deutschland hingegen wurde das im Rheintal nahe Koblenz errichtete und am 1. März 1986 in Betrieb genommene KKW Mühlheim-Kärlich wegen baurechtlicher Verfahrensfehler im Zusammenhang mit geologischen Risiken am 9. September 1988 vom Netz genommen; im Sommer 2004 begann der Rückbau.
1.4 Harrisburg und Tschernobyl: Risiken wasser- und graphitmoderierter Kernreaktoren
Das unmittelbare Risiko der Kernenergie liegt in der Möglichkeit eines Unfalls, bei dem sämtliche Kühlsysteme versagen und große Mengen radioaktiven Materials ausgeworfen werden. Für die Risikoanalyse spielt der Moderator eine zentrale Rolle. Die in einer Atomkernspaltung freiwerdenden schnellen Neutronen können nämlich keine weiteren Atomkerne spalten. Sie müssen erst durch den Moderator auf thermische Geschwindigkeiten verlangsamt werden, um die Kettenreaktion aufrechterhalten zu können. Die Siede- und Druckwasserreaktoren westlicher Bauart verwenden Wasser als Moderator. Die in der Sowjetunion entwickelten RBMK-Reaktoren verwenden Graphit.
1.4.1 Wassermoderierte Kernreaktoren
In wassermoderierten KKW dient das Wasser auch als Kühlmittel, aus dem der Dampf produziert wird, der die elektrizitätserzeugenden Dampfturbinen antreibt. Der Kühlwasserkreislauf wird von Pumpen aufrechterhalten und sorgt für die richtige Betriebstemperatur der Brennelemente im Reaktorkern. Falls durch einen Unfall der Kühlwasserkreislauf zum Erliegen kommt, heizen sich die Brennelemente auf, und Dampfblasen bilden sich in dem alsbald kochenden Wasser. Da die Wasserdichte in den Dampfblasen gering ist, wird die Neutronenmoderation empfindlich geschwächt. Man spricht von einem negativen Temperatur- oder Blasenkoeffizient. Anders gesagt: es werden nicht mehr genügend schnelle Neutronen durch Kollisionen mit Wassermolekülen auf thermische Geschwindigkeiten abgebremst, und die Kettenreaktion kommt zum Erliegen. Durch das Einfahren neutronenfressender Regelstäbe wird der Reaktor noch schneller abgeschaltet. Dennoch kann im schlimmsten Fall die Nachwärme, die die Brennelemente durch Beta-Zerfall noch stunden- oder tagelang nach dem Erlöschen der Atomkernspaltung entwickeln, bei mangelnder Kühlung zum Schmelzen der metallischen Brennelemente im Reaktorkern führen. Ein derartiger Unfall ereignete sich am 28. März 1979 im KKW Three Miles Island südöstlich von Harrisburg im US-Bundestaat Pennsylvania. Nach einem Ausfall der Kühlwasserpumpen funktionierte zwar die Schnellabschaltung des Druckwasserreaktors. Aber durch technische Mängel und Bedienungsfehler kam es zu einer teilweisen Schmelze des Reaktorkerns und Freisetzung von Radioaktivität. Die Anlage wurde schwer beschädigt. Dieser Unfall ließ die Opposition gegen die friedliche Nutzung der Kernenergie in den westlichen Industrienationen stark anwachsen.
Der kurz nach dem Harrisburg-Unfall im Rahmen einer Studie des Öko-Instituts Freiburg geschriebene Klassiker „Energiewende: Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran“ (Krause et al. 1980) schlug eine alternative Energieversorgung im Sinne des im Titel genannten Programms vor. Er sprach von den Bürgern, die „Deutschland nicht zu ‚Harrisburgland‘ werden lassen wollen“ (ebd., S. 23), und prägte die Bezeichnung „Dinosauriertechnologie“ für Kerntechnik (ebd., S. 47). Diese Bezeichnung wird von der Anti-Atom-Bewegung gerne als Ausdruck ihrer Verachtung verwendet.122
1.4.2 Graphitmoderierte RBMK-Reaktoren
In RBMK-Reaktoren sind die stabförmigen Brennelemente in moderierendem Graphit eingebettet. Gekühlt werden sie mit Wasser. Im Gegensatz zu wassermoderierten Reaktoren ist hier der Temperaturkoeffizient (Blasenkoeffizient) positiv. Grund dafür ist die Tatsache, dass das Kühlwasser auch immer einen gewissen Teil der Neutronen absorbiert und dass dies beim Entwurf des Reaktors für den Normalbetrieb berücksichtigt werden muss. Versagt nun aus irgendeinem Grunde das Reaktor-Kühlsystem, so erhitzen sich Graphit und Wasser. Im kochenden Wasser bilden sich Dampfblasen. In diesem Falle wird wegen der geringen Wasserdichte in den Dampfblasen die Neutronenabsorption erheblich verringert, während die Moderation durch Graphit weitergeht. Das erhöht die Produktion thermischer Neutronen dramatisch. Wenn Regelstäbe nicht neutronenmindernd eingefahren werden, beschleunigen immer mehr thermische Neutronen die Kettenreaktion, und der Reaktor explodiert. Ein derartiger Unfall ereignete sich am 26. April 1986 im Reaktor 4 des KKW Tschernobyl in der Nähe von ...