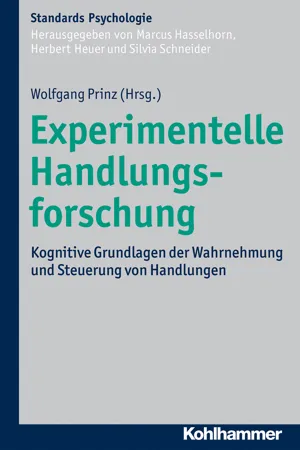![]()
1 Kognitionspsychologische Handlungsforschung: Der Ideomotorische Ansatz
Wolfgang Prinz
In diesem Buch geht es um Handlungen. Was heißt das? Was meinen wir, wenn wir von Handlungen sprechen? Was sind eigentlich Handlungen und wie kommen sie zustande? Auf Fragen, die so allgemein sind wie diese, gibt es meist mehrere richtige Antworten. Welche Antwort man gibt, hängt davon ab, aus welcher Perspektive man auf den in Frage stehenden Gegenstand blickt.
Die Perspektive, die wir hier einnehmen, ist die der experimentellen Kognitionspsychologie. Die Perspektive ist also – erstens – psychologisch, nicht philosophisch, historisch, ethnologisch, soziologisch, theologisch, historisch etc. Das bedeutet, dass wir Handlungen auf der Ebene des agierenden Individuums betrachten und die (natürlich ebenso legitimen) Ebenen der sozialen Systeme und der normativen Regularien, in die sie eingebettet sind, ausblenden. Die Perspektive ist – zweitens – kognitionspsychologisch, nicht motivations- oder sozialpsychologisch. Das bedeutet, dass wir uns auf die kognitiven Prozesse und Mechanismen konzentrieren, die Handlungen zugrunde liegen, und die (natürlich ebenso wichtigen) motivationalen und sozialen Bedingungen weitgehend ausklammern. Und schließlich ist die Perspektive – drittens – experimentalpsychologisch. Das bedeutet, dass wir die empirische Verankerung dieser theoretischen Vorstellungen in experimentellen Aufgaben und Versuchsanordnungen suchen.
Noch vor 20 Jahren hätte ein Buch, das sich diesem thematischen Zuschnitt verschreibt, kaum etwas zu berichten gehabt. In den letzten zwei Jahrzehnten ist aber zweierlei geschehen, das die Situation grundlegend verändert hat. Auf theoretischem Gebiet haben wir die Wiederbelebung und Weiterentwicklung von Konzepten und Ansätzen gesehen, die ein neues Verständnis der schwierigen Beziehung zwischen Kognition und Handlung begründen. Hierzu zählt vor allem der ideomotorische Ansatz, dessen Leitideen ein neues Forschungsprogramm inspiriert haben. Parallel dazu hat die Umsetzung dieses Programms auf methodischem Gebiet eine Reihe neuer experimenteller Paradigmen hervorgebracht, die diese Leitideen auf eine empirische Grundlage stellen.
Das Einleitungskapitel stellt diese neuen Entwicklungen vor. Vor allem versucht es, die historischen und systematischen Hintergründe verständlich zu machen, in die sie eingebettet sind. Bevor wir also die Leitideen der ideomotorischen Theorie und der experimentellen Handlungsforschung vorstellen (
Abschn. 1.3 und
Abschn. 1.4), werfen wir einen Blick auf die historischen und systematischen Kontexte, aus denen diese Leitideen hervorgegangen sind. Zunächst fragen wir, was psychologische und speziell kognitionspsychologische Handlungsforschung ausmacht (
Abschn. 1.1). Anschließend untersuchen wir, was es überhaupt heißt, Handlungen zu verstehen (
Abschn. 1.2).
1.1 Kognitionspsychologische Handlungsforschung – was ist das?
1.1.1 Viel Kognition, wenig Handlung
Im Verständnis des Laienpublikums beschäftigt sich Psychologie mit den Gedanken und Gefühlen, die Menschen durch den Kopf gehen. Wenn das so ist, ist klar, dass kognitive Prozesse zu den zentralen Gegenständen dieser Wissenschaft gehören. Psychologie soll klären, wie Gedanken entstehen und aufeinander folgen, wie Wissen und Erinnerung entstehen und wie wir unsere Umgebung wahrnehmen und verstehen.
Weniger im Fokus ist demgegenüber, was Menschen tun. Was sie tun, folgt zwar manchmal aus dem, was ihnen zuvor durch den Kopf gegangen ist, gehört aber selbst nicht zu dem, was ihnen durch den Kopf geht. Handlungen können nach diesem Verständnis das Ergebnis von kognitiven Prozessen sein, scheinen aber einen anderen Status zu haben als diese Prozesse selbst. Wenn z. B. jemand nachdenkt, was sie in einer bestimmten Situation tun soll, gelten die kognitiven Prozesse, die zur Handlungsentscheidung führen, als psychologisch interessant. Wenn sie dann aber tut, was sie sich überlegt hat, gilt die Handlung selbst nur noch als mehr oder weniger triviales Ergebnis dieser Prozesse. Wie es danach scheint, endet die Zuständigkeit der Psychologie, wenn die Handlung beginnt.
Dass Kognition und Handlung unterschiedliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren, gilt aber nicht nur für die Laienperspektive, sondern auch für die Geschichte und Systematik der wissenschaftlichen Psychologie. Auch hier steht Kognitionsforschung im Vordergrund, während Handlungsforschung nur ein randständiges Dasein führt. Dass das so ist (und sich so schnell wohl auch kaum grundlegend ändern wird), hat historische und systematische Gründe, die sich gegenseitig verstärken.
Historische Gründe
Zu den historischen Gründen rechnet die Tatsache, dass die moderne Psychologie ihre Entstehung ganz wesentlich einer Verbindung von philosophischer Erkenntnistheorie und naturwissenschaftlicher Sinnesphysiologie verdankt. Diese Verbindung bahnte sich im 19. Jahrhundert an und wurde von Autoren wie Helmholtz, Weber, Fechner und Wundt gestiftet. Der Ursprung der modernen Psychologie lag ganz und gar auf der Seite von Empfindung und Wahrnehmung, der Inputseite des kognitiven Systems also. Fragen, die die Outputseite betrafen, spielten zunächst nur eine unter- und nachgeordnete Rolle. Wenn Handlungen überhaupt erwähnt wurden, traten sie überwiegend als Wirkungen von Empfindungs- und Wahrnehmungsprozessen in Erscheinung, nicht aber als Vorgänge, die aus eigenem Recht wissenschaftliches Interesse beanspruchen.
Die Handlungsblindheit der modernen Psychologie hat eine lange Vorgeschichte. So lässt sich z. B. die Doktrin, dass Handlungen als Wirkungen von Wahrnehmungsprozessen anzusehen sind, auf den französischen Aufklärungsphilosophen René Descartes zurückführen (Descartes, 1664/1969). Den Wahrnehmungsprozess stellte er sich so vor, dass Reize, die auf Sinnesorgane treffen, dort kleine Fäden in Bewegung versetzen, die zwischen den Sinnesorganen und dem Gehirn aufgespannt sind. Durch die Mechanik dieser Fäden werden die Sinnesreize an die Zirbeldrüse weitergegeben – denjenigen Ort im Gehirn, von dem Descartes annahm, dass dort der Übergang von Wahrnehmung zu Handlung erfolgt. Die Steuerung von Körperbewegungen stellte er sich dann so vor, dass die Zirbeldrüse aufgrund der von den Wahrnehmungen ausgehenden Reize in Bewegung gerät und dadurch Nervenflüssigkeit freisetzt, die dann über ein hydraulisches System die Muskulatur der Körperperipherie aktiviert.
Die Metaphorik, mit der Descartes die Tätigkeit des Gehirns beschreibt, hat in der Physiologie und Psychologie der nachfolgenden Jahrhunderte lange nachgewirkt. Eine der nicht besonders glücklichen Nachwirkungen betrifft die Implikationen seiner Lehre für das Verständnis von Bewegung und Handlung. Körperbewegungen kommen danach nämlich nur als Wirkungen von Wahrnehmungsprozessen zustande, d. h. sie werden eigentlich nur als Reaktionen auf die Wahrnehmung von äußeren Ereignissen in Gang gesetzt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Theorie keinen Raum bietet für Handlungen, die auf andere Weise entstehen und sich nicht als Reaktionen auf die Wahrnehmung von Ereignissen verstehen lassen.
Bis auf den heutigen Tag hat diese Vorstellung das Denken von Physiologie und Psychologie geprägt. In der Physiologie ist es auch heute noch weitgehend üblich, Bewegung und Handlung als die Endstrecke des sogenannten sensomotorischen Bogens zu betrachten – d. h. als das natürliche Schlussglied einer Kette von Ereignissen, die am Sinnesorgan beginnt und am Muskel endet. Ein Beispiel ist die von Donders (1868) vorgelegte Analyse von Reaktionszeiten, auf die die moderne Forschung sich gern als ihren methodischen und theoretischen Ausgangspunkt bezieht. Donders schlug vor, den gesamten Vorgang, der sich zwischen Reiz und Reaktion abspielt, in zwölf aufeinanderfolgende Teilprozesse zu zerlegen – derart, dass die ersten sechs Teilprozesse den afferenten und die übrigen sechs den efferenten Zweig des sensomotorischen Bogens bilden.
Die linearen Stufentheorien der Informationsverarbeitung, die die moderne Kognitionspsychologie in Anlehnung an Donders entwickelt hat, haben daran nichts Wesentliches geändert. Ihr Forschungsprogramm beruht auf dem Verständnis, dass die Analyse kognitiver Prozesse nur von der Reiz- und Wahrnehmungsseite her in Angriff genommen werden kann. So verkündete bereits Neisser (1967) in seinem programmatischen Manifest der damals neuen Kognitiven Psychologie, dass ihre zentrale Aufgabe darin besteht, zu untersuchen, wie das kognitive System die Information verarbeitet, die es in seiner Umgebung vorfindet. Von Handlungen war in diesem Ansatz nicht die Rede. Handlungen kamen allenfalls als Reaktionen vor – nämlich als messbare Indikatoren für die Informationsverarbeitungsprozesse, die selbst nicht messbar sind. Handlungen selbst waren ohne Interesse.
Systematische Gründe
Hinzu kommen systematische Gründe, die die unterschiedliche wissenschaftliche Aufmerksamkeit für Kognition und Handlung verstärken. Sie ergeben sich aus der Logik der experimentellen Methode und den unterschiedlichen Voraussetzungen für ihren Einsatz im Bereich von Erkenntnis- und Handlungsfunktionen.
Im Bereich von Wahrnehmungs- und Erkenntnisfunktionen ist die methodische Situation relativ übersichtlich. Untersucht wird zum Beispiel, wie Wahrnehmungsleistungen oder Wahrnehmungsinhalte einer Versuchsperson von den Eigenschaften des Reizmaterials abhängen, die vom Versuchsleiter manipuliert werden. In dieser Situation besteht eine enge kausale Verknüpfung zwischen den unabhängigen Variablen, die der Experimentator kontrolliert, und den abhängigen Variablen, die auf Seite der teilnehmenden Probanden gemessen werden.
Anders liegen die Dinge dagegen, wenn es um Handlungen geht. Als abhängige Variablen werden hier Merkmale von Handlungen der Probanden registriert, und zwar gleichfalls in Abhängigkeit von Reiz- und Situationseigenschaften, die der Versuchsleiter kontrolliert. Allerdings besteht ein entscheidender Unterschied. Denn im Gegensatz zu Wahrnehmungs- und Erkenntnisleistungen, die durch die kontrollierten unabhängigen Variablen weitgehend determiniert sind, lassen sich die Eigenschaften von Handlungen durch diese Variablen nur zu einem kleinen Teil kontrollieren. Was eine Person in einer bestimmten Situation wahrnimmt, ist relativ weitgehend durch Merkmale der aktuellen Reizsituation bestimmt. Was sie dagegen tut, ist kaum jemals durch die aktuelle Reizsituation allein bestimmt.
Daraus folgt, dass das experimentelle Vorgehen auf der Handlungsseite komplexer sein muss als auf der Wahrnehmungsseite. Für die Untersuchung von Handlungen reicht es nicht aus, lediglich die aktuellen Reiz- und Situationseigenschaften zu kontrollieren. Daneben müssen auch die aktuellen Handlungsdispositionen der Person manipuliert oder zumindest kontrolliert werden, d. h. die Absichten und Ziele, die sie verfolgt und die sie durch ihre Handlungen realisieren will. In Handlungsexperimenten geschieht dies dadurch, dass den Versuchsteilnehmern Aufgaben gestellt werden, die festlegen, unter welchen Bedingungen welche Handlungen auszuführen sind. Deshalb spielen die Instruktionen, die diese Aufgaben beschreiben und spezifizieren, hier eine wesentlich wichtigere Rolle als in Experimenten zur Analyse von Erkenntnisfunktionen.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, dass wir es hier nicht nur mit einem methodischen Problem zu tun haben. Hinter dem methodischen steckt vielmehr ein theoretisches Problem, nämlich die Frage, wie Handlungsdispositionen (Pläne, Absichten, Ziele) repräsentiert sind und wie sie an der Steuerung von Handlungen mitwirken. Dass sie daran mitwirken, daran besteht kein Zweifel. Wie dies aber geschieht – das ist eine der zentralen Fragen, die eine Theorie der kognitiven Grundlagen von Handlungen beantworten muss.
Historische und systematische Gründe verstärken sich gegenseitig. Das Ergebnis ist eine einfache Diagnose: Psychologie weiß viel über Kognition, wenig über Handlung und noch weniger über den Zusammenhang zwischen Kognition und Handlung. Das ist die Diagnose, für die kognitionspsychologische Handlungsforschung die Therapie sein will.
1.1.2 Kognitionspsychologische Handlungsforschung
Wie kommen Handlungen zustande? Wie kommt es, dass Menschen tun, was sie tun? Das sind Beispiele für Fragen, die psychologische Handlungsforschung beantworten muss. Handlungsbezogene Forschung gibt es seit jeher in verschiedenen Bereichen der Psychologie – trotz der historischen und systematischen Hypotheken, mit denen sie belastet sein mag. Einige Spielarten solcher Forschung sind jedenfalls schon seit langer Zeit erfolgreich etabliert. Kognitionspsychologische Handlungsforschung gehört allerdings nicht dazu. Sie ist eine neue Spielart, die sich erst kürzlich etabliert hat. Wir werfen einen Blick auf den systematischen Ort, den sie im Konzert ihrer Nachbarn einnimmt, und auf die historische Entwicklung, die dazu geführt hat, dass sie sich seit einiger Zeit an diesem Konzert beteiligt.
Systematischer Ort
Wie kommen Handlungen zustande? Wie kommt es, dass Menschen tun, was sie tun? Wenn wir solche Fragen verfolgen, müssen wir uns zunächst vergegenwärtigen, in welchen Teilbereichen der Psychologie wir überhaupt Antworten suchen können. Auf den ersten Blick wird man an Bereiche wie Motivation, Volition und Motorik denken, weniger an Kognition. Das, was wir psychologische Handlungsforschung nennen, muss sich aus der Integration von Perspektiven dieser Bereiche ergeben. Wie können wir die Beiträge d...