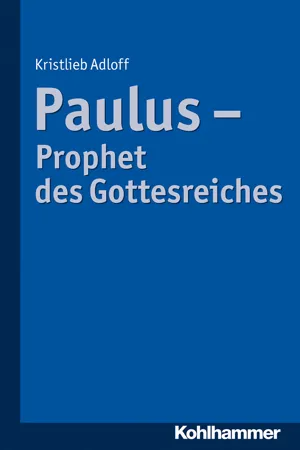![]()
Erster Teil
„Ich, Paulus …“ (2. Kor 10,1; Gal 5,2)
oder
Eine unmögliche Existenz
I.
„Die Briefe sind wuchtig und kraftvoll“
(2. Kor 10,10)
oder
Ein Mann der Schrift
Sich Paulus annähern heißt sich seinem Werk aussetzen. Da Paulus als Sklave des Messias Jesus (Röm 1,1) sein Werk als Werk seines Herrn zu legitimieren hat (1. Kor 9,1;16,10; 2. Kor 6,4), unterliegt jedes Urteil über das Werk der Selbstprüfung des Urteilenden angesichts des Herrn, in dem sich der Gott Israels als Richter über alle Werke der Menschen zu erkennen gibt (Röm 2,6; 14,10; 2. Kor 5,10; 13,5; Gal 6,4). Über die Persönlichkeit des Paulus, seine Motive, zu urteilen, bleibt Gott selbst vorbehalten (1. Kor 4,4f.).
Das Werk des Paulus ist uns heute direkt zugänglich in Gestalt seiner wenn nicht von ihm selbst geschriebenen (Gal 6,11), so doch von ihm diktierten (Röm 16,22), eigenhändig unterzeichneten und als verbindlich deklarierten (1. Kor 16,21; Phlm 19; vgl. Kol 4,18; 2. Thess 3,17) Briefe, von denen es zwar keine Autographen gibt, aber doch eine leidlich zuverlässige Überlieferung. Dabei kann die Frage nach der Echtheit aller im Neuen Testament unter dem Namen des Paulus überlieferten Briefe wie die Möglichkeit einer kritischen Rekonstruktion der ursprünglichen Gestalt der von einem breiten Konsens der Forschung als echt anerkannten Briefe (Röm; 1. und 2. Kor; Gal; Phil; 1. Thess; Phlm) an dieser Stelle insofern unberücksichtigt bleiben, als zunächst die Bedeutung der Tatsache hervorzuheben ist, dass Paulus Briefe geschrieben hat. Für die Fama des Paulus dürfte dieser bemerkenswerte Umstand nicht ohne Einfluss gewesen sein (2. Kor 10,10; 2. Petr 3,15f.), so dass die Entstehung einer neutestamentlichen Briefliteratur ohne Paulus kaum zu denken ist. Warum die Apostelgeschichte den Briefschreiber Paulus nicht zu kennen scheint, ist eine Frage für sich, aber noch nicht damit beantwortet, dass dem Verfasser die Briefe nicht zugänglich gewesen wären. Hat sich die Fama von den Briefen gelöst, so fällt damit noch einmal ein anderer Blick auf das briefliche Werk des Paulus, das nicht mit der Arbeit eines Schriftstellers verwechselt sein will.
Der paulinische Brief ist etwas Einmaliges. Natürlich kann und muss er im Zusammenhang mit der antiken griechisch-römischen Briefkultur gelesen werden. Aber gerade im Vergleich stellt sich seine Einmaligkeit heraus. Es genügt nicht, als Grund für die Briefe des Apostels pragmatische Notwendigkeiten seiner Arbeit als Gemeindegründer und Missionar zu benennen. Vielmehr leben die Briefe von einer einzigartigen Freiheit zum Werk, zu diesem Werk. Er muss dem Philemon nicht in der Weise schreiben, wie er es tut: in der Gestalt eines Bittenden, der sich dem Adressaten gegenüber durch eine schriftliche Selbstverpflichtung verbindlich zeigt (Phlm 8ff.18f.). Er wählt den brieflichen Weg des Verkehrs mit den Korinthern, um sie zu schonen und zu verhindern, dass bei seiner persönlichen Anwesenheit in Korinth irreversible Verletzungen entstehen (2. Kor 1,23–2,4; 13,10). Er verwirft den Gedanken, bei seiner Präsenz unter den Galatern einen zwingend-überzeugenden Ton zu finden, und offenbart stattdessen seine persönliche Aporie, indem er schreibt und seinen Brief eigenhändig, ‚mit großen Buchstaben‘, ja, wenn man so will, mit seinem Blut besiegelt (Gal 4,20; 6,11.17). Der Brief an die Philipper ist, auch als Dankschreiben für empfangene Fürsorge (Phil 4,10–20), ein Zeugnis seiner Autarkie (4,11), zudem seiner Freiheit, im Angesicht eines drohenden Todesurteils zur Förderung der Freude der Adressaten am Leben bleiben zu wollen und um ihretwillen die tiefe Sehnsucht, jetzt schon durch den Tod endgültig bei Christus zu sein, hintanzustellen (1,21–24). Das ist mehr als ‚Einsicht in die Notwendigkeit‘, das ist, wie die bemerkenswerte Formulierung lautet, ‚notwendiger‘ (1,24). Auch den Thessalonichern zu schreiben, ist nicht notwendig (1. Thess 4,9; 5,1), ist vielmehr ein freies und hingebungsvolles Spiel mit dem Wort – „wie arglose Kinder“ (2,7: Zürcher Bibel 2007) –, das, indem es in Abwesenheit des Paulus laut in der Gemeinde gelesen wird (5,27), als die Stimme des Herrn, als Wort Gottes gehört wird (2,13; 4,15–18).
Schließlich zeigt sich im Brief an die „Geliebten Gottes“ und „berufenen Heiligen“ in Rom (Röm 1,7) ein eigentümlicher Überschuss, der nicht mit der in diesem Schreiben ausgedrückten Hoffnung des Paulus, Unterstützung für seine spanischen Pläne zu finden (15,24.28), verrechnet werden kann: fast zu kühn (15,15). Denn ob Paulus „mit der Fülle des Segens“ und „in Freude“ nach Rom kommen wird, kann er nicht wissen. Das steht bei Gott allein, wie er weiß (15,29.32). Wenn Paulus nach Rom schreibt, dann nicht, weil er Vollmacht hätte, Menschen, denen der Messias Jesus schon bekannt ist, etwas mitzuteilen, was sie nicht schon wüssten (15,14.20f.). Vielmehr stellt er mit diesem Brief im Blick auf das Machtzentrum des Imperiums (13,1–7) sein Werk der Macht des Gottes Israels anheim, dessen Gerichte unbegreiflich und dessen Werke unerforschlich sind (11,33). Nicht von Rom – von Jerusalem, vom Zion her, fallen die Entscheidungen (11,26; 15,19.25f.31). Der Brief als Werk des Paulus wäre dann der freie Verzicht auf das eigene Werk zugunsten des Werkes Gottes, priesterlich-aufopfernder Dienst an den Völkern zur Rettung von ‚ganz Israel‘ (11,12–15.25f.; 15,16). So bliebe der Brief, was auch immer sonst von ihm zu sagen ist, ein öffentliches Vermächtnis des Paulus vor aller Welt (1,16), erst recht, wenn die Erfüllung der Hoffnung auf ein gemeinsames Gotteslob der Völker mit Gottes Volk (15,10) noch aussteht. Die Freiheit des Paulus, sich, indem er vor den Völkern für Israel eintritt, unter den Fluch zu stellen, weg von dem Messias (Röm 9,3; vgl. 2. Mose 32,32), unterstreicht den Ernst des Vermächtnisses.
Muss man nicht von daher alle Briefe des Paulus so lesen (1. Kor 16,7.22; 2. Kor 12,15; Gal 6,17; Phil 1,23; 1. Thess 2,18; 5, 27; Phlm 9.22), als letzte Worte, wie in der Abschiedsrede in Milet, die der Verfasser der Apostelgeschichte für die Nachwelt aufschrieb (Apg 20,17–38)? Und verstehen sich so nicht auch die übrigen Briefe des Corpus Paulinum, die nicht mit Sicherheit Paulus zum Autor haben (Eph 3,1; 6,18–22; Kol 1,24; 4,16ff.; 2. Thess 2,5; 3,1f. sowie die sog. Pastoralbriefe 1. und 2.Tim und Tit)? Letzte Worte, die im Gebet Gott anbefohlen werden, sind freilich erste Worte, sofern Gott das letzte Wort hat. Sie sind das stammelnde A wie „Amen, das ist es werde wahr“ (Luther, EG 344,9; vgl. 2. Kor 1,20), das sich ausstreckt nach dem O, der Vollendung, dem „Osanna dem Sohne Davids“, wenn er kommt. Erste Worte wiederholen die Worte der Heiligen Schrift (1. Kor 4,6), machen die Bibel Israels zum ersten, dem grundlegenden Testament in den Versammlungen der Bekenner des Messias Jesus, des letzten Adam, der den ersten Adam als Antitypos wiederholt (Röm 5,14; 1 Kor 15,45).
Für Paulus gibt es weder ein Altes noch ein Neues Testament, sondern nur die Eine Schrift des Einen Gottes. Was als Verheißung für die Völker durch Gottes Mund an Israel ergangen war und vorweg aufgeschrieben wurde (Röm 1,2; 4,17; 15,4), das schreibt Paulus als Sklave des Messias Jesus in seinen Briefen jetzt, im Zeichen des nahen Gottestages, der die Verheißung akut werden lässt (2. Kor 6,2), noch einmal nach, mit „Furcht und Zittern“ (1. Kor 2,3), sei’s freudig, sei’s unter Tränen (2. Kor 2,3f.; 6,10; vgl. Röm 9,2). Dass seine sog. ‚Bekehrung‘, die er selbst als Prophetenberufung beschreibt (Röm 1,1; Gal 1,15), nicht zuletzt auch die Frucht eines intensiven Studiums der Schrift gewesen sein könnte, sollte ernsthaft bedacht werden, falls man sich nicht, um der Skylla der Vorstellung eines supranaturalen göttlichen Eingriffs zu entgehen, in der Charybdis psychologischer Spekulationen verlieren will.
In jedem Fall weiß sich Paulus durch seine Berufung ermächtigt und verpflichtet, nun nicht mit irgendwelchen unerhörten Offenbarungen zu prunken (2. Kor 4,5; 5,13; 12,1–6), sondern die in der Schrift vorgezeichneten unerforschlichen Wege Gottes nachzubuchstabieren. In seinen Briefen müht sich Paulus um ein ABC der Bibel. Sie sind Schreibübungen mit dem Ziel, dass Gottes ewiges Wort in den das Kommen Gottes herbeirufenden messianischen Versammlungen konkret zu Gehör kommt. ‚Buchstabe‘ und ‚Geist‘ (Röm 2,29; 7,6; 2. Kor 3,6ff.) schließen sich nicht aus, sondern sind dialektisch aufeinander bezogen. So wie Gott tötet und lebendig macht (1. Sam 2,6), so richtet und regiert er durch sein lebendiges Wort, das – je nachdem – den Tod wirkt oder das Leben (2. Kor 2,15f.). An ‚Mose‘ muss Paulus, der Prophet für die Völker (Röm 11,13; vgl. Jer 1,10), sich schreibend messen, damit Gottes Wort, das durch Mose geschriebene Wort (Röm 9,15; 10,19), als ein freies, nicht an das Volk Israel allein gebundenes Wort ans Licht (2. Kor 3,12–18) und gerade so Israel zugute komme (Röm 11,12.15; 26–31; Gal 6,16).
Tritt Paulus im Zeichen des Kreuzes in den Riss der Welt zwischen Juden und Griechen (Röm 1,16; 1. Kor 1,22ff.), dann können Missverständnisse bei Freund und Feind nicht ausbleiben. Und da Paulus die Feigheit vor dem Freunde fremd ist (Gal 1,10), sind es gerade die Gegner als Feinde des Kreuzes des Messias (Phil 3,18), deren Gegnerschaft Paulus hilft, sich immer wieder neu zu explizieren. Viel weithin vergebliche Mühe hat sich die gelehrte Forschung gegeben, Einblicke in das Wirken und die Praktiken jener Gegner zu vermitteln, mit denen sich Paulus in seinen Briefen auseinandersetzt. Entscheidend für uns aber ist es zu sehen, wie Paulus selbst immer wieder Gegnerschaft provoziert, indem er Zeugen im endzeitlichen Rechtsstreit zwischen Gott und der Welt herbeiruft und herbeizitiert (2. Kor 2,17; Phil 3,19). Paulus zitiert z.B. den Vorwurf der korinthischen Gegner, er wolle sie durch wuchtige und kraftvolle Briefe aus der Ferne einschüchtern, während doch seine leibliche Gegenwart schwächlich und seine mündliche Rede keiner Achtung wert sei (2. Kor 10,9f.), und unterläuft den vermeintlichen Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Wort und Tat (10,11), indem er gerade den fernen Empfängern seine Schwachheit zumutet, damit die Gegenwart (Parousia: Phil 2,12; vgl. 1. Thess 5,23) ganz der Nähe Gottes, der Kraft der Gnade, der Freiheit seines Wortes geschuldet sei (2. Kor 12,9).
Nichts wäre dem Verständnis der Briefe des Paulus hinderlicher, als sich mit Paulus – auch nicht gegen Apollos oder Kephas (1. Kor 1,12) – zu identifizieren, statt mit ihm ‚durch böse Gerüchte und gute Gerüchte‘ (2. Kor 6,8) der sich aller klugen Berechnung entziehenden Bewegung des Wortes Gottes zu folgen (1. Kor 1,12–24). Die Kanonisierung der paulinischen Briefe im Rahmen des neutestamentlichen Kanons ist missverstanden, wenn man meinte, diese Bewegung wäre dadurch stillgelegt und abgeschlossen. Im Gegenteil! Diese Kanonisierung öffnet die Heiligen Schriften Israels auf das Kommen Gottes hin, so, dass Gottes Kommen mit der als Gegenwart erhofften Zukunft des Messias Jesus verknüpft wird, der mit seinem Sieg über den Tod Raum schafft für das alles durchdringende Leben Gottes (1. Kor 15,20–28). Das letzte Wort steht aus (1. Kor 15,54f.; vgl. Jes 25,8; Hos 13,14). Damit ist die Frage nach dem Verhältnis von Schriftlichkeit und Mündlichkeit des Wortes Gottes für Paulus in einer spezifischen Weise gestellt.
Luther war der Meinung, das ‚Neue Testament‘ sei seinem Wesen nach viva vox, lebendige Stimme, und seine Verschriftung darum ein Notbehelf. ‚Schrift‘ im strengen Sinne sei darum nur das ‚Alte Testament‘.1 Noch einmal anders stellt sich die Situation im rabbinischen Judentum dar, wo die ‚mündliche‘ Tora die ‚schriftliche‘ Tora halachisch aktuell und lebendig erhält und haggadisch die Buchstaben zum Tanzen bringt.2 Für Paulus besteht ein Übersetzungsproblem: Wie kann das fremde Wort Gottes als ‚nahes Wort‘ (5. Mose 30,14) so zum Herzen eines Menschen sprechen, dass er darüber selbst sprachfähig wird, ein ‚mündiger‘ Mensch (Röm 10,8ff.; 1. Kor 14,24f.)? Sicher nicht so, dass ein Mensch dem anderen selbstbezogen ‚seinen‘ Gott und ‚seinen‘ Glauben aufzudrängen sucht. So bliebe der Hörer fremdbestimmt, gefangen in sich selbst und der eigenen Stummheit. Es bedarf hier vielmehr der Vermittlung durch eine Sprache, die dem Hörer jene Freiheit zuspielt und zumutet, die ihn zum Adressaten eines Wortes werden lässt, das er sich selbst hätte sagen müssen, aber ohne das Ereignis dieses Wortes nicht sagen konnte.
Indem der Messias Jesus zwischen den Redenden und den Hörenden tritt, öffnet sich zwischen Himmel und Abgrund ein weiter Raum des Hörens, übersetzt sich das Wort in das Herz jedes Einzelnen (Röm 10,17). Dadurch, dass Paulus Briefe schreibt und das geschriebene Wort Gottes nachbuchstabiert, wirkt er nicht unmittelbar, sondern mittelbar, und erweist sich so als freier Diener des freien Gottes, des Gottes, der zu den Juden als Juden, den Nichtjuden als Nichtjuden, den religiös Unbegabten als religiös Unbegabten zu reden versteht und eben so der EINE, der alles einende Gott, der Gott Israels, bleibt (1. Kor 9,19–22). Wird der paulinische Brief in der Gemeinde (laut!) vorgelesen (1. Thess 5,27), kommt die lebendige Stimme Gottes zu Gehör. (Das hebräische Wort qārā bedeutet sowohl Rufen wie Lesen, und miqrā, das Gelesene, ja Gesungene, ist eine jüdische Bezeichnung für die Schrift.)
Für die einzigartige Freiheit des Briefschreibers Paulus findet sich eine Analogie in seinem Verzicht auf Unterhalt durch die Korinther, worauf er Anspruch erheben könnte. Es geht dabei einerseits um die Unabhängigkeit des allein von Gott und seinem Evangelium Abhängigen, aber andererseits in eins damit um die Unabhängigkeit der Gemeinde von jedwedem Zwang (1. Kor 9,16ff.; 2. Kor 1,24; 11,7–10; vgl. Phil 4,11ff.). Konkret: Neben seiner Freiheit zum Briefschreiben ‚mit eigener Hand‘ hat Paulus auch noch die Freiheit zu einem anderen Werk, nämlich mit eigenen Händen zu seinem Unterhalt zu arbeiten (1. Kor 4,12; 1. Thess 2,9; vgl. Apg 18,3; 20,34). Was für seine Mitarbeiter, nicht nur für die ‚falschen Brüder‘ (2. Kor 11,26), wie auch für seine heutigen Interpreten schwer zu verstehen ist: Paulus ist kein Maulwerker, sondern ein Handwerker.
Auch seine Briefe sind in diesem Sinne Handwerk, Denkarbeit nicht eines sitzenden Gelehrten, sondern eines reisenden Gesellen ‚auf der Walz‘ (Röm 10,15; 1. Kor 9,24.26; Phil 2,16; 3,14), so dass sein Werk Hand und Fuß hat. Muss Paulus zwischendurch ‚einsitzen‘ (Phil 1,7; Phlm 1; vgl. Eph 3,1; 6,20; Kol 4,18; 2. Tim 1,8), so zeigt es sich, dass Gottes Wort nicht gebunden ist an ihn, den Gottverbundenen (2. Tim 2,9). Das briefliche Werk des Paulus, wie es Karl Barth vom Römerbrief meinte3, kann warten, bis es den Leser findet, den es sucht, nämlich jeden, der sich von Gottes Händen ergreifen lässt (Röm 10,21; vgl. Jes 65,2), nicht als von einem ‚Angebot‘, sondern von der gebietenden Macht dessen, der den Satan, den Hinderer seines Werkes, unter unsere Füße zu treten imstande ist (Röm 16,20), den Befreiergott vom Sinai.
II.
„Laut meinem Evangelium“ (Röm 2,16)
oder
Ein Jude als Apostel der Völker
Wenn Paulus im Römerbrief sagen kann: „Auch ich bin ein Israelit“ (11,1), dann sagt er das an dieser Stelle nicht aus Trotz gegen jüdische Mitbrüder (wie 2. Kor 11,22; Phil 3,5), sondern als Zeuge für die Wahrheit der Schrift. Gerade er, der Apostel der Völker, der Gojim (Röm 11,13), steht dafür, dass Gott sein Volk Israel nach dem Wort der Schrift (1. Sam 12,22; Ps 94,14; vgl. Röm 11,2) nicht zu verstoßen gedenkt, weil und wie er es nicht verstoßen hat. Paulus liest sich selbst in die Schrift hinein, in die göttliche Weisung über die 7000 ganz Israel repräsentierenden Gottgetreuen, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem fremden Gott, dem gojischen Baal (1. Kön 19,18; vgl. Röm 11,2ff.). Und so ist ‚sein‘ Evangelium (Röm 2,16), das in den Heiligen Schriften Israels vorweg angekündigte (Röm 1,2) Evangelium von dem Messias Jesus, der ‚gemäß den Schriften‘ um unserer Sünden willen starb und am dritten Tage auferweckt wurde (1. Kor 15,3ff.), ein israelitisches, ein jüdisches Evangelium.
Dagegen lässt sich natürlich einwenden, Paulus habe sich doch vom ‚Judaismus‘, der jüdischen Lebensweise, scharf distanziert (Gal 1,13f.); er habe sie wie ein ekelhaftes Exkrement hinter sich gelassen (Phil 3,8) und dagegen gekämpft, sie den Menschen aus den Völkern in Gestalt der Beschneidung (Sabbat, Speisegebote etc.) aufzuzwingen (Gal 2,3.14; 6,12; vgl. Phil 3,2). Doch wie ist diese Distanzierung, die ja in der Unterscheidung von leiblicher Beschneidung und Beschneidung des Herzens Anhalt an der Schrift hat (5. Mose 10,16; 30,6; Jer 4,4; 9,25f.; vgl. Röm 2,29; Phil 3,3), zu verstehen?
Sicher nicht als religiöser Gegensatz zwischen einer bloß äußerlichen und einer innerlichen Religiosität! ‚Leib‘ und ‚Herz‘ sind biblisch zwar zu unterscheiden, aber nicht zu trennen. Der Leib unterliegt der Verantwortung des Menschen, wie Paulus weiß (Röm 12,1; 1. Kor 6,20; 9,27; 2. Kor 5,10), während das Herz, vor Menschen, vor mir selbst verborgen, Gott, dem Herzenskündiger, zugeordnet ist (1. Sam 16,7; Jer 17,9; vgl. Röm 2,16.29; 8,27; 1. Kor 4,5; 14,25). Gehört der sterbliche Leib der Vergangenheit, so das Herz der Zukunft. Die Gegenwart indes ist für Paulus bestimmt durch ein Ereignis in der Zeit (Gal 4,4), das eine Umkehrung herbeiführt: Mit dem Kommen des Messias Jesus, der als Herr über Tote und Lebende bekannt wird (Röm 14,9), kann der Leib der Zukunft Gottes in der Auferstehung der Toten überantwortet werden (Röm 8,11; Phil 3,21), während das Herz sich öffnen lässt für die gegenwärtige ...