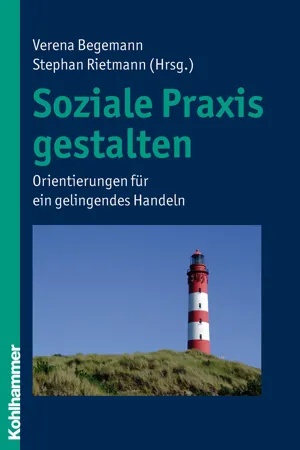![]()
I Theorien der Entwicklung von Persönlichkeit und Beziehung
1 Die Bedeutung von Bindung in der Sozialen Arbeit
Karl Heinz Brisch
1.1 Einleitung
Die Bindungstheorie wurde erstmals von John Bowlby formuliert, der als Psychiater und Psychoanalytiker in den 1960er Jahren in London lebte. Diese Theorie besagt, dass ein Säugling bei seiner Geburt eine angeborene Motivation mitbringt, sich an einen Menschen zu binden, der für ihn zum sicheren emotionalen Hafen wird. Wann immer der Säugling Angst erlebt, etwa durch die Trennung von seiner Bindungsperson, werden seine Bindungsbedürfnisse aktiviert und er sucht aktiv die Nähe und den Körperkontakt zu seiner Bindungsperson. Körperkontakt beruhigt auf vorzügliche Weise das aktivierte Bindungssystem eines Menschen (Bowlby, 1975).
Alle Menschen können potenziell für einen kleinen Säugling zur Bindungsperson werden. Vortrefflichste Aufgabe einer Bindungsperson ist es, das Überleben des Säuglings zu sichern, der in jeder Hinsicht von ihr abhängig ist. Dieses motivationale System „Bindung“ steht mit einem anderen motivationalen System, dem Erkundungssystem, in einem engen Wechselkontakt. Beide Systeme stehen wie auf einer Wippe zueinander in Bezug. Wenn etwa das Bindungsbedürfnis aktiviert ist, weil das Kind in einer pädagogischen Einrichtung Angst hat, dann kann Lernen nicht sehr ausgeprägt oder entspannt stattfinden. Bindungssicherheit ist eine Voraussetzung für kognitive und emotionale Lernprozesse. Ein Kind kann, obwohl es eine begabte Geigen- oder Pianolehrerin neben sich sitzen hat, weder Klavier noch Geige spielen lernen, wenn es Angst vor der Lehrerin hat. Unter diesen Umständen ist sein Bindungsbedürfnis aktiviert und die Möglichkeit zur Exploration des Musizierens nicht sehr ausgeprägt. Auch wenn die Lehrerin technisch noch so perfekt und pädagogisch hervorragend ausgebildet ist, wird der Lernprozess eines Kindes miserabel schlecht sein, wenn sie ihm Angst macht.
Umgekehrt, wenn sich in einem Kind ein Gefühl von Bindungssicherheit ausbreitet, weil die Angst sozusagen durch die Nähe zur Bindungsperson gedämpft wird und Beruhigung entsteht, kann Lernen besonders gut stattfinden. Dann ist ein Säugling oder ein Kind in der Lage, die Welt zu erkunden, indem es sich von seinem Explorations- und Neugierverhalten leiten lässt. Mit einem inneren Gefühl von Bindungssicherheit kann man schließlich um die ganze Welt fahren und das Leben in seinen verschiedensten Varianten erkunden.
1.2 Die Entwicklung von Bindungssicherheit
Feinfühliges Interaktionsverhalten, etwa der Mutter, des Vaters oder einer Pädagogin, eines Pädagogen, fördert die Entwicklung einer sicheren Bindung. Eine dialogische Sprache ist ebenfalls für die sichere Bindungsentwicklung förderlich. Mütter wie Väter sprechen mit ihren Säuglingen so, dass sie die Affektzustände des Säuglings benennen. Die Mutter sagt etwa: Meine Güte, hast Du Hunger, bist Du durstig, hast Du eine Wut. Für kleine Säuglinge ist das emotionale Erleben insgesamt mit einer unspezifischen Stressreaktion verbunden, denn sie können verschiedene Affekte noch nicht sehr gut differenzieren. Viele Kinder, die in Jugendhilfeeinrichtung betreut werden, sind auf einem frühen Stadium der undifferenzierten Affektentwicklung stehen geblieben, da ihnen in den frühen Entwicklungsjahren feinfühlige Interaktionspartner fehlten, die mit ihnen sprachen, sich in ihre Affektwelt eingefühlt haben und ihren Affekten Worte gaben. Kinder sind ebenso auf feinfühlige Pädagogen sowie Sozialarbeiter angewiesen, die diese Sprachfunktion übernehmen und verschiedene Affekte in ihrem spezifischen Kontext benennen. Der sprachliche Austausch muss in einem gewissen dialogischen Rhythmus erfolgen, damit hierdurch die sichere Bindungsentwicklung gefördert wird (Ainsworth, 2003; Ainsworth & Bell, 2003).
In Interaktionsstudien konnte man sehen, wie Mütter selbst mit ihren drei Monate alten frühgeborenen Säuglingen beim Wickeln feinfühlig auf vielen Ebenen interagieren können (Brisch et al., 2005). Und wenngleich die frühe Startzeit nicht so feinfühlig verläuft, so besteht dennoch die Möglichkeit, durch spätere feinfühlige Interaktionserfahrungen eine sichere Bindung zu entwickeln. Dies kann sich im Säuglingsalter ereignen, aber auch in der Adoleszenz bei Jugendlichen. Neue feinfühlige und emotional verfügbare Interaktionserfahrungen, die über einen längeren Zeitraum vorhersehbar sind und bei denen die Bindungsperson emotional für die Signale des Gegenübers verfügbar ist, helfen dem Gehirn vermutlich, sich neu zu strukturieren und es besteht nochmals eine neue Chance für eine sichere emotionale Entwicklung. Das Bindungssystem bleibt zeitlebens offen für neue Bindungserfahrungen und somit für Veränderungen. Dies ist besonders für die pädagogische Arbeit und die Soziale Arbeit von großer Bedeutung, weil es Ziel dieser Arbeit ist, den Kindern und Jugendlichen mit Bindungsstörungen neue emotionale Erfahrungen in Beziehungen zu ermöglichen.
1.3 Bindungsqualitäten
Werden die Bedürfnisse des Säuglings in dieser von Ainsworth (1977) geforderten feinfühligen Art und Weise von einer Pflegeperson beantwortet, so besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass der Säugling zu dieser Person im Laufe seines ersten Lebensjahres eine sichere Bindung entwickelt. Wenn man Säuglinge im Alter von einem Jahr in einer Trennungssituation von ihrer Bindungsperson untersucht, zeigen in nicht-klinischen Stichproben ca. 60 % der Kinder mit 12 Monaten eine sichere Bindung an ihre Bindungsperson, etwa die Mutter, und ca. 50 % an ihren Vater. Dies bedeutet, dass ein sicher gebundener Säugling seine spezifische Bindungsperson bei Bedrohung und Gefahr als „sicheren Hort“ und mit der Erwartung von Schutz und Geborgenheit aufsuchen wird. Wenn sich etwa die Mutter von ihm trennt und bei ihm Angst aufkommt, dann wird das Bindungsbedürfnis aktiviert und wir können beim Säugling Bindungsverhalten beobachten. Dies zeigt sich darin, dass er weint, ruft, der Mutter nachläuft, er sucht aktiv wieder Körperkontakt mit der Mutter, um sich schließlich auf ihrem Arm wieder rasch zu beruhigen (Ainsworth & Wittig, 2003).
Reagiert die Pflegeperson eher mit Zurückweisung auf seine Bindungsbedürfnisse, so besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Säugling sich an diese Pflegeperson mit einer unsicher-vermeidenden Bindungshaltung bindet (ca. 25 % der Säuglinge). Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind wird in Notsituationen eher die Bindungsperson meiden oder nur wenig von seinen Bindungsbedürfnissen äußern. Es hat eine Anpassung an die Verhaltensbereitschaft seiner Bindungsperson gefunden, das heißt, Nähewünsche werden von dem Säugling erst gar nicht so intensiv geäußert, da er weiß, dass diese von der Pflegeperson auch nicht so intensiv mit Bindungsverhalten im Sinne von Schutz und Geborgenheit gewähren beantwortet werden. Dies führt jedoch zu einer erhöhten inneren Belastung des Säuglings, die an erhöhten Werten des Stresshormons Kortisol gemessen werden kann (Brisch et al., 1999). Bindungsvermeidende Kinder verhalten sich scheinbar „cool“ in Angst machenden Situationen. Sie sind sehr beliebte Prototypen und viele Mütter wünschen sich solche Kinder, weil man sie schnell mal bei der einen oder anderen Betreuungsperson unterbringen kann und sie jeden fremden Babysitter scheinbar problemlos akzeptieren. Sie weinen nicht, rufen nicht, laufen nicht hinter der Mutter her und protestieren nicht. Vielmehr tun sie so, als sei etwa eine Trennung von der Mutter für sie gar kein Problem. Misst man dann aber das Stresshormon Kortisol im Speichel und im Blut, zeigen diese Kinder nach einer Trennungssituation maximalen Stress, obwohl sie bis zum ersten Lebensjahr schon gelernt haben, diesen nicht mehr zu äußern, was sie sonst evolutionsbiologisch eigentlich täten.
Werden die Signale manchmal zuverlässig und feinfühlig, ein anderes Mal aber eher mit Zurückweisung und Ablehnung beantwortet, so entwickelt sich eine unsicher-ambivalente Bindungsqualität (ca. 10 %) zur Pflegeperson, zum Beispiel zur Mutter. Diese Säuglinge mit einer unsicher-ambivalenten Bindung reagieren auf Trennungen von ihrer Hauptbindungsperson mit einer intensiven Aktivierung ihres Bindungssystems, indem sie lautstark weinen und sich intensiv an die Bindungsperson klammern. Über lange Zeit sind sie kaum zu beruhigen und können nicht mehr zum Spiel in einer ausgeglichenen emotionalen Verfassung zurückkehren. Während sie sich einerseits an die Mutter klammern, zeigen sie andererseits aber auch aggressives Verhalten. Wenn sie etwa bei der Mutter auf dem Arm sind, strampeln sie und treten nach ihr mit den Füßchen, während sie gleichzeitig mit ihren Ärmchen klammern und Nähe suchen. Dieses Verhalten wird als Ausdruck ihrer Bindungsambivalenz interpretiert (Ainsworth & Wittig, 2003).
In der Bindungsforschung wird noch unterschieden, ob ein Kind ein „organisiertes“ oder ein „desorganisiertes“ Bindungsmuster entwickelt hat. Die sicheren und unsicheren Bindungsqualitäten sind organisierte Bindungsmuster. Dies bedeutet, dass eine Mutter bei ihrem einjährigen Säugling genau weiß, wie er reagieren wird, wenn sie sich etwa von ihm trennt. Die Mütter können genau vorhersagen, ob ihr Kind weint oder ob es eher „cool“ im Sinne der unsicher-vermeidenden Bindungsqualität reagiert. Innerhalb des ersten Lebensjahres hat sich somit ein vorhersagbares Bindungsverhalten entwickelt, dem eine neurobiologische Repräsentation oder ein neuronales Muster zugrunde liegt, das auch als ein „Inneres Arbeitsmodell von Bindung“ bezeichnet wird. Dieses legt fest, wie Bindungsverhalten zwischen einem einjährigen Säugling und seiner Bindungsperson reguliert wird.
Erst später wurde noch ein weiteres Bindungsmuster gefunden, das als desorganisiertes und desorientiertes Muster bezeichnet wird. Diese Kinder zeigen Sequenzen stereotyper Verhaltensweisen oder sie halten im Ablauf ihrer Bewegungen inne und erstarrten für die Dauer von einigen Sekunden. Dies wird dahingehend interpretiert, dass diese Kinder keine aktuelle Bindungsverhaltensstrategie zur Verfügung haben. Diese Kinder laufen manchmal auf die Mutter zu, wenn die Mutter nach einer Trennung wiederkommt, nach einer anderen Trennung laufen sie vor der Mutter davon, bleiben plötzlich stehen, geraten in tranceartige Zustände – dieses wechselnde Verhalten ist nicht vorhersehbar. Ungefähr 15 % bis 20 % der Kinder in unausgewählten Stichproben zeigen ein solches desorganisiertes Bindungsmuster. Aus mehreren Längsschnittstudien ist bekannt, dass bei unverarbeiteten Traumaerfahrungen der Eltern und manchmal auch bei Traumaerfahrungen der Säuglinge dieses desorganisierte Bindungsmuster auf bis zu 70 % bis 80 % der Kinder zutreffen kann. Viele Kinder und Jugendliche, die in Pflegestellen und Heimen leben, zeigen solche desorganisierte Verhaltensweisen in bindungsrelevanten Situationen (Main & Hesse, 1992; van IJzendoorn et al., 1999; Solomon & George, 1999).
1.3.1 Bindungsrepräsentation (Bindungshaltung) der Bezugsperson
Durch ein spezifisches, halbstrukturiertes Erwachsenen-Bindungs-Interview (George et al., 2001) gelang es auch, Aufschluss über die Bindungshaltung der Erwachsenen zu gewinnen. Es fanden sich ähnliche Bindungsstile wie bei den Kindern.
Erwachsene mit einer sicheren Bindungshaltung können im Interview frei und in einem kohärenten Sprachfluss über ihre Erfahrungen von Bindung, Verlust und Trauer, die sie mit ihren Eltern und wichtigen Bezugspersonen erlebt haben, sprechen.
Erwachsene mit einer unsicher-distanzierten Bindungshaltung weisen zwischenmenschlichen Beziehungen und emotionalen Bindungen wenig Bedeutung zu. Erwachsene mit einer unsicher-verstrickten Bindungshaltung zeigen im Interview durch eine langatmige, oft inkohärente Geschichte und Beschreibung ihrer vielfältigen Beziehungen, wie emotional verstrickt sie zum Beispiel mit ihren Eltern und anderen Beziehungen bis zum Erwachsenenalter noch sind.
Es wurde später noch ein weiteres Bindungsmuster im Zusammenhang mit ungelösten, traumatischen Erlebnissen gefunden, wie etwa nach unverarbeiteten Verlusten sowie nach Missbrauchs- und Misshandlungserfahrungen, das als „unverarbeiter Verlust/Trauma“ bezeichnet wurde (Ainsworth & Eichberg, 1991; Lyons-Ruth & Jacobvitz, 1999; Madigan et al., 2007).
1.3.2 Bindungskontinuität zwischen den Generationen
Durch verschiedene Längsschnittstudien sowohl in Deutschland als auch in den USA und England konnte nachgewiesen werden, dass sicher gebundene Mütter zu ca. 75 % sicher gebundene Kinder haben, Mütter mit unsicherer Bindungshaltung dagegen häufiger Kinder, die mit einem Jahr unsicher gebunden sind. Ähnliche Zusammenhänge, wenn auch nicht mit gleicher Intensität (nur ca. 65 % Übereinstimmung), fanden sich für die Beziehung zwischen der Bindungshaltung der Väter und der Bindungsqualität ihrer Kinder.
Diese Studien weisen auf eine Weitergabe von Bindungsstilen und -mustern zwischen den Generationen hin. Die eigene Bindungshaltung der Mutter (bzw. des Vaters) beeinflusst ihr Verhalten gegenüber ihrem Säugling. Es konnte nachgewiesen werden, dass sicher gebundene Mütter sich auch in der Pflegeinteraktion mit ihren Kindern feinfühliger verhielten als unsicher gebundene Mütter. Die Mutter-Kind-Interaktion scheint ein wichtiger Prädiktor zu sein, aus dem heraus sich in Teilbereichen die Ausbildung der Bindungsqualität des Säuglings im ersten Lebensjahr erklären lässt (Brisch, 2003; Egeland et al., 2001; Fonagy & Target, 2005; Brisch et al., 2002).
1.4 Sichere Bindung als Schutzfaktor
Sichere und unsichere Bindungsentwicklungen sind noch keine Psychopathologie, sondern sie sind Schutz- und Risikofaktoren. Kinder mit einer sicheren Bindung sind gegenüber psychischen Belastungen widerstandsfähiger, wie z. B. bei einer Scheidung der Eltern, die für viele Kinder eine große emot...