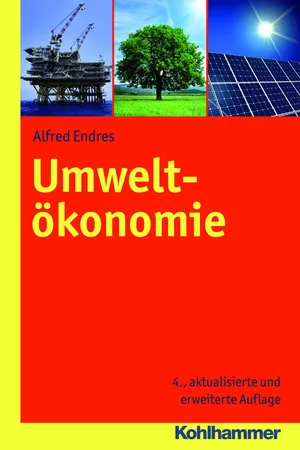![]()
Fünfter Teil
Internationale Umweltprobleme
A. Einführung
In der vorstehenden Erörterung haben wir meist unterstellt, dass der räumlichen Verteilung von Emissionen keine wesentliche Bedeutung für die Umweltpolitik zukommt. Dort, wo ihre Implikationen doch einmal thematisiert wurden (z. B. in Abschnitt C.III.7 des dritten Teils), sind wir stillschweigend davon ausgegangen, dass räumliche Probleme im Rahmen der nationalen Umweltpolitik bewältigt werden können. Nun ist es aber bekanntlich so, dass Schadstoffströme nicht vor den Landesgrenzen haltmachen. Die Reihe der internationalen Umweltprobleme reicht vom namenlosen »Nachbarschaftskonflikt« im grenznahen Bereich über mehrere Staaten verkettende »Unterlieger-Oberlieger«-Probleme (wie die Rheinverschmutzung) und Phänomene weiträumiger Schadstofftransporte (z. B. den »Sauren Regen«) bis hin zu weltumspannenden (»globalen«) Problemen, wie dem »Ozonloch« und dem »Treibhauseffekt«. Insbesondere die zuletzt genannten Probleme haben in den letzten Jahren eine erhebliche Aufmerksamkeit in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft erfahren. Wir wollen uns daher (und aus Platzgründen) im Folgenden auf den »Extremfall der Internationalität« im Umweltbereich, die globalen Umweltprobleme beschränken. Globale Schadstoffe zeichnen sich vor allen anderen Schadstoffen dadurch aus, dass es für ihre umweltbelastende Wirkung unerheblich ist, an welchem Ort sie verursacht werden. So kommt es nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand für die Erwärmung der Erdatmosphäre auf den Gesamtausstoß an so genannten Treibhausgasen (354 und nicht auf ihr regionales Entstehungsprofil an. Ähnlich verhält es sich mit der Wirkung des FCKW-Ausstoßes für das Ozonloch.
Die globale Umweltbelastung hängt somit vom Gesamtausstoß der entsprechenden Schadstoffe ab, also der Summe der Schadstoffausstöße der einzelnen Länder. Die globale Umweltqualität wird von allen Ländern gemeinsam produziert und kein Land kann sich ihr entziehen. Der einzelne Emittent eines globalen Schadstoffs verursacht einerseits einen internen Effekt, indem er seine eigene Umweltqualität verschlechtert und damit Schäden tragen muss. Andererseits produziert er jedoch einen externen Effekt, indem er die Umweltqualität aller anderen Länder senkt. Er ist somit »Verursacher und Betroffener globaler Umweltveränderungen«.355 Da die gemeinsam hergestellte Umweltqualität von allen Ländern in derselben Weise konsumiert wird, ist sie als öffentliches Gut anzusehen.356 Nun ist die Betrachtung von Problemen öffentlicher Güter in der Ökonomie alles andere als neu,357 und in der Umweltökonomie werden Allokationsprobleme, die sich aus der Öffentlichkeit des Gutes Umwelt ergeben, seit langem behandelt. Die hier entwickelten (im Zweiten und Dritten Teil dieses Buches vorgestellten) Internalisierungsstrategien und pragmatischen umweltpolitischen Instrumente sind weitgehend auf globale Umweltprobleme übertragbar. Diese zeichnen sich jedoch durch zusätzliche Spezifika aus, die eine besondere Behandlung erfordern und auf Modifikationen des traditionellen Ansatzes führen. Insbesondere nehmen wir beim traditionellen Ansatz (meist implizit) an, es existiere eine zentrale staatliche Instanz, die Umweltpolitik definiert und durchsetzt. Dem Staat wird zugetraut, willens und in der Lage zu sein, diese Aufgabe auch dann zu erfüllen, wenn sie die Situation einzelner Entscheidungsträger (insbesondere der Emittenten) verschlechtert.
Diese Annahme ist nichts Besonderes, wenn man die Analyse in der Tradition der wohlfahrtsökonomischen Theorie durchführt, in der der Staat unabhängig vom in Rede stehenden Politikbereich die Rolle des Wahrers des Gemeinwohls spielt. Anders stellt sich die Sache aus der Perspektive der Neuen Politischen Ökonomie (vgl. z. B. Grüner 2008, Hahn 2009, Kirchgässner/Schneider 2003, Kollmann/Schneider 2010, Mueller 2009) dar: Sieht man den Staat nicht als eine von der Gesellschaft abgehobene Instanz, sondern als im Gestrüpp von Interessengegensätzen verfangenen und seine Eigeninteressen verfolgenden Akteur, so erscheinen die Annahmen der Wohlfahrtstheorie schon auf den nationalen Rahmen angewendet etwas lebensfremd.358 Im Zusammenhang mit internationalen Umweltproblemen ist die wohlfahrtsökonomische Konstruktion eines übergeordneten Akteurs, der hier das aggregierte Weltwohl maximieren müsste, (für die positive Analyse) überhaupt nicht mehr aufrecht zu erhalten. Wir müssen vielmehr der Tatsache Rechnung tragen, dass Maßnahmen zum Schutz der internationalen Umwelt zwischen souveränen Staaten vereinbart werden müssen. Selbst wenn wir jedem einzelnen Staat zutrauen, er wolle die nationale Wohlfahrt maximieren, besteht ein erhebliches Koordinationsproblem, wenn die Umweltbelastung die nationalen Grenzen überschreitet. Viele Umweltprobleme sind durch die Struktur des »Gefangenendilemmas« charakterisiert (Näheres in Abschnitt B.I.3., unten). Dies ist dadurch gekennzeichnet, dass eine gemeinsame Anstrengung aller Staaten zum Schutz der internationalen (extrem: globalen) Umweltressourcen zwar im gemeinsamen Interesse aller läge, für den einzelnen Staat jedoch Anreize bestehen, sich als Trittbrettfahrer zu verhalten. Der einzelne Staat ist versucht, einem entsprechenden Abkommen womöglich gar nicht erst beizutreten oder es nach seinem Beitritt nicht oder nur unvollkommen einzuhalten. Diese schwerwiegenden Probleme bei der Realisierung von an sich weltweit wohlfahrtssteigernden kooperativen umweltpolitischen Maßnahmen werden in der internationalen Umweltökonomie mit Hilfe spieltheoretischer Modelle untersucht.359 Wir gehen darauf in den folgenden Abschnitten näher ein. Dabei geht es auch um die Frage, wie Anreizsysteme konstruiert werden können, die die Kooperationsneigung der Staaten verbessern.
Die Spieltheorie ist eine wissenschaftliche Methode, mit der das Verhalten von Akteuren in interdependenten Entscheidungssituationen untersucht wird: Die Wirkung einer Entscheidung des A auf seinen Nutzen hängt nicht nur von dieser Entscheidung ab, sondern auch von der Entscheidung des B. Für den B gilt dasselbe entsprechend. Wie wird sich der Akteur entscheiden, wenn er sich dieser Interdependenz bewusst ist und überdies davon ausgeht, dass auch sein Gegenüber die Interdependenz kennt und seinerseits bei der Entscheidung berücksichtigt? Wie kann das Zusammenspiel der Akteure durch die Setzung von Rahmenbedingungen so geregelt werden, dass die individuellen Entscheidungen zu sozial optimalen Ergebnissen führen?
Die Spieltheorie, deren Wesen mit den obigen Bemerkungen natürlich nur in groben Strichen skizziert werden konnte,360 hat im Hauptstrom der Umweltökonomie (dessen Darstellung den Schwerpunkt dieses Buches ausmacht) kaum eine Rolle gespielt. Dies liegt daran, dass Umweltbelastung und Umweltpolitik nicht auf der Grundlage einer Interaktions- und Kooperationstheorie gedeutet wurden, sondern auf der Grundlage einer (auch noch besonders einfachen) Regulierungstheorie. Danach hat der Staat die Aufgabe, das Geschehen in Wirtschaft und Gesellschaft nach dem Prinzip der Gemeinwohlmaximierung zu ordnen. Er stellt dabei fest, dass der Marktmechanismus Umweltgüter fehlerhaft alloziert (»Marktversagen bei externen Effekten«). Der Staat definiert nun umweltpolitische Instrumente, mit denen er den Defekt des Marktmechanismus repariert und damit Widersprüche zwischen Marktgeschehen und Gemeinwohlzielsetzung beseitigt. Zur Umsetzung dieses Programmes fehlt es dem Staat weder an Interesse noch an Information oder an Macht.
Bei dieser Konstruktion besteht für die Leistungen der Spieltheorie wenig Nachfrage: Es geht ja nicht um das Zusammenspiel symmetrischer Akteure, sondern darum, dass der Staat als »Herr des Verfahrens« seine Position zum Wohle der Gemeinschaft klug einsetzt. (Was »klug« sei und wie diese Klugheit dem Design umweltpolitischer Instrumente dienstbar gemacht werden könne, haben wir in den ersten vier Teilen dieses Buches im Geiste der traditionellen Umweltökonomie erörtert.)
Nicht nur im Verhältnis zwischen Staat als Regulator und den Emittenten als Regulierungsobjekten bietet die Sicht der traditionellen Umweltökonomie wenig Raum für »strategische Interaktionen« der Beteiligten (die im Zentrum des spieltheoretischen Interesses stehen). Dies gilt ebenso für das Verhältnis der beteiligten Firmen untereinander. Die Emittenten werden in den einfachen umweltökonomischen Modellen entweder als Anbieter bei vollständiger Konkurrenz oder als Monopolisten dargestellt. Beiden Marktformen ist die Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen einzelnen Akteuren fremd: Bei vollständiger Konkurrenz ist ein einzelner Anbieter ein »Atom im Ozean«. Seine Aktivitäten sind für die Gesamtheit seiner Konkurrenten nicht fühlbar. Daher werden die Konkurrenten auch nicht auf das reagieren, was der betrachtete Anbieter tut. Entsprechend braucht der betrachtete Anbieter bei der Planung seiner Aktivitäten eine Reaktion der anderen auch nicht einzukalkulieren. Noch einfacher ist die Sache beim Emittenten, der Monopolist auf seinem Gütermarkt ist: Er braucht sich nicht um Reaktionen seiner Konkurrenten scheren, weil es keine Konkurrenten gibt.361
Das beliebteste Anwendungsgebiet der Spieltheorie im Bereich der Mikroökonomik ist die Industrieökonomie. Hier geht es zunächst einmal um das Verhalten der Firmen im Oligopol. Diese Marktform ist durch die Interdependenz der Entscheidungen zwischen den Anbietern geradezu definiert. Außerdem werden Interdependenzen zwischen Staat und Firmen bei Regulierungsproblemen mit asymmetrischer Information untersucht.362 Diese Probleme spielten bei der obigen Darstellung allerdings keine Rolle. Allenfalls am Rande wurden Interdependenzen zwischen einzelnen Entscheidungsträgern und d...