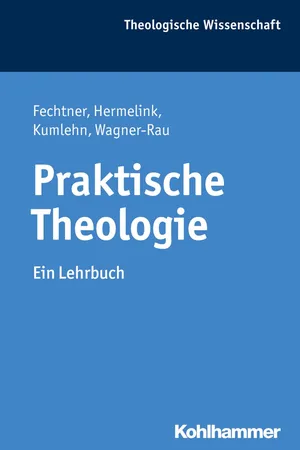
- 289 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Über dieses Buch
This textbook presents in compact form what one needs to know today in the field of practical theology. It can accompany university courses and can be used to prepare for examinations. It is also useful for further education for ministers and priests. The book starts with four brief survey articles on the prerequisites for contemporary practical theological thinking. The central fields of Christian practice are then developed in a problem-oriented fashion, in each case based on the following structure: marking out current challenges, orientation in the field of action, empirical findings, historical and systematic reference points, basic practical and theological provisions, current debates and issues for the future.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Praktische Theologie von Kristian Fechtner,Jan Hermelink,Martina Kumlehn,Ulrike Wagner-Rau, Traugott Jähnichen, Adolf Martin Ritter, Udo Rüterswörden, Ulrich Schwab, Loren T. Stuckenbruck, Traugott Jähnichen,Adolf Martin Ritter,Udo Rüterswörden,Ulrich Schwab,Loren T. Stuckenbruck im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Theology & Religion & Theology. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
II. Handlungsfelder
II.1 Kasualien
1 Herausforderungen
Taufe, Konfirmation, Trauung und Bestattung sind gottesdienstliche Ereignisse und familiäre Feiern, die auf biographische Anlässe bezogen sind. Für viele Menschen, auch für ansonsten kirchlich Distanzierte, sind die Kasualien von besonderer Bedeutung, weil die christliche Tradition hier Relevanz für die individuelle Lebensgeschichte gewinnt. Zugleich ist jedoch die Kasualpraxis gegenwärtig eines der konfliktreichsten Felder kirchlichen Lebens, auf dem vielfältige Auseinandersetzungen zwischen kirchlichen Vorgaben und persönlichen Wünschen der Beteiligten auftreten. Dies betrifft z. B. die Fragen, warum Taufpatinnen der Kirchen angehören müssen, an welchen Orten eine kirchliche Trauung stattfinden kann oder wie eine Bestattungsfeier musikalisch gestaltet werden soll. In den Disputen schwingt mit, dass Kasualien in unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen werden, die ihre Deutung bestimmen: Ist die Taufe ein kirchlicher Ritus oder eine Familienangelegenheit, ist die Konfirmation ein gemeindliches Ereignis oder ein Mündigkeitsakt in der Biographie eines Heranwachsenden, ist die Bestattung ein öffentlich gestalteter Abschied oder eine Ausdrucksform privater Trauer? Weil in der Spätmoderne das Traditionsprinzip in allen Lebensbereichen schwächer wird, lässt sich auch innerhalb der kirchlichen Kasualkultur eine stärkere Subjektivierung beobachten, in der das individuell Besondere betont wird. So ist in die eine Richtung zu fragen, welche verbindliche kirchliche Form Kasualhandlungen heute haben können und sollen; und ebenso in die Gegenrichtung, worin ihre Möglichkeiten liegen, auf die Bedürfnisse der Beteiligten hin individualisiert zu werden.
Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, sein Kind taufen zu lassen oder kirchlich zu heiraten; aufs Ganze gesehen gewinnt die Teilhabe an den Kasualien mehr und mehr den Charakter einer Entscheidung. Der sukzessive Umbruch korrespondiert damit, dass die Kirche ihr Ritenmonopol verloren hat, sie bewegt sich mittlerweile in einem Feld von Konkurrenzen: Standesamtliche Eheschließungen werden zusehends zum Hochzeitsritual ausgestaltet, »weltliche« Bestattungsfeiern haben sich gesellschaftlich etabliert, in Ostdeutschland ist die säkulare Jugendweihe auch nach dem Ende der DDR der Normalfall geblieben. Dass sich die Praxis über die Kirche hinaus erweitert und ausdifferenziert, zeugt davon, dass sich die Lebensorientierungen pluralisiert haben, man kann biographische Übergänge heute rituell auch nichtkirchlich gestalten. Dabei fällt jedoch auf, dass die säkularen Äquivalente Elemente der christlichen Kasualtradition übernehmen und sich nicht selten an die liturgischen Dramaturgien der kirchlichen Kasualien anlehnen: Ringwechsel und Trauversprechen können bereits auf dem Standesamt erfolgen und die meisten weltlichen Bestattungsfeiern lehnen sich in ihrer Schrittfolge an das kirchliche Begräbnis an.1 In dieser Konstellation hat das kirchliche Kasualhandeln einen doppelten Status: Einerseits wird es zu einem Angebot unter anderen, es erscheint als eine rituelle »Dienstleistung«, ohne es dem eigenen Selbstverständnis nach in einem marktförmigen Sinn sein zu wollen und zu können. Die kirchlichen Kasualien haben andererseits eine kulturelle Prägekraft für die Art und Weise, wie lebensgeschichtliche Übergänge rituell gestaltet werden, und der Kirche wird gesellschaftlich eine besondere Zuständigkeit in diesem Feld zugeschrieben. Worin liegt das Spezifikum kirchlicher Kasualpraxis und wie erschließt sich der genuin christlich-religiöse Sinngehalt der Kasualien?
2 Orientierung im Handlungsfeld
Im Folgenden werden zunächst die klassischen Kasualien (1) skizziert, indem jede Kasualie in einem Dreischritt erschlossen wird: zuerst ihre lebensweltliche Veranlassung; anschließend die gottesdienstliche Feier und weitere, insbesondere seelsorgliche Aspekte; dann im jeweiligen Schlussabschnitt gegenwärtige Veränderungen. Die Reihung der Kasualien folgt nicht der Chronologie des Lebenslaufes, sondern setzt mit der Bestattung ein, die kulturell die größte Reichweite hat, thematisiert im Anschluss daran Taufe und Konfirmation und stellt die kirchliche Trauung, die auch innerkirchlich zunehmend optional wird, an den Schluss der Darstellung.
Sodann werden weitere Anlässe der Kasualpraxis (2) erörtert und zwar im Blick auf andere biographische Übergänge und auf Kasualgottesdienste im öffentlichen Leben sowie hinsichtlich der Rückwirkung kasueller Praxis auf das gottesdienstliche und kirchliche Leben insgesamt.
2.1 Die »klassischen« Kasualien im Lebenszyklus
2.1.1 Die kirchliche Bestattung
Es gehört zu den kulturellen Pflichten einer Gesellschaft, Verstorbene zu bestatten. Dies wird bis heute hierzulande auch rechtlich festgehalten. Als ein prägender Bestandteil der Abschieds- und Erinnerungskultur ist die Bestattung Ausdruck individueller und gemeinschaftlich geteilter Trauer. Die Art und Weise, wie Menschen beerdigt werden, zeugt immer auch davon, wie der Tod als Grenze des Lebens verstanden und die Beziehung der Lebenden zu den Toten gedeutet werden.2
Die Kirche gestaltet die Bestattung als gottesdienstliche Feier. Der gemeinschaftliche liturgische Akt zeugt davon, dass sie ein persönlicher Abschied von einer konkreten Person, aber keine Privatangelegenheit ist. Klassisch ist das kirchliche Bestattungshandeln als ein Drei-Stationen-Weg konzipiert: Er beginnt mit der Aussegnung am Sterbeort,3 seine Mitte bildet eine gottesdienstliche Trauerfeier in der Friedhofskapelle oder Kirche, er schließt mit der liturgisch gestalteten Grablegung oder Urnenbeisetzung. Je nach regionaler Tradition kann die zweite und dritte Station auch umgekehrt angeordnet sein. In den liturgischen Schritten bilden sich symbolisch drei wesentliche Aspekte des christlich qualifizierten Abschiedsrituals ab: Die Bestattung begeht erstens einen Übergang aus der Sphäre des Lebens in den Bereich des Todes. Unter dem Vorzeichen der Auferstehungsverheißung kommuniziert sie – im Blick auf den Verstorbenen wie im Blick auf die trauernde Gemeinde – zugleich einen Übergang vom Leben ins Leben. In der Bestattung wird ein liturgischer Weg gestaltet. Das zweite Kennzeichen ist somit das Weggeleit bis hin zur Ruhestätte des Verstorbenen. Es führt ihn zugleich aus der Gemeinschaft der Lebenden zur Gemeinschaft in Gott. Schließlich verdichtet sich das religiöse Leitmotiv einer kirchlichen Bestattung darin, dass die Tote fürbittend »in die Hände Gottes« gelegt wird: Der Ritus ist ein Akt der Übergabe. Die evangelische Trauerfeier lehnt sich in ihrem agendarischen Ablauf an die Grundstruktur eines Predigtgottesdienstes an. Die Trauerpredigt (► II.5) wird heute auf evangelischer Seite weithin als eine »biographische Bestattungsrede«4 gestaltet, in der das gelebte Leben im Horizont des christlichen Glaubens zur Sprache gebracht und in ein erinnertes Leben überführt wird. Die Predigt nimmt auf, was im pastoralen Trauergespräch mit den nächsten Angehörigen erinnert und mitgeteilt worden ist.
Mit diesem Gespräch und gegebenenfalls weiteren Trauergesprächen im Anschluss gewinnt das kirchliche Bestattungshandeln seine seelsorgliche Dimension im Trauerprozess (► II.6). In Fortführung von älteren Modellen, die den Prozess des Trauerns als eine lineare Abfolge von vier Phasen konzeptualisiert haben (Yorick Spiegel, Verena Kast), wird heute Trauerbegleitung aufgabenorientiert gedacht. Kerstin Lammer nennt sechs wesentliche Aufgaben:5 den Tod wahrnehmen und begreifen helfen (Realisation), Gefühlsreaktionen Raum geben (Initiation), Verlusterfahrungen identifizieren und anerkennen (Validation), Übergänge unterstützen und rituell begehen (Progression), zum Erinnern und Erzählen ermutigen (Rekonstruktion), Risiken abschätzen und Ressourcen im sozialen Umfeld aktivieren (Evaluation). Auch die Bestattungsfeier selbst und die sozialen Praktiken, die sich mit ihr verbinden, lassen sich in diesem Aufgabenfeld verorten.
Die gegenwärtige Bestattungskultur ist durch tiefgreifende Veränderungen und Umbrüche gekennzeichnet: Die Bestattungsformen und -orte haben sich vervielfältigt. Nachdem sich neben der traditionellen Erdbestattung in den vergangenen Jahrzehnten die Einäscherung etabliert hat, verändert sich die liturgische Dramaturgie der Bestattung, insbesondere das Verhältnis des Trauergottesdienstes zur Urnenbeisetzung, die häufig aus der öffentlichen Feier ausgegliedert wird. Mit der Kremation wird die Bestattung von der körperlichen Existenz der verstorbenen Person gelöst, so dass die Asche nicht nur in einem Grab, sondern auch in einem gemeinschaftlichen Rasenfeld oder in einem Friedwald beigesetzt oder seebestattet werden kann. Viele der neuen Orte und Formen betonen in einer technisierten Welt die naturhafte Dimension des Todes. Weiterhin lässt sich beobachten, dass sich die gegenwärtige Bestattungskultur tendenziell individualisiert. Zunehmend werden Traueranzeigen und gelegentlich auch Grabinschriften sehr persönlich formuliert, Musikwünsche für die Trauerfeier sind mit der Person des Verstorbenen verbunden. Mit der Individualisierung geht einher, dass die Abschiedspraxis sich mehr und mehr privatisiert. Dies wird durch die neuen Bestattungsgesetze begünstigt, die zum Teil die bislang gültige Bestattungspflicht auf öffentlichen Ruhestätten aufheben. Hinzu kommt, dass Verstorbene – mit oder ohne Trauerfeier – heute nicht selten anonymisiert beigesetzt werden. Die Veränderungen zeigen in sich widersprüchliche Tendenzen: Einerseits wächst das Bedürfnis nach persönlichen Formen des Abschieds, andererseits wird die soziale und individuelle Verpflichtung schwächer, für die Bestattung in bisher kulturell und kirchlich verbürgten Formen Sorge zu tragen.
2.1.2 Die Taufe
Als den christlichen Kirchen gemeinsamer Ritus ist die Taufe ein unveräußerliches Kennzeichen des Christseins. Einmal vollzogen bleibt sie gültig und wird nicht wiederholt. Die Kindertaufe ist als traditionelle Säuglingstaufe mit dem Ereignis der Geburt verbunden und bewegt sich als Kasualie in deren Erfahrungsfeld. In der Kindertaufpraxis als einem konstitutiven Element des volkskirchlichen Christentums wird die Kirchenzugehörigkeit an die jeweils nächste Generation weitergegeben. In der Gegenwartskultur hat die Taufe, anders als die übrigen Kasualien, kein säkulares Äquivalent.
Die Feier der Taufe findet als ritueller Akt innerhalb des sonntäglichen Gemeindegottesdienstes oder in einem eigenständigen Taufgottesdienst statt. Sie hat ihre Mitte in der Taufhandlung mit Wasser in Verbindung mit der trinitarischen Taufformel. Liturgisch gehören weiterhin dazu, die biblische Beauftragung zu verlesen, gemeinsam das Glaubensbekenntnis zu sprechen, ein Segenswort und die Fürbitte. Auf evangelischer Seite hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die Praxis etabliert, einen biblischen Taufspruch persönlich zuzusprechen. Es sind vor allem drei Sinngehalte des Taufgeschehens, die als religiöse Motive heute Resonanz finden: In der Taufe als Aufnahme in die christliche Gemeinschaft wird eine geistliche Zugehörigkeit konstituiert, die alle sozialen Beziehungen umgreift. Im Taufakt, der ihn als Person mit dem Namen Gottes verbindet, wird der Täufling in seiner individuellen Identität angenommen und sie wird ihm zugesprochen. In der Taufe empfängt ein Täufling die Verheißung einer gnädigen Zuwendung Gottes, in der das menschliche Leben in den ambivalenten Erfahrungen einer bedrohlichen Welt in Obhut genommen wird.
Zur Kindertaufe gehören nach den kirchlichen Lebensordnungen Patinnen. Das Patenamt verbindet kirchliche Beauftragung und familiäre Ausübung; es ist, nicht immer konfliktfrei, an die Mitgliedschaft in der christlichen Kirche geknüpft. Paten verpflichten sich, an der christlichen Erziehung mitzuwirken, sie sind Bezugspersonen im familiären Kontext. Im liturgischen Geschehen fungieren sie als Zeugen. Zum christlichen Glauben gehört, sich zu erinnern, getauft zu sein; dies geschieht nicht nur individuell, sondern auch in besonderen Tauferinnerungsgottesdiensten oder zu anderen Anlässen.
In jüngerer Zeit ist erstens zu beobachten, dass sich das Taufalter verändert. Taufen finden immer häufiger nicht mehr im Umfeld der Geburt statt, sondern im Kleinkindalter oder zu einem späteren Zeitpunkt. Eltern haben heute verstärkt das Anliegen, nicht nur für, sondern auch mit dem Kind zu entscheiden. Dabei hat sich der ältere theologische Streit von Kinder- vs. Erwachsenentaufe weithin beruhigt, weil sie nicht mehr als Alternativen, sondern eher als Varianten begriffen werden, die sich lebensgeschichtlich begründen und unterschiedliche Aspekte der Taufe betonen. Zweitens lockert sich, wenn auch keineswegs ohne kontroverse Diskussion, die strikte Verortung der Taufe im Sonntagmorgengottesdienst, die selbst erst jüngeren Datums ist. Wo eigenständige Taufgottesdienste gefeiert werden, sind diese stärker auf den familiären Kontext bezogen und die Familie wird zur gottesdienstlichen Gemeinde. Neu entstanden sind regionale Tauffeste, in denen die Tauffeier nicht mehr parochial gebunden ist und auch an anderen Orten als im Kirchengebäude stattfinden kann. Kirchentheoretisch verändert sich damit das Verhältnis von Taufe, Gemeinde und Familie.6
2.1.3 Die Konfirmation
Mit der Konfirmation hat sich eine Jugendkasualie etabliert, welche die Heranwachsenden in die...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Impressum
- Zur Einführung
- I. Querschnittsthemen
- II. Handlungsfelder
- Die Autorinnen und Autoren