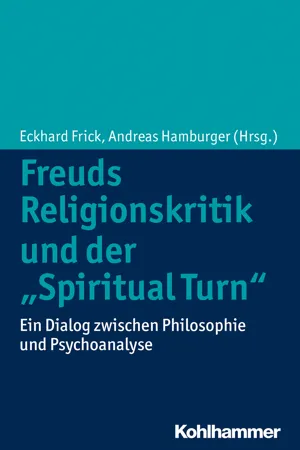![]()
Religionskritik und Religionsersatz
In Ihren Beiträgen umkreisen Aleida und Jan Assmann das Religionsphänomen von zwei sehr unterschiedlichen Polen aus: Der Ägyptologe und Kulturtheoretiker Jan Assmann erläutert seine Lesart von Freuds Mosesroman als Großmetapher und mythische Begründung des Fortschritts der (rationalen) Geistigkeit, während die Anglistin und Theoretikerin des kollektiven Erinnerns Aleida Assmann die zeitgenössische Praxis der ›Familienaufstellung‹ als Neuauflage der Ahnenbeschwörung liest – eine Darstellung, die in der Diskussion vor allem bei den klinisch Psychoanalytikern heftigen Widerspruch hervorruft.
![]()
Zwangsneurose oder Fortschritt in der Geistigkeit. Zu Freuds Religionskritik
Jan Assmann
Monotheismus als Zwangsneurose
In seinem letzten großen Buch Der Mann Moses und die monotheistische Religion1, an dem Freud fünf Jahre, zwischen 1934 und 1939, gearbeitet hat, diagnostiziert er den Monotheismus als eine kollektive Zwangsneurose und entwirft damit die Grundlagen einer psychohistorischen Religionstheorie, die an Kühnheit und Perspektivenreichtum kaum zu überbieten ist. Religion erscheint hier als ein in erster Linie seelisches, genauer gesagt: seelenarchäologisches Phänomen, eine in der menschlichen Seele von unvordenklichen Zeiten her angelegte phylogenetisch erworbene und vererbte Grundausstattung. Freud nennt sie »die archaische Erbschaft« oder den Ödipus-Komplex, eine durch das Leben in der Urhorde erworbene und durch das Schicksal des Aufwachsens in der Kleinfamilie unausweichlich reaktivierte, potentiell pathogene Anlage, die zwar in jeder Religion in Form ritueller Zwangshandlungen wirksam, aber in der monotheistischen (d. h. jüdischen) Religion auf eine unendlich verstärkte und charakteristischere Weise ausgeprägt ist. Die Urhordentheorie hatte Freud schon 1913 in seinem Buch Totem und Tabu entwickelt. Es handelt sich um einen heuristischen Mythos, den Freud aus Ansätzen von Darwin, Frazer und W. St. Smith synthetisiert hat. In der Urhorde lebten die Menschen in Großfamilien; das stärkste Männchen, der »Urvater«, beanspruchte alle Weibchen der Horde für sich und bedrohte seine Söhne mit Kastration oder Verstoßung, falls sie sich den Weibchen zu nähern versuchten. Zuletzt aber wurde der tyrannische Urvater vom stärksten seiner Söhne erschlagen, der dann dieselbe Stellung für sich beanspruchte – und das gleiche Spiel begann von neuem. Das zog sich über die Jahrtausende hin und hinterließ in der menschlichen Seele unauslöschliche Spuren. Bis dann dem vatermörderischen System ein Ende gemacht und der erschlagene Urvater als Totemtier des Clans zum Gegenstand einer religiösen Verehrung wurde, die den Charakter einer Deckerinnerung hatte und das grausige Geschehen ins Unbewusste verdrängte. Aus dem Totemismus entwickelte sich der Polytheismus, der den wahren Kern der Religion noch stärker verhüllte, bis er dann im Monotheismus wieder stärker hervortrat – mit entsprechend pathogenen Konsequenzen. Ein heuristischer Mythos hat den Status einer Konstruktion, die zum legitimen Instrumentarium der Psychoanalyse gehört. Seine Wahrheit liegt nicht in seiner paläoanthropologischen Beweisbarkeit, sondern in seiner Erklärungskraft in Bezug, nicht auf die Vergangenheit, sondern die Gegenwart, d. h. die Erkrankung und ihre Symptome, die es zu behandeln und nach Möglichkeit zu heilen gilt. Mit dieser Genealogie erklärt Freud die zentrale Stellung, die die Motive von Schuld und Versöhnung in allen Religionen einnehmen. Alle sind von einem diffusen Schuldgefühl beherrscht, in allen geht es darum, durch Opfer und teilweise grausame und schmerzhafte Riten die Götterwelt zu versöhnen. Das erklärt sich durch den Ursprung der Religion aus dem Vatermord.
In seinem neuen Buch, Der Mann Moses, überträgt Freud nun dasselbe Modell auf die Entstehung, nicht der Religion schlechthin, sondern speziell des biblischen Monotheismus, der ja in der Tat in der Religionsgeschichte etwas ganz Neues und eine geradezu weltverändernde Revolution darstellt. Dafür kann er natürlich nicht auf eine mythische, wissenschaftlicher Forschung unzugängliche Urzeit zurückgreifen, sondern muss seine Konstruktion im hellen Licht einer durch zahlreiche archäologische, epigraphische und philologische Quellen bezeugten Geschichte errichten. Freud wählt dafür die Zeit des ägyptischen Ketzerkönigs Echnaton, der die polytheistische ägyptische Religion abschaffte und an deren Stelle den ausschließlichen und in diesem Sinne monotheistischen Kult des neuen Licht- und Sonnengottes Aton setzte. Das ist für Freud die Geburtsstunde des Monotheismus. In Ägypten blieb das aber eine kurzlebige Episode, denn nach dem Tod Echnatons kehrte man zur alten Religion zurück und merzte alle Spuren der monotheistischen Ketzerei aus. Moses2 aber, den Freud zu einem Ägypter und einem hochgestellten Gefolgsmann des Echnaton macht, entzieht sich der Verfolgung, schließt sich den im Delta siedelnden Hebräern an und wandert mit ihnen nach Palästina aus, um mit ihnen den monotheistischen Gedanken zu retten.
Nun aber kommt es zu dem entscheidenden Ereignis, in dem sich der Mord am Urvater wiederholt und nun nicht mehr allgemein die menschliche, sondern speziell die jüdische Seele ihre bis heute wirksame Prägung erfährt. Genau dies war nämlich Freuds Ausgangsfrage gewesen. »Wir wollten erklären«, schreibt er zusammenfassend, »woher der eigentümliche Charakter des jüdischen Volkes rührt, der wahrscheinlich seine Erhaltung bis auf den heutigen Tag ermöglicht hat«3. Moses, der den Israeliten die monotheistische Botschaft gebracht hatte, wurde von ihnen erschlagen, weil sie die Abstraktheit des unsichtbaren Gottes und die Schärfe seiner moralischen Forderungen nicht länger ertrugen. Damit wiederholten sie unbewusst den Vatermord in der Urhorde und wurden Opfer einer Retraumatisierung, die man sich entweder als eine Art Tätertrauma vorzustellen hat oder als ein mitleidendes Opfertrauma, nach Art der Jünger Jesu, die den grausamen Tod ihres Meisters miterleben mussten (Türcke, 2009). Auch dieser hatte der Welt eine Botschaft gebracht, die sie nicht annehmen und ertragen konnte. Freud zieht diese Parallele nicht, aber dafür der Alttestamentler Ernst Sellin, der in einem 1922 erschienenen Buch die These vom Mord an Mose aufgestellt hatte.4 Sellin zufolge knüpft sich an diese Tat die Überlieferung vom leidenden und für die Sünden des Volkes sterbenden Gottesknecht, die sich bei den Propheten und vor allem in den Gottesknechtliedern bei Deuterojesaja findet und in deren Tradition sich Jesus verstanden hat.5 Für Sellin stiftet der hypothetische Mord an Mose kein seelisches Trauma, sondern eine dichte prophetische Tradition und ein biographisches Muster. Sellin geht davon aus, dass sowohl die Lehre des Mose als auch das Wissen um seinen Tod nur »das Besitztum eines kleinen Kreises« gewesen ist.
»Von vornherein dürfen wir nicht erwarten, (dieses Wissen) in dem offiziellen Kulte, in dem Glauben des Volkes anzutreffen. Wir können von vornherein nur damit rechnen, daß bald hie bald da einmal ein Funke wieder auftaucht von dem Geistesbrande, den er einst entzündet hat, daß seine Ideen nicht ganz ausgestorben, sondern hie und da auf Sitte und Glauben eingewirkt haben, bis sie etwa früher oder später unter der Einwirkung besonderer Erlebnisse oder von seinem Geiste besonders erfasster Persönlichkeiten einmal wieder stärker hervorbrachen und Einfluss gewannen auf breite Volksmassen« (Sellin 1922: 52 f.).
Freud macht sich nicht nur Sellins Mord-These sondern auch seine Vorstellung einer marginalisierten Überlieferung zu eigen. Freuds Moses war als Ägypter und Anhänger der monotheistischen Atonreligion nicht allein; eine mächtige Gruppe von Ägyptern – die Leviten, die nach Ex. 32 als eine Art Leibgarde und Lagerpolizei fungierten – war mit ihm zu den Juden übergegangen und aus Ägypten ausgezogen. Diese Gruppe hat dafür gesorgt, dass der monotheistische Gedanke nicht vollkommen verloren ging und mit den Juden, die sich einem primitiven Vulkangott namens Jahwe angeschlossen hatten, einen Kompromiss ausgehandelt, der diesem Jahwe einige entscheidende Züge des ägyptischen, von Mose noch weiter sublimierten Aton einschrieb. Zwar starb das lebendige, wir würden heute sagen, das »kommunikative« Gedächtnis dieser Gruppe an Mose und seine Lehre nach zwei bis drei Generationen aus, aber
»Aus dem jüdischen Volk erhoben sich immer wieder Männer, die die verblassende Tradition auffrischten, die Mahnungen und Anforderungen Moses’ erneuerten und nicht rasteten, ehe das Verlorene wiederhergestellt war. In der stetigen Bemühung von Jahrhunderten und endlich durch zwei große Reformen, die eine vor, die andere nach dem babylonischen Exil, vollzog sich die Verwandlung des Volksgottes Jahve in den Gott, dessen Verehrung Moses den Juden aufgedrängt hatte« (Freud 1939/2010: 137).
»Die Moses-Religion war aber nicht spurlos untergegangen, eine Art Erinnerung an sie hatte sich erhalten, verdunkelt und entstellt, vielleicht bei einzelnen Mitgliedern der Priesterkaste durch alte Aufzeichnungen gestützt. Und diese Tradition einer großen Vergangenheit war es, die aus dem Hintergrunde gleichsam zu wirken fortfuhr, allmählich immer mehr Macht über die Geister gewann und es endlich erreichte, den Gott Jahve in den Gott Moses’ zu verwandeln und die vor langen Jahrhunderten eingesetzte und dann verlassene Religion Moses’ wieder zum Leben zu erwecken« (Freud 1939/2010: 152).
Das ist Sellins These einer zunächst marginalisierten, dann aber machtvoll hervorbrechenden Tradition, die Freud aber nur versuchsweise durchspielt, um sie schließlich zu verwerfen:
»Kann man einem solchen Wissen von Wenigen die Macht zuschreiben, die Massen so nachhaltig zu ergreifen, wenn es zu ihrer Kenntnis kommt? Es sieht doch eher so aus als müßte auch in der unwissenden Masse etwas vorhanden sein, was dem Wissen der Wenigen irgendwie verwandt ist und ihm entgegenkommt, wenn es geäußert wird« (Freud 1939/2010: 117).
Das Volk hatte die Botschaft, die ihm die Propheten vorhielten, nicht vergessen, sondern nur verdrängt, das heißt: im Grunde immer gewusst. Ohne diese Annahme wäre die Resonanz der prophetischen Botschaft nicht zu erklären:
»Eine Tradition, die nur auf Mitteilungen gegründet wäre, könnte nicht den Zwangscharakter erzeugen, der den religiösen Phänomenen zukommt. Sie würde angehört, beurteilt, eventuell abgewiesen werden wie jede andere Nachricht von außen, erreichte nie das Privileg der Befreiung vom Zwang des logischen Denkens. Sie muss erst das Schicksal der Verdrängung, den Zustand des Verweilens im Unbewussten durchgemacht haben, ehe sie bei ihrer Wiederkehr so mächtige Wirkungen entfalten, die Massen in ihren Bann zwingen kann, wie wir es an der religiösen Tradition mit Erstaunen und bisher ohne Verständnis gesehen haben« (Freud 1939/2010: 126).
Freud geht es in Der Mann Moses nicht nur um die Frage, wie sich die Erinnerung an Mose über die Jahrhunderte der Abwendung von seiner Lehre hat erhalten können. Die Frage, um die es ihm eigentlich geht, betrifft nicht nur die Bewahrung, sondern die Dynamik des Wissens um Moses und seine Lehre, ihre überwältigende Durchsetzungskraft. Was Freud erklären wollte, war der Zwangscharakter der monotheistischen Religion, worunter er immer die jüdische Religion versteht, und die damit zusammenhängende Jahrtausende überdauernde Persistenz des Judentums. Diese erklärt sich ihm nach dem gleichen Modell phylogenetischer Übertragung, das er auch seiner Theorie einer individuellen neurotischen Erkrankung zugrunde legt:
»Wenn wir die Reaktionen auf die frühen Traumen studieren, sind wir oft genug überrascht zu finden, dass sie sich nicht strenge an das wirklich selbst Erlebte halten, sondern sich in einer Weise von ihm entfernen, die weit besser zum Vorbild eines phylogenetischen Erlebnisses passt und ganz allgemein nur durch dessen Einfluss erklärt werden kann. Das Verhalten des neurotischen Kindes zu seinen Eltern im Ödipus- und Kastrationskomplex ist überreich an solchen Reaktionen, die individuell ungerechtfertigt erscheinen und erst phylogenetisch, durch das Beziehen auf das Erleben früherer Geschlechter, begreiflich werden« (Freud 1939/2010: 123).
Die Neurose entsteht also nach Freud durch das Zusammenspiel von ontogenetischem Erleben und phylogenetischem Gedächtnis, der archaischen Erbschaft aus der Urhorde, die daher, in Freuds Worten, »nicht nur Dispositionen, sondern auch Inhalte umfasst, Erinnerungsspuren an das Erleben früherer Generationen. Damit wären Umfang wie Bedeutung der archaischen Erbschaft in bedeutungsvoller Weise gesteigert« (Freud 1939/2010: 124), denn:
»Wenn wir den Fortbestand solcher Erinnerungsspuren in der archaischen Erbschaft annehmen, haben wir die Kluft zwischen Individual- und Massenpsychologie überbrückt, können die Völker behandeln wie den einzelnen Neurotiker« (Freud 1939/2010: 125).
Noch einmal erinnert uns Freud nachdrücklich daran, dass wir uns hier nicht in einer religionsgeschichtlichen Untersuchung, sondern in einer therapeutischen Behandlung befinden. Es geht um die Behandlung eines Volkes nach dem Modell der Behandlung einer individuellen Neurose:
»Frühes Trauma – Abwehr – Latenz – Ausbruch der neurotischen Erkrankung – teilweise Wiederkehr des Verdrängten: so lautete die Formel, die wir für die Entwicklung einer Neurose aufgestellt haben. Der Leser wird nun eingeladen, den Schritt zur Annahme zu machen, daß im Leben der Menschenart Ähnliches vorgefallen ist wie in dem der Individuen. Also daß es auch hier Vorgänge gegeben hat sexuell-aggressiven Inhalts, die bleibende Folgen hinterlassen haben aber meist abgewehrt, vergessen wurden, später, nach langer Latenz zur Wirkung gekommen sind und Phänomene, den Symptomen ähnlich in Aufbau und Tendenz, geschaffen haben« (Freud 1939/2010: 101).
Soweit ist das die schon in Totem und Tabu vertretene These. Jetzt aber geht Freud einen Schritt weiter und setzt an die Stelle des frühen Traumas den Mord an Mose, um die weitere Geschichte des biblischen Monotheismus nach dem Schema von Abwehr – Latenz – Ausbruch der neurotischen Erkrankung und teilweiser Wiederkehr des Verdrängten erklären zu können. Wieder greift er wie im Fall von Totem und Tabu zum Mittel einer Konstruktion:
»Es wäre der Mühe wert, zu verstehen, wie es kam, daß die monotheistische Idee gerade auf das jüdische Volk einen so tiefen Eindruck machen und von ihm so zähe festgehalten werden konnte. Das Schicksal hatte dem jüdischen Volk die Großtat und Untat der Urzeit, die Vatertötung, näher gerückt, indem es dasselbe veranlasste, sie an der Person des Moses, einer hervorragenden Vatergestalt, zu wiederholen. Es war ein Fall von ›Agieren‹ anstatt zu erinnern, wie er sich so häufig während der analytischen Arbeit am Neurotiker ereignet« (Freud 1939/2010: 111 f.).
Freud braucht diese Konstruktion, um die anschließende Latenzphase erklären zu können. Diese Latenz nun ist für Freud alles andere als eine Konstruktion, sie ist in seinen Augen eine unbestreitbare historische Tatsache und sein eigentlicher Trumpf, den er immer wieder ausspielt. Er versteht darunter ...