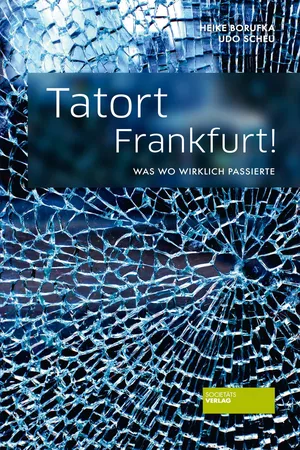Dr. Schneider oder die
Kunst, Milliarden zu
erschwindeln
(Königstein)
30. Juni 1997, Verhandlungstag 1
Plötzlich ist er da. Kaum jemand hat gesehen, wie er den Gerichtssaal betreten hat. Fünf Dutzend Journalisten sind gerade hinausgestürmt, weil die drei Verteidiger vor dem Eingang des Gerichtsgebäudes ein kurzes, improvisiertes Interview geben. Atemlos hetzen sie auf die Empore des Gerichtssaals 165C hoch und schauen nach unten. Dort steht er leibhaftig: Dr. Utz Jürgen Schneider, 63 Jahre alt, der Mann, der fünf Milliarden Mark Schulden gemacht hat. Das Sakko sieht nach feinem Tuch aus, ein Doppelreiher im Kamelhaarton. Dazu eine dunkelblaue Krawatte, schräg gestreift. Das goldene Brillengestell funkelt im Blitzlicht der Fotografen.
Seine drei Verteidiger stehen um ihren prominenten Mandanten herum: Christoph Rückel aus München, Franz Salditt aus Neuwied, Eckart Hild aus Frankfurt. Besitzergreifend legt Salditt seinem Schützling die Hand auf die Schulter. Jetzt betritt der zweite Angeklagte den Saal: Karl-Heinrich K. Er ist zwei Jahre älter als Schneider, eine Art Faktotum, übernommen aus der Pleite gegangenen Baufirma von Jürgen Schneiders Vater. Er hat Aktentasche und Regenschirm in der Hand, die auberginefarbene Jacke ist ersichtlich nicht maßgeschneidert. Schneider und K. drücken sich lange die Hand. Dann nimmt K. mit vergrämtem Gesicht dort Platz, wo sein Platz immer war – in der zweiten Reihe, hinter Schneider. K. sitzt hier, weil er auf Anweisung seines Chefs Bauzeichnungen gefälscht haben soll, mit deren Hilfe Schneider dann überhöhte Kredite beantragen konnte.
Der Prozess der Prozesse beginnt. Gegen den Mann, der die Elite des deutschen Bankgewerbes narrte: Deutsche Bank, ihre Kölner Tochter Centralbodenkredit, die Dresdner Bank, die Bayerische Hypo-Bank, die Berliner Hypotheken- und Pfandbriefbank und mehr als 50 weitere. Ohne Scharmützel, ohne Befangenheitsanträge, ohne Besetzungsrügen, ohne Tricks und Kniffe beginnt die Hauptverhandlung an diesem Tag.
Fünf Minuten, nachdem die 29. Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Frankfurt unter dem Vorsitz von Heinrich Gehrke den Saal betreten hat, verliest Staatsanwalt Dieter Haike die Anklage. Das dauert weniger als 20 Minuten. Richter Gehrke versichert den beiden Angeklagten, das große öffentliche Interesse hindere das Gericht in keiner Weise an einem fairen Verfahren. Er sei „angetan“ von den Äußerungen der Verteidigung, sie sei nicht auf Konfrontation, sondern auf Kooperation bedacht. Die Verteidiger geben das Kompliment artig zurück. Eine Versammlung von Gentlemen.
Die Verteidiger haben eine Erklärung vorbereitet. Richter Gehrke muss das hinnehmen, auch wenn er mit mildem Tadel anmerkt, man befinde sich hier in Frankfurt und nicht in Amerika. Die Verteidigung trägt vor, was ihres Erachtens für den prominenten Angeklagten spricht: die hohe Mitwirkungsbereitschaft des Dr. Schneider – gut 400 Seiten umfasst das Vernehmungsprotokoll des Bundeskriminalamts, auf 734 Fragen habe er Rede und Antwort gestanden. Die „verzweifelte Defensive“, in der sich Schneider nach seiner Abreise im April 1994 befunden habe sei, vor allem und in erster Linie, die Verantwortung der Banken. Die explosionsartige Entwicklung der Gesamtverschuldung Schneiders, die allen Beteiligten bekannt sein musste, weil die Bundesbank vierteljährlich ihre „Evidenzmeldungen“ an die kreditgebenden Institute schickt. Das Wissen der Banken, dass die von Schneider erworbenen Objekte zum größten Teil erst im Bau waren und dass deshalb der Kreditgewährung „eine gewaltige spekulative Tendenz“ innewohnen musste. Zudem das Wissen darum, dass die von Schneider als „Sicherheiten“ angebotenen Festgelder sich zum größten Teil aus neuen Krediten speisten. Ohne Weiteres hätten die Banken erkennen können, dass der Vermögenszuwachs, den Schneider in jährlichen Aufstellungen glaubhaft machen wollte, auf Planungen und Hoffnungen beruhte, sagt Salditt. Diesen „objektiven Sachverhalt“ gelte es zuvörderst aufzuklären. Daran werde Dr. Schneider nach Kräften mitwirken.
Wenn jedoch die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten Schneider an die persönliche Würde gehe, dann werde der Prozess zum Kampf. „Wir fordern Achtung vor unserem Mandanten, der sein Scheitern zu ertragen gelernt hat“, sagt Salditt pathetisch. Staatsanwalt Haike zitiert zum Einstand aus einer persönlichen Notiz Schneiders aus dem Jahre 1984. Dort heißt es: „Handwerker bescheißen und für die Banken alles optimal hochlügen.“
Dann hat Dr. Utz Jürgen Schneider das Wort. 30 Seiten vorbereiteter Text. Er spricht von der „Zerschlagung meines Unternehmens“. Er spricht von seiner Vision, ganze Quartiere aufzukaufen, um „Einfluss auf die Entwicklung innerstädtischer Lebensräume zu nehmen“. Von der „Dynamik der Projekte“, die ihn völlig beherrscht habe. „Ich bekenne, dass ich zu meinen Objekten noch immer ein emotionales Verhältnis habe, mit einer ganzen Portion Stolz“, sagt er. Und diese lächerlichen Dokumente, die er den Banken vorlegte, um weit überhöhte Kaufpreise etwa des Kurfürstenecks in Berlin zu suggerieren? Mit grandioser Nonchalance, geradezu beiläufig, legt Schneider sein Geständnis ab: „Ich legte die Kopie einer Scheinrechnung vor. Dass dieses fadenscheinige Dokument akzeptiert wurde, konnte ich mir nur mit einer entsprechenden Geschäftspolitik erklären.“ Dann sagt er: „Ich wollte 365 Millionen. Die Bank wusste, dass das Objekt kurz zuvor für 131 Millionen gekauft worden war. Ich fertigte einen Vermerk von drei Sätzen, dass zusätzlich zum Kaufpreis fünf weitere Interessenten mit 160 Millionen abgefunden werden mussten. Der Vermerk war eine Fiktion.“ Er habe sich im stillen Einvernehmen mit den Banken geglaubt. Um Zukunft sei es ihm gegangen, immer nur um Zukunft. Wie sollte er ahnen, dass die Banken, knochentrocken und fantasielos, seine Visionen als Beschreibung des aktuellen Zustandes auffassten?
3. Juli 1997, Verhandlungstag 2
„Im Vordergrund steht meine eigene Verantwortung“, lässt Jürgen Schneider die Richter wissen. Und erklärt weiter: Zu den in der Anklageschrift aufgeführten Vorwürfen des Betrugs, Kreditbetrugs und der Urkundenfälschung in fünf Fällen habe er sich „differenziert geäußert“. Die Mitverantwortung der Banken sei das Ergebnis seiner persönlichen Schlussfolgerung, „freilich auf der Basis einer Reihe von Indizien“.
Die Zusammenarbeit mit den Geldinstituten fasst er in einem Satz zusammen: „Das Bild, das ich früher von den Banken hatte, hat sich im Laufe der Zeit tief greifend verändert.“ Beim Leipziger Zentralmessepalast sei er sich mit dem zuständigen Mitarbeiter der Bauboden-Bank über „den Charakter der Scheinrechnung“ über 29 Millionen Mark einig gewesen. Unstreitig sei gewesen, dass der Wert der Immobilie den Kredit rechtfertigen würde. Der Bauboden-Vorstand habe gewusst, dass er, Schneider, „mit Strohmännern“ arbeite, um Liquidität zu ziehen.
Zur Leipziger Mädlerpassage, wo Schneider laut Anklage einen Schaden von 32 Millionen Mark angerichtet hat, sagt er: „Es ist nicht zutreffend, dass die Grundschuld zur Absicherung dieses Geschäfts wertlos gewesen ist.“ Die Angaben zu den Grundrissflächen bezeichnet er als nach wie vor richtig. Seine Finanziers bei diesem Objekt, die Bauboden- und die BHF-Bank, seien bei Abschluss des Kreditvertrags und Auszahlung ausreichend abgesichert gewesen.
Und auch über die Frankfurter Zeilgalerie redet er. Ja, sagt Schneider, es sei falsch gewesen, das erwartete Mietaufkommen auf eine Fläche von 20.513 statt tatsächlich 9.000 Quadratmeter zu beziehen. Die Mietprognose wurde so verdoppelt. Aber: „Das war mir willkommen.“ Über den Unterschied bei den Flächen und den Verkaufswert des Objektes hätten sich die Experten der Deutschen Bank aber jederzeit informieren können. Schon auf dem Bauschild, das monatelang vor der Tür auf der Zeil stand, hätten sie die richtige Zahl nachlesen können. Seine Angaben zu den Mietansätzen – pro anno 57 Millionen Mark – hätten sich „grotesk von den Realitäten jener Zeit“ abgehoben. Die Mieterlisten waren gefälscht. Kreditbewilligung und -auszahlung seien am selben Tag über die Bühne gegangen.
Auch beim Berliner Kurfürsteneck räumt er Manipulationen ein. Da war er mit der Dresdner Bank im Geschäft. Das Vorspiegeln einer Abfindungszahlung über 160 Millionen Mark an andere Interessenten habe aber bei den Bankkontakten keine Rolle gespielt. Dann schweigt Jürgen Schneider. Und bittet darum, dies zu akzeptieren. Keine Fragen, keine Vorhaltungen.
Bauzeichner Karl-Heinrich K. redet dafür. Und erzählt, er habe auf Anweisung seines Chefs Unterlagen geändert. Aber: „Das hätte jeder andere auch gemacht“, sagt er. Die Frage von Richter Heinrich Gehrke, ob er in blindem Vertrauen zu Schneider gehandelt habe, bejaht K. „Dr. Schneider konnte alle Bedenken immer zerstreuen.“ K. wird Beihilfe zum Betrug vorgeworfen.
8. Juli 1997, Verhandlungstag 3
Eigentlich erwarten die Prozessbeobachter einen ruhigen Verhandlungstag. Doch weit gefehlt. Zunächst sitzen vor Prozessbeginn Schneiders Ehefrau Claudia und Tochter Ysabel samt Fahrer in der ersten Zuschauerreihe. Zum ersten Mal. Getrennt durch eine schusssichere Glasscheibe. Dann kommt Jürgen Schneider. Und freut sich über seine Familie. Die darf im Saal bleiben, obwohl beide Frauen mögliche Zeugen sind. Richter Gehrke lässt im Protokoll vermerken: „Ehefrau und Tochter haben dem Gericht gegenüber schriftlich erklärt, dass sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen werden.“ Schneiders Fahrer wird nicht als Zeuge gebraucht.
Dann kommt der zweite Knaller. Richter Gehrke redet. Zunächst harmlos von einem Zwischenresümee, das er nach zwei Tagen ziehen wolle. Dann aber sehr deutlich. Die Erwartungen, die Schneider mit seinen Ankündigungen geweckt habe und die auch die Staatsanwaltschaft zufriedenstellen sollten, habe er bei Weitem nicht erfüllt. Zu allgemein, pauschal und unverbindlich, teilweise sogar nebulös sei die Erklärung gewesen. Nichts Konkretes. „Das ist keine erhebliche Aufklärungshilfe und trägt nicht zur Abkürzung des Verfahrens bei“, sagt der Richter. Und fordert: „Butter muss bei die Fische“. Er nennt eine Fülle ungeklärter Fragen. Zum Beispiel zu Schneiders einstigen Renommierobjekten, wie eben die Frankfurter Zeilgalerie oder die Mädlerpassage in Leipzig. „Wer hat gefälscht? Sind Unterlagen bewusst gefälscht worden? Geben Sie zu, in Täuschungsabsicht gehandelt zu haben?“ Gehrke schimpft, er habe bisher eindeutige Bekenntnisse vermisst. Er wolle mehr Hinweise zu den angeblichen Scheinfirmen Schneiders. Gehrke will Unterschrift für Unterschrift, Beleg für Beleg durchgehen. Doch das lassen die Verteidiger nicht zu. „Die schwierige Aufgabe der Verhandlungsführung haben Sie und nicht wir“, sagt Christoph Rückel. Und Salditt ergänzt: Die Erklärung Schneiders sei gerade kein Geständnis gewesen, das für sich alleine eine Urteilsgrundlage bilden könne. „Dieser Prozess braucht Entwicklung und Flexibilität, wir sind bereit, mitzugehen.“
Gehrke fragt Schneider: „Wie sollen Hintergründe aufgeklärt werden, wenn die Vordergründe nicht aufgedeckt sind?“
9. Juli 1997, Verhandlungstag 4
Schneider schweigt. „Der Vorsitzende hat kräftig an den Stäben unseres Schweigekäfigs gerüttelt. Doch unser Käfig hält“, sagt Verteidiger Franz Salditt. Und macht Hoffnung, in ein paar Monaten rede der Angeklagte vielleicht doch wieder. Jetzt aber nicht.
BKA-Kommissar Georg R. ist der erste Zeuge in einem der größten deutschen Wirtschaftsprozesse überhaupt. Er erzählt: „Als Jürgen Schneider vor gut einem Jahr von der Frankfurter Staatsanwaltschaft und dem Bundeskriminalamt drei Monate lang vernommen wurde, ging es des Öfteren richtig zur Sache“. Gebrüllt habe er. Schneider sei ein „besonders harter Brocken“ gewesen. Immer nur ausweichende Antworten auf konkrete Vorhalte. 300 Fragen habe ihm der Polizist gestellt. Auf etwa 500 eng bedruckten Seiten fänden sich die Antworten.
Richter Gehrke liest einen Eintrag aus dem Terminkalender der Schneider-Tochter vor: „Gefängnis – Gefahr – Mietverträge“, steht dort. Der Angeklagte schweigt dazu. Auch Tochter Ysabel hinter der Glasscheibe zeigt keine Regung. Und so bleibt es beim Verdacht, die Familie habe wohl doch gelegentlich über die gefährliche Taktik des Angeklagten gesprochen, Milliarden zu scheffeln.
16. Juli 1997, Verhandlungstag 5
Auch Vorlesestunden in einem Strafprozess können Spaß machen. Pikante Schriftstücke, meist verfasst von Bankiers aus dem Reich der Deutschen Bank, lesen die Richter vor. Die meisten Beobachter reiben sich vor Verwunderung die Augen. Nur Schneiders Gattin Claudia und Tochter Ysabel, die wieder im Zuschauerraum sitzen, wippen scheinbar unberührt weiter mit ihren Füßen.
Noch Mitte 1992, also nicht einmal zwei Jahre vor der Flucht Schneiders, erging sich eine Führungskraft der Baden-Badener Filiale der Deutschen Bank in einem Brief an die Zentrale in Lobeshymnen auf den späteren Pleitier und Milliardenbetrüger. Schneider verfüge über die „kompetenteste, fähigste und schlagkräftigste Immobilien-Gruppe“ in Deutschland, und dies sowohl in technischer als auch in kaufmännischer Hinsicht. In den Bewertungen der Objekte steckten „erhebliche Reserven“. Mit diesen Werten sei man „auf der absolut sicheren Seite“. Zufrieden attestierte der Bankier dem Immobilienspekulanten ein „exzellentes Gespür“ für das Marktgeschehen und konstatierte eine „nahezu unglaubliche Entwicklung des Vermögens“. Er empfiehlt: „Wir sollten uns voll zu dem Kunden bekennen.“
Schneider-Anwalt Salditt spricht von einer „euphorischen Engagement-Darstellung“ der Bank. Dass manches bei Schneider unglaublich war, weiß mittlerweile jeder. Damals schien es niemand zu bemerken. So soll sich ein Mieter in der Frankfurter Zeilgalerie laut Schneider vertraglich verpflichtet haben, 942.000 Mark Miete pro Monat zu berappen und eine Barkaution von fünf Millionen Mark zu leisten. Niemand fragte nach. Angesichts dieser Summen erscheint es fast logisch, dass in dem Mietkontrakt eine Pflicht zur Geheimhaltung verankert wurde.
Und noch einen Brief liest der Vorsitzende vor. Er stammt vom 4. April 1994. Er war der Auslöser für den größten Zusammenbruch eines Immobilienunternehmens in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Denn als der Brief des Dr. Jürgen Schneider drei Tage später Ulrich W., Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG, erreichte, reagierte das Bankunternehmen sofort. Mit Strafanzeigen und Konkursanträgen. Schneider schien zu diesem Zeitpunkt jeden Bezug zur Realität verloren zu haben. Er schrieb: „Aufgrund der von mir nicht zu beeinflussenden schleichenden Entwicklung am Immobilienmarkt und der Tatsache, dass man doch in einem Boot sitzt, beantrage ich die Stundung aller Zinszahlungen auf zwei Jahre, ein sofortiges Überbrückungsdarlehen von 80 Millionen Mark und die Verhinderung übereilter Maßnahmen kleiner Banken.“ Und Schneider jammerte: „Die Verhaltensweisen der Banken haben sich dahingehend verändert, als sie aufgrund ungeprüfter Gerüchte Informationen anfordern, die bis in die Privatsphäre reichen. Einige kleine Banken verlangen plötzlich ohne jede stichhaltige Begründung Zusatzversicherungen.“ Gekrönt wurde das Schreiben dann von dem unzumutbaren Interesse der Presse an Schneider und seiner Frau. Deshalb, teilte Schneider Bank-Vorstand W. mit, hätten die Ärzte geraten, jeden Stress zu vermeiden und verboten, seinen Aufenthaltsort mitzuteilen. Da war Schneider bereits auf dem Weg nach Miami, zusammen mit seiner Frau und einem Taschengeld von 245 Millionen Mark.
22. Juli 1997, Verhandlungstag 6
Besaß die Zeilgalerie in Frankfurt tatsächlich eine Hauptnutzfläche von knapp 10.000 Quadratmetern oder von mehr als 20.000 Quadratmetern? Hätte es der Deutschen Centralboden AG in Köln auffallen müssen, dass das Gebäude gar nicht 20.000 Quadratmeter vermietbare Fläche haben konnte? Der Architekt der Zeilgalerie, Professor Rüdiger K., sagt dazu als Zeuge: Bei den Vorentwürfen zur Planung der Zeilgalerie, die er Jürgen Schneider Anfang 1989 vorgelegt habe und die an die Banken weitergereicht worden seien, habe es sich deutlich erkennbar um Skizzen, nicht aber um fertige Baupläne gehandelt.
Schneiders Mitarbeiter und jetziger Mitangeklagter K. habe auf dem Vorentwurf drei Eintragungen mit Tippex gelöscht. Die Banken sollten den Eindruck haben, sie hielten Pläne in den Händen. Und so wurden aus einer vermietbaren Fläche von 9.842 Quadratmetern auch mehr als 20.000. Experten merken so etwas. Normalerweise.
Dann kommt Gerhard W. zu Wort, seit 1988 der Vorstandsvorsitzende der CIP AG. Das war die Immobilienverwaltungstochter im Schneider-Imperium. Etliche Aufstellungen über die abgeschlossenen Mietverträge, sagt er, seien zwar mit seinem Namen versehen worden, stammten aber nicht von ihm. Die Unterschriften waren gefälscht.
23. Juli 1997, Verhandlungstag 7
Der erste Bankgutachter sagt aus. Der Frankfurter Sachverständige Werner N. erzählt, er habe den Wert der Zeilgalerie aufgrund von Unterlagen errechnet. Die hatte er von der Deutschen Bank erhalten. An deren Echtheit habe er nicht gezweifelt, weil er seine Partner für „ehrbare Leute“ gehalten habe. Den von ihm errechneten Wert begründet N. mit dem „außergewöhnlichen Konzept“ für die Ladengalerie. Mit Schneider oder dem Repräsentanten der Bank, Friedrich M., habe es vorher keine Absprachen gegeben. Woher kamen die Flächenangaben, will der Richter wissen. Aus den Architektenplänen, sagt der Zeuge.
29. Juli 1997, Verhandlungstag 8
Ruth G. war Schneiders Sekretärin. Ob alle 70 gefälschten Mietverträge von den Mitarbeitern hergestellt wurden oder von Schneider selbst? Oder vielleicht von seiner Familie, will Richter Gehrke wissen. Und bringt die Zeugin ins Schleudern. Da bricht Schneider, ganz Gentleman, sein Schweigegelübde und hilft. „Ich habe Frau G. die Anweisung erteilt. Auch wurden alle Listen mit den Mietverträgen bei mir im Büro geschrieben“, sagt er, steht auf und läuft mit Unterlagen in der Hand zum Richtertisch. Er habe sie angewiesen, die aus der Luft gegriffenen Mietverträge anzufertigen. Die Zeugin sagt: „Was Dr. Schneider angeordnet hat, wurde ohne Nachfragen erledigt.“ Jedem sei klar gewesen, dass trotz seiner verbindlichen Art Nachfragen nicht erwünscht waren.
30. Juli 1997, Verhandlungstag 9
Zärtlich streicht Claudia Schneider-Granzow in den Prozesspausen im Gerichtssaal mit der Hand über das Revers am Zweireiher ihres Mannes. Dann küsst sie ihn. Tochter Ysabel steht eng daneben. Auch von ihr gibt es Küsschen. Alle drei lachen herzlich. Die Richter kommen rein, die Damen Schneider müssen gehen, zurück hinter die Glasscheibe in den Zuschauerraum.
Zeuge heute: der ehemalige Kreditvermittler der Deutschen Centralbodenkredit AG, Friedrich M. Rund 15 Millionen Mark habe er in den Jahren 1986 bis 1993 dank Schneider verdient. Dann allerdings hatte die Centralboden ihm den seit 1967 bestehenden Agenturvertrag fristlos gekündigt, weil M. sich zu sehr für Schneider engagiert habe. M. bestreitet, dass sein finanzielles Eigeninteresse die Kreditgewährung der Bank maßgeblich beeinflusst habe. Als ungeheuerlich bezeichnet er Schneiders Darstellung, auf seine Anweisung hin seien den Kreditanträgen unrealistische Ertragsschätzungen für die Frankfurter Zeilgalerie zugrunde gelegt worden.
Dass M. nur als Briefbote zwischen Schneider und der Bank fungierte, glauben ihm die Richter erkennbar nicht. „Sie haben doch die Bonität Jürgen Schneiders extrem hochgejubelt“, sagt Gehrke. M. bleibt ausweichend und ungenau.
6. August 1997, Verhandlungstag 10
Richter Gehrke zitiert aus einem Schreiben des Kreditvermittlers M. Darin lobt er das Engagement Schneiders und bezeichnet dessen Angaben zum Barvermögen Anfang 1994 als „absolut plausibel“ und „erstklassig“. Gehrkes Eindruck: „M. hat sich wohl eher als PR-Mann und Kreditbetreuer Schneiders ...