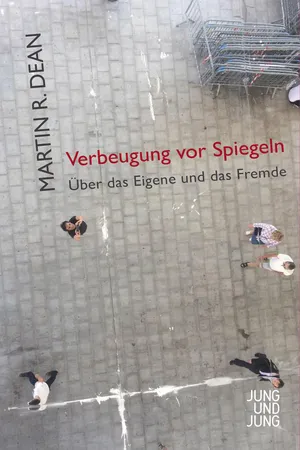
- 104 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Man könnte meinen, das Fremde sei allgegenwärtig. Jedenfalls gibt es kaum ein Thema, das von der Tagespolitik über die Medien bis zu den Stammtischen so heftig diskutiert wird, und immer geht es um die Fremden und um Abwehr, Regulierung und Integration. Martin R. Dean, als Sohn eines Vaters aus Trinidad in der Schweiz geboren, kennt die Debatte, vor allem aber kennt er die Erfahrung, die er in vielen seiner Romane fruchtbar gemacht hat. So auch in diesem Buch, in dem er das Fremde als radikale Erfahrungsmöglichkeit im Austausch unter Menschen beschreibt. In einer Art Selbstbegegnung sucht er nach Spuren der eigenen Verwandlung, wie sehr ihn das Fremde, die Begegnung mit dem anderen, auf Reisen, in der Literatur, zu dem gemacht hat, der er ist. Und er kommt zu einem überraschenden Schluss: Das Fremde, das eigentliche Kapital der Moderne, droht in den Prozessen der Globalisierung zu verschwinden. Um es wiederzugewinnen, müssen wir darauf bestehen, dass das Fremde fremd bleibt, wir müssen es aushalten. Und wir müssen vor allem »verlernen«, es uns verständlich machen zu wollen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Verbeugung vor Spiegeln von Martin R. Dean im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Deutsche Literaturkritik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
LiteraturFremdkörper und Körperresonanzen
Wenn der Körper fremdelt, wird er belauscht. Die Aufmerksamkeit fixiert sich auf gewisse Partien des Körpers, die zu schmerzen beginnen, der Verdacht fällt auf die Organe. Ist aber derjenige, der mit der ständigen Belauschung seines Körpers beschäftigt ist, wirklich krank oder nicht doch ein übler Simulant? Gerade der Schmerz, das Eigenste und Deutlichste des Körpers, wird in einem solchen Fall verdächtigt, bloße Einbildung zu sein.
In den Jahren des Übergangs vom Jugendalter zum Erwachsensein war ich oft kränkelnd, und oft war das Verhältnis zwischen mir und meinem Stiefvater das eines Patienten zu seinem Arzt. Ich wuchs im Gestöber von Krankheitsbegriffen auf; die Bresten der Leute aus dem Dorf kamen am Mittagstisch und am Feierabend zur Sprache. Mein Stiefvater war so sehr Arzt, dass er uns Kindern die Anatomie der Gelenke an Pouletschenkeln erklärte und sich den Appetit auch bei der Beschreibung zerfallender Körperteile nicht verdarb.
Bekannt wurde mir der Fall eines Studenten aus dem 18. Jahrhundert, der bei dem berühmten Mediziner Herman Boerhaave Vorlesungen besuchte. Sooft er ihnen beiwohnte, bildete er sich ein, selber die Krankheit zu haben, die dieser gerade verhandelte. Solcherart war er der lebende Kommentar von Boerhaaves Krankheitslehre, musste aber, nachdem er die Hälfte des medizinischen Kurses absolviert hatte, das Studium aufgeben, da er im äußersten Grad elend und abgezehrt war. Die Macht der Zeichen – in diesem Fall der gesprochene Text von Boerhaave – nahm vom Körper des Studenten Besitz. Während der Geist, das Bewusstsein des Studenten, alles Nötige über die Krankheiten aufnehmen wollte, um präventiv seinen und andere Körper davor zu bewahren, passierte hier das Umgekehrte: Der Leib unterlief den Geist und wollte selber der Text des Professors sein. Der heilende Text machte den Körper krank statt gesund.
Auch Thomas Mann war ein glühender Hypochonder. Am Dienstag, den 16. Februar 1954, notierte er Folgendes in sein Tagebuch: »Der Papst Pius war sehr krank, schwere Gastritis, Erschöpfung, Tage lang künstliche Ernährung, ernste Bulletins im »Corriere«, den wir nachmittags bekommen. Ich schrieb einen Brief der Teilnahme, des Gedenkens und der Bitte um Übermittlung an den Archivar u. Privatsekretär Padre Roberto Leiber. In dem Augenblick wurde ich selbst von Fieberfrost ergriffen, 39.3, Zittern und Zucken, Husten und Elend.«
Der Macht der Zeichen steht die Ohnmacht des Somatischen gegenüber. Geist, Vernunft, Ratio – die abendländische Kultur hat arbeitsteilig verschiedene Begriffe eingeführt, um das zu bezeichnen, was den bewusstlosen Körper lenkt. Aber was mit Begriffen beherrscht werden soll, entzieht sich immer wieder dem Begreifen, läuft aus dem Ruder und wird fremd. Der Versuch, mit Denken das somatische Andere zu unterwerfen, führt in die Rebellion oder in die Abspaltung.
Hypochondrie ist eine Krankheit, die paradoxerweise durch einen heilsamen Text ausgelöst werden kann. Aber welche Schmerzensäußerungen, welche Symptome zählen zur Hypochondrie? Muss man die Krankheiten, unter denen ein Hypochonder leidet, wie Blumen nach äußerlichen Merkmalen ordnen, um zu einem einheitlichen Ganzen zu kommen? Oder bildet die Hypochondrie nicht das vollkommene Wörterbuch aller möglichen Krankheiten?
Laut der Medizinhistorikerin Esther Fischer-Homberger hat die Hypochondrie eine lange Geschichte. Sie setzt bei Aretäus von Kappadokien als Krankheit ein, die aus den Hypochondrien kommt. In der Antike betrachtet man diese Hypochondrien auch als Entstehungsort einer anderen Krankheit, nämlich der Melancholie, einer verwandten Begleiterscheinung der Hypochondrie. Steigt die Galle hoch, entwickeln sich Blähungen und ein übles, nach Fischen stinkendes Aufstoßen tritt ein. Dazu gesellt sich »Muthlosigkeit, Angst vor dem Vergiftetwerden, Flucht in die Einsamkeit oder in den Aberglauben«. Noch beim bekanntesten Melancholieforscher, Robert Burton, ist die Hypochondrie eine Unterart der schwarzgalligen Melancholie.
Spekulativer wurde diese Symptomatologie im 17. Jahrhundert, als die Existenz einer schwarzen Galle nicht mehr als gesichert galt. Vom Somatischen wanderten die Ursachen der Hypochondrie immer mehr zu den nervlichen Störungen, so bei Thomas Willis, für den sie zu einer Krampfkrankheit wurde. Derart modernisiert erscheint die Hypochondrie im nervenverrückten 18. Jahrhundert: Sie wird nicht nur selbstständig, indem sie sich aus der undeutlichen Umarmung mit der Melancholie löst, sie wird geradezu eine Modekrankheit.
Da die Hypochondrie im Zeitalter der Aufklärung als noble Zivilisationskrankheit galt, gelang es den Engländern vor allen anderen, sie an sich zu reißen. Sie wird nachgerade zur »English malady«, auch »Morbus anglicus« genannt, und bestätigt auch den über Trends wie immer gut informierten Schweizer Jean-Jacques Rousseau in seiner festen Überzeugung, einen »Polypen im Herzen« zu haben. Grund genug für den Philosophen etlicher Herzensschriften, seine Geliebte Madame de Warens im Stich zu lassen und in Begleitung eines imaginären Reisegefährten, der natürlich Engländer ist, aufzubrechen. Gleichzeitig weiß Rousseau auch, wo die Wurzel allen, nicht nur seines Übels liegt: Die Hypochondrie ist eine Strafe für die Abwendung vom einfachen, natürlichen Leben. Vom »Missbrauch des Zucker und Backwerks, des Thee-, Cafee-, Schoccolade- und Brantweingetränkes«, schreibt der Bündner Arzt Johann Ulrich von Bilguer 1767. Auch modischen und zu engen Kleidern soll sich das Entstehen der Hypochondrie verdanken. Weitsichtig schreibt Johann Karl Wezel in seinem Sieg über die Hypochondrie: Personen, »die zu einem Studium gezwungen werden, wozu sie keine Anlagen… haben«, neigten zur Hypochondrie.« Diejenigen aber, die hypochondrisch sind, dürfen mit ihrer außerordentlichen Intelligenz renommieren, denn die Krankheit tritt sozusagen nur bei Leuten mit scharfem Verstand, rascher Auffassungsgabe und reger Vorstellungskraft auf. Letzteres deutet auf eine spezielle Disponiertheit von Intellektuellen und Schriftstellern hin. Denn auch die Einsamkeit ist für den schwärmerischen Dichter vonnöten, weswegen der Badener Arzt Johann Georg Zimmermann, der auch Schriftsteller war, schreibt: »Gefoltert unter einem immerwährenden Drucke, voll schmerzhafter und ängstlicher Empfindungen, kann ein Hypochondrist wahrlich nicht frölich seyn mit den Frölichen […]. Solches Leiden erreget […] den Trieb, alleine zu seyn, und sich vor den Menschen zu verbergen. […] ›Hier quälet mich niemand aus Höflichkeit, hier foltert mich kein Schwätzer, hier ärgert mich kein Bösewicht‹, kann sich der Hypochonder sagen.«
Im Jahrhundert des Spleens, der »Thränen« und des scharfen Verstandes kann so vieles Hypochondrie sein, dass Fischer-Homberger von einer »Verwahrlosungstendenz« des Begriffs spricht. Die Hypochondrie, urteilt Bilguer verärgert, ist ein »vollkommenes Wörterbuch aller möglichen Krankheiten«. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ist die Entschärfung des Begriffs so weit fortgeschritten, dass Manie, Melancholie und Hypochondrie kaum mehr als spezifische Krankheiten unterschieden werden können. Man kommt überein, nur noch eine Krankheit, eine einzige nosologische Einheit anzuerkennen: den Wahnsinn. Oder das, was auch bei Hölderlin, als er im Tübinger Turm lebte, diagnostiziert wurde: das Irresein.
Über die Spinalirritation und den Nervosismus löst sich die Hypochondrie langsam von ihren somatischen Ursachen ab und wird zu einem Nervenleiden, bis sie in der neu entdeckten Neurasthenie Unterschlupf findet. Schließlich geht sie im 19. Jahrhundert eine Allianz mit der Modekrankheit Hysterie ein, die allerdings durch ihr häufiges Auftreten selber einer Verwahrlosungstendenz anheimfällt. Ernest-Charles Lasègue stellt fest, dass Hypochondrie und Nosophobie, Angst vor der Krankheit, synonym geworden sind und dass die Hysterie den Papierkorb darstellt, in den die Mediziner all diejenigen Symptome werfen, die sie nicht anders einordnen können. Ende des Jahrhunderts kommt Sigmund Freud über die Hysterieforschungen Jean-Marie Charcots und Hippolyte Bernheims zu einer bis heute geläufigen Definition von Hypochondrie: »Der Hypochondrische zieht Interesse wie Libido […] von den Objekten der Außenwelt zurück und konzentriert beides auf das ihn beschäftigende Organ. […] Das uns bekannte Vorbild des schmerzhaft empfindlichen, irgendwie veränderten und doch nicht im gewöhnlichen Sinne kranken Organs ist das Genitale in seinen Erregungszuständen. Es wird dann blutdurchströmt, geschwellt, durchfeuchtet und der Sitz mannigfaltiger Sensationen.«
Laut Freud ist die Erogenität eine allgemeine Eigenschaft aller Organe, die somit prinzipiell an die Stelle des Genitale treten können. Der Hypochonder ist ein Selbstverliebter, dessen Libido in seinem Körper – im kranken Organ – gestaut wird. In der Ablösung von den Eltern macht der Hypochonder seinen Körper krank, um ihn sich gesundpflegen zu lassen.
Hypochondrie als Nosophobie ist für den Betroffenen eine aufwändige Strategie zur Verhinderung des Krankseins. Die zur totalen Risikovermeidung gesteigerte Wahrnehmung zieht ihre Aufmerksamkeit von der Außenwelt ab und konzentriert sich ganz auf den eigenen Leib. Der Patient erfindet sich einen Leib, der durch Störungs- und Schmerzsensationen auf sich aufmerksam macht. Empfindungen werden dabei zu Symptomen. So ordnet und organisiert der Hypochonder seine gesamte Umwelt nach seinen Strategien. Gegenstände werden ihrer Eigenschaften enthoben und allein danach beurteilt, ob sie der Gesundheit förderlich sind oder nicht. Der Hypochonder hat keine Wahl: Was immer er kauft, isst, trinkt, tut oder nicht tut, es bemisst sich nach seiner Gesundheitsrelevanz. Wenn man sich veranschaulicht, dass schon die Gesundheitsrelevanz eines Getränks nie ganz feststellbar ist, geschweige denn die von Hosen, Pullovern, Möbeln, Fensteraussichten, Sitzgelegenheiten et cetera, dann sieht man, welchen Abgründen entlang der Hypochonder tanzt. Er muss vollbringen, was uns heute schon längst nicht mehr gelingt: jedes Ding und jede Situation hinsichtlich ihres Gesundheitsrisikos zu reflektieren und zu beurteilen.
Im Mai 1904, in der frühlingshaften Villa Strohl-Fern in Rom sitzend, schreibt ein Hypochonder Folgendes an seine Freundin: »[…] wie im vorigen Frühjahr eine seltsame Art von Ungesundheit, Hinfälligkeit und Lebenstrübung mich ergriffen hatte, so wurde mir auch jetzt wieder alles schwer und bange. […] Jene merkwürdigen Unstätheiten im Gange meines Blutes […] traten wieder auf und verursachten mir Tage und Nächte, die unter den heftigsten Kopfschmerzen, Zahnschmerzen qualvoll langsam und nutzlos vergingen […]. In solchen Zeiten verlangt es mich so sehr nach einem wirklichen Arzt, dem ich einmal alle meine Nöte sagen könnte; ein solcher müsste, denke ich, die Geduld haben zuzuhören.«
In welcher Verlassenheit ist ein Leib, der nicht besprochen wird? In welcher Einsamkeit ein Körper ohne Worte? Um gesund zu sein, muss er ja horchen, gehorchen können. Horchen auf die Worte, die ihn zuerst einmal, am Anfang des Lebens, geformt haben: auf die Mutterworte. Aus denen im Laufe des Lebens auch Vaterworte, Freundesworte, Arztworte werden können. Der Leib des einen ist ein Ohr, das sich ständig dem Mund des anderen zuneigt. Worte wollen zu Körpern werden. Körperlose Worte sind nichts, nicht mehr als Schall und Rauch. Worte brauchen einen Resonanzkörper, Dichterworte das Leserohr, Arztworte den Patientenkörper. Diese Ursymbiose zwischen Wort und Körper, zwischen Sprechen, Flüstern, Singen und Besprochen-, Beflüstert- und Besungenwerden ist vielleicht der Ausgangspunkt aller Dichtung und Poesie.
Der Hypochonder, der sich nach einem Arzt sehnt, ist Rainer Maria Rilke. Er wird den Arzt nicht finden, wohl aber den Mund einer Freundin, ihre Worte, die so gut sind wie das gesprochene Therapeutenwort. Lou Andreas-Salomé, einstige Geliebte von Friedrich Nietzsche, dann Schülerin von Sigmund Freud, unternimmt die Fernanalyse des Patienten Rilke mit professionellem Sachverstand. Rilke, in Muzot lebend, macht 1925 eine »unerhörte« Krise durch: »Ich bin wie eine leere Stelle, ich bin nicht, ich bin nicht einmal identisch mit meiner Noth. […] Da mir das Sprechen wegen meiner Mundverhältnisse (die Störungen und die gewisse Phobie sind immer die gleichen) mühsam ist, kann ich nicht einmal laut Lesen, was mir sonst immer am Meisten zu mir hilft. Wie ich mit der Welt durch Aug und Geruch verkehre, so ist mein Selbstumgang zu einem grossen Theil aufs Mich-Hören gestellt.«
Mit prophetischer Präzision ahnt Rilke, warum ihm sein Körper nicht mehr ge-horcht. Jetzt, wo niemand ihn mehr besprechen kann, nicht einmal sein Dr. Haemmerli aus Valmont ist da, ruft er nach Lou. Sie schreibt ihm zurück: »Weißt du, lieber Rainer, was für ein Gefühl ich soeben beim Schreiben spüre? Wie bei einer Flasche, die, endlich stöpselfrei, alles herausstürzen müßte, sodass es in ihrem Hals gurgelt und blos Tropfen kommen.« D.h. sie wird, aus was für einer Stummheit auch immer, endlich zum Be-sprechen erlöst, was ja ebenso eine heilende Wirkung hat. Lou Andreas-Salomé fasst zusammen, was bereits Freud über die Genese der Hypochondrie schrieb: »[…] solche Hypochondrie ist auch als eine Art auf sich selbst zurückbezogene Verliebtheit bezüglich des betreffenden Organs aufzufassen, nur dass sie sich keineswegs so anfühlt, sondern als Unlust, Qual, fast Hass gegen den Leib […].« Allerdings spürt auch sie die geheime Allianz, die die Krankheit mit dem Kreativen eingegangen ist. Sie schreibt von der Gnade: »[…] der schöpferischen Abfuhr ins Werk, die eben drum dem Leiblichen so verflochten ist, denn von dort aus feuert auch sie erotisch an zum Leibhaften im Werksinn […]. Den Umkipp in das Arge, Verlassene, dem eigenen Leib Preisgegebene, erlebst Du nicht blos als Reaktion nach angespanntem Schaffen, es ist eher etwas schon dem Zugehöriges, die Kehrseite der Sache selbst […].«
Nicht nur in der Medizin, sondern auch in der Literatur kommt es zu einer Allianz zwischen Wort und Körper, zwischen kränkelnden Autoren und der Literatur als Gesundheitsunternehmen. »Krankheit ist wohl der letzte Grund / Des ganzen Schöpferdrangs gewesen; / Erschaffend konnte ich genesen, / Erschaffend wurde ich gesund«, schreibt Heinrich Heine. »Erotisch zum Leibhaften im Werksinn anfeuernd«, heißt es bei Lou Andreas-Salomé – in beiden Fällen ist die Krankheit eine notwendige Bedingung der Produktivität.
Für Thomas Mann gehörten die Anfälligkeiten wie selbstverständlich z...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Impressum
- Titel
- Die Gärten und die Städte
- Die Metropolen und das Rätsel der Sehnsucht
- Das Unbehagen in der Natur
- Fremdkörper und Körperresonanzen
- Der Schwindel der Fremdheit
- Allmähliches Verschwinden