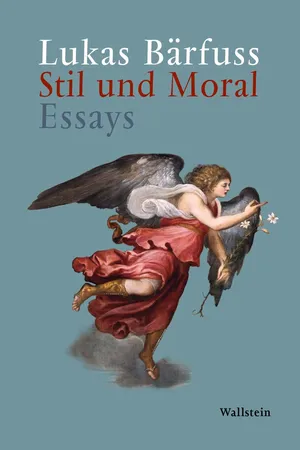![]()
III
![]()
Habeas Corpus
Das Gefühl, die Hoheit über seinen Körper zu verlieren, setzt bereits am Flughafen ein. Das ist nichts Neues. Als Reisender ist man die stufenweise Verwandlung in Frachtgut schließlich gewohnt: Man entledigt sich an der Sicherheitskontrolle der Effekten ebenso wie der Persönlichkeit. Aufgefangen wird die plötzliche Nacktheit von der militanten Freundlichkeit des Personals. Die Tatsache, die Reise mit dem größten Verkehrsflugzeug der Welt anzutreten, beschreibt nur eine graduelle Verschärfung. Kein Grund zur Beunruhigung also.
Denn worüber sollte man sich auch Sorgen machen? Relax and enjoy your flight. Die Maschine steigt ruhig auf elftausend Meter Reiseflughöhe, die Damen bringen Getränke, und nach dem zweiten Glas begreift man, dass man sie um alles bitten kann. Bloß anfassen sollte man sie nicht. Dafür gibt es den Bildschirm des Bordunterhaltungsprogramms. Er ist berührungsempfindlich und führt den Geist aus der Gegenwart in eine andere Welt. Hier findet der Reisende seine einzige Aufgabe: Er muss sich entscheiden, auf welche Art er seine Infantilisierung vollenden will. Will er lieber ein Quiz lösen, farbige Bälle davor bewahren, in ein schwarzes Loch zu fallen, oder doch mit Herkules seine zwölf Arbeiten in Angriff nehmen?
Dass man überhaupt fliegt, ist nicht auszumachen. Man braucht dazu die Computergrafik, die den Fortschritt der Reise begreifbar macht. Mit sechshundert Seelen an Bord steigt man gen Süden, kein Ruckeln, kein Flattern, keine Vibrationen, eine lange, stetige Bewegung. Nur gelegentlich unterbrochen von einem hässlichen Ruck, als würde sich das Flugzeug räuspern, so kurz, dass man nicht sicher ist, ob man es sich eingebildet hat.
Der Rest ist Eleganz, versinnbildlicht im Hutschleier der Flugbegleiterinnen. Ihre Anmut, ihre kühle Tüchtigkeit lässt den Reisenden unweigerlich plump erscheinen. Seine Körperfunktionen werden zu einer Peinlichkeit. Es wäre besser, man besäße überhaupt keinen Leib, der doch nur ein Hindernis ist. Man wäre jetzt bereit, sich Windeln anlegen zu lassen und eine Kanüle für die künstliche Ernährung. Inmitten der totalen Automatisierung wäre dies nur folgerichtig.
Nach der Landung verflüchtigt sich der letzte Rest Körpergefühl. Geblendet vom Glanz der Moderne schlurft man über die Marmorböden, die Gischt der stockwerkhohen Wasserfälle in der Abfertigungshalle des Flughafens von Dubai benetzt das Gesicht, aber sie erfrischt nicht. Die Straße, die einen ins benachbarte Emirat Abu Dhabi führt, hat acht Spuren. Gerade wie ein Zollstock führt sie hinaus in die Wüste, und wer das Vergnügen hat, sie nachts zu befahren, wird vom Schein Zehntausender Kandelaber erhellt, die im Abstand von zwanzig Meter Spalier stehen wie die Höflinge vor dem Thron eines unsichtbaren Gottes. Manchmal züngelt entfernt die Fackel einer Raffinerie in den schwarzen Himmel und man versteht: Ohne das Öl würde hier nichts länger bestehen als ein paar Tage.
Aber noch ist das schwarze Gold nicht versiegt. Noch stehen die Türme, es sind die höchsten der Welt. In einen davon legt man sich zur Ruhe. Die Tür schließt sich geräuschlos. Das Zimmer ist klimatisiert. Das Frühstück wie zu Hause. Es gibt keine Bedrohung.
Wenn aus dieser Welt ein Mensch verschwindet, einen, den man kennt und mag und mit dem man gewisse Dinge teilt, den Beruf und einige Freunde, vor allem aber die Einladung an die hiesige Buchmesse, dringt diese Tatsache nur langsam ins Bewusstsein. Natürlich bemerkt man sein Fehlen, aber da man sich selbst so weit abhandengekommen ist, fällt es schwer, ein Gefühl für die Abwesenheit eines andern zu entwickeln. Und wenn man schließlich die Empfindung wiedergefunden hat, hat man Mühe, sie in Worte zu fassen.
Man ist vielleicht zu einer Schiffsfahrt eingeladen, mit einer Gruppe anderer Reisender, die ebenso staunend auf dem Oberdeck kühle Getränke entgegennehmen, ebenso matt und körperblöd in der Hitze des Mittags hindämmern und der angekündigten Sensationen harren. Natürlich ist da diese Unruhe – aber die Skyline ist wirklich einzigartig. Warum sollte man sich nicht zuerst ein paar Bilder davon machen, bevor man eine unangenehme Frage stellt? Man kann hier über alles reden, bloß über jenen, der fehlt, sollte man besser schweigen. Denn als man seinen Namen erwähnt, wird einem vom Gastgeber bedeutet, das Thema zu wechseln. Der Verschwundene wird bald wieder hier sein. Ja, er wurde verhaftet, nein, man kennt zurzeit seinen Aufenthaltsort nicht, er wird auf irgendeiner Polizeistelle sein. Es kann sich nur um ein Missverständnis handeln. Es lohnt sich nicht, daraus eine große Sache zu machen. Und hat man nicht immer gesagt, erst das Unvorhergesehene gebe dem Leben die Würze? Also siehe da, die Delfine! Willst du dich nicht daran erfreuen, wie sie mit der Bugwelle spielen? Warum siehst du ihre Schönheit nicht? Und das Essen – sind da nicht sämtliche Leckereien des Orients versammelt? Woher also dein Missmut, bist du nicht einfach undankbar?
Wenn ein Mensch verschwindet, muss man ihn zuerst zurück ins Bewusstsein bringen. Man erfährt die Wahrheit der Redensart: Aus den Augen, aus dem Sinn. Man erfährt die Weisheit des Sinnspruchs: Les absents ont tort, die Abwesenden haben Unrecht.
Tatsächlich werden dem Verschwundenen bald Vorwürfe gemacht. Er hätte doch wissen müssen, dass man keine Botschaften fotografieren darf. Sein Leichtsinn war sträflich, oder wie es ein Mann vom Geheimdienst formuliert: Es gibt nichts Verdächtigeres als H...