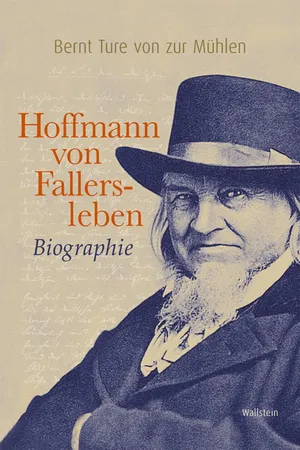![]()
1. Kindheit und Jugend, Studienjahre und frühe Anfänge
Kindheit und Jugend in Fallersleben
August Heinrich Hoffmann wurde am 2. April 1798 in Fallersleben geboren, einem kleinen Ort im Kurfürstentum und späteren Königreich Hannover. Der Vater Heinrich Wilhelm Hoffmann war Kaufmann und Gastwirt, später auch Bürgermeister der Gemeinde, in der um die Jahrhundertwende etwa 1.000 Einwohner lebten. Die Mutter Dorothea Eleonore Maria Hoffmann war eine geborene Balthasar und stammte aus dem benachbarten Wittingen. Unter den Vorfahren väterlicher- und mütterlicherseits finden sich häufig die Berufsbezeichnungen Kaufmann und Gastwirt. Die bodenständige Familie der Hoffmanns hat mehrfach den Bürgermeister von Fallersleben gestellt.1
Zehn Kinder hat Dorothea Hoffmann zwischen 1788 und 1803 zur Welt gebracht, sechs davon wurden entweder tot geboren oder starben noch vor oder kurz nach Erreichen des ersten Lebensjahres. Heinrich war das dritte der das Kindesalter überlebenden Kinder. Der ältere Bruder Daniel kam 1790 auf die Welt, die ältere Schwester Auguste wurde 1794 geboren, für die jüngere Schwester Dorothea Friederike wird 1800 als Geburtsjahr angegeben. Das Geburtshaus aller Kinder war ein stattliches Fachwerkhaus, es befand sich seit 1688 im Besitz der Familie und war eines der größten Häuser am Platz.
Die dominierende Gestalt in der Familie war der Vater. Er erfreute sich »eines hohen Ansehens, weil er sich vor niemandem fürchtete, und im Bewusstsein, nur das Rechte zu wollen, sich auch vor niemandem zu fürchten brauchte. Schon seine stattliche Gestalt, seine Körperstärke und Gewandtheit, mehr aber noch seine ganze Art und Weise, wie er auftrat, waren achtunggebietend.« Die imponierende Erscheinung des Vaters hat der Sohn in seinen Erinnerungen mehr als einmal ausführlich beschrieben. Der junge Heinrich hatte nicht nur die hochgewachsene Statur des Vaters geerbt und dessen dominantes Auftreten übernommen, sondern auch dessen Unbeugsamkeit und Starrsinn.
Die aufopferungsvoll für die Familie sorgende Mutter hat dagegen in seinem Leben keine große Rolle gespielt. Dorothea Hoffmann hat ihren Mann um mehr als zwanzig Jahre überlebt. Obwohl der Sohn anlässlich seiner ausführlich beschriebenen Besuche mehr als einmal die Gelegenheit gehabt hätte, ein seine Mutter charakterisierendes Lebensbild zu entwerfen, hat er es nicht getan. Sie bleibt immer die Frau im Hintergrund, unscharf und ohne hervorstechende Züge. Es war auch nicht die Mutter, sondern die Großmutter, die sich um das kranke und schwächelnde Kind gekümmert hat, das nicht nur alle Kinderkrankheiten durchmachte, sondern nach einer bösartigen Hauterkrankung sogar vorübergehend erblindet war. Der durch übergroße Fürsorge verzogene Junge leistete sich Eigenwilligkeiten bei Eßgewohnheiten und Kleiderwahl, ansonsten verlief die Kindheit ohne besondere Auffälligkeiten.
Im dörflich geprägten Fallersleben passten die Kinder ihre Spiele dem zyklischen Verlauf der Jahreszeiten an. Im Frühling hatte man seine Freude am Säen und Pflanzen im Garten und sammelte Schmetterlinge, im Sommer ging man in die umliegenden Wälder zum Beerenpflücken, im Herbst halfen die Kinder bei der Ernte, und die schneereichen Wintermonate boten Gelegenheit zu Schlittenfahrten und Spielen auf dem Eis. Schilderungen von Taubenzucht und Kaninchenhaltung, Volksfesten und öffentlichen Spielveranstaltungen vervollständigen die Erinnerungen an fast idyllische Kinderjahre, die auch nach dem Einmarsch fremder Soldaten und der Einquartierung wechselnder Besatzungsmächte ungetrübt verlaufen sind.
Die großen Ereignisse der Geschichte wälzten sich in diesen Jahren wie eine gewaltige Flutwelle über die deutschen Länder. Das Kurfürstentum Hannover wurde ab 1803 zum Spielball der Großmächte. Im kleinen Fallersleben erlebte man den Lauf der Geschichte mit dem Kommen und Gehen der Besatzungsmächte. Im Mai des Jahres 1803 marschierten die Franzosen in den kleinen Ort ein und blieben bis zum Herbst des folgenden Jahres. Eine Schwadron berittener Artillerie hatte in Fallersleben Standquartier genommen, die kleinen Jungen freuten sich über die bunten Uniformen und die roten Federbüsche auf den Helmen und spielten Soldat. Als die Franzosen abzogen und im Oktober 1804 die Preußen kamen, liefen die Kinder auf der Straße den preußischen Soldaten nach. Und sie liefen auch den Soldaten aus Schweden und Russland hinterher, als diese durch Fallerslebens Straßen marschierten. Im Jahr 1806 prangte im kleinen Ort auf den Landeshoheitspfählen der preußische Adler. Am Straßenrand winkten die Einwohner den in den Krieg ziehenden Truppen Preußens zu, wenig später begafften sie die versprengten Haufen und den langen Zug der Flüchtlinge. Jetzt erzählte man von verlorenen Schlachten der Preußen. Schon im November desselben Jahres verschwanden die preußischen Adler und machten den französischen Hoheitszeichen auf den Pfählen Platz. Auf dem Weihnachtsmarkt bestaunten die Bürger die zum Verkauf ausgestellten Bilderbogen. Auf einem war der Tod des Prinzen Louis von Preußen zu sehen, auf einem anderen feierte Kaiser Napoleon mit seinen Generälen den Sieg in der Schlacht von Jena und Auerstedt.
Hoffmanns Geburtshaus in Fallersleben um 1870
In Fallersleben ging alles seinen gewohnten Gang. Der kleine Heinrich Hoffmann hatte inzwischen die Bürgerschule besucht, ein großer Raum, in dem eine Vielzahl von Kindern verschiedener Altersstufen von einem einzigen Lehrer beaufsichtigt wurde, der ihnen Lesen und Schreiben beibringen sollte. Die wenigen bessergestellten Eltern, abgeschreckt von der Unfähigkeit des überforderten Lehrers, besorgten ihren Kindern einen Privatlehrer, der auch Naturkunde, Geographie und Französisch unterrichten musste. In seinen Erinnerungen kann sich Hoffmann für den Unterricht im Rechnen und für die Musik begeistern. Der dilettantische Nachbau von Musikinstrumenten aller Art beschäftigte ihn für längere Zeit, aber er wird niemals das Spielen auf einem Musikinstrument erlernen. Und erstaunlicherweise wird er auch später als erfolgreicher Dichter und Komponist von Kinderliedern nicht die Notenschrift beherrschen.
Vater Hoffmann blieb trotz wechselnden Besatzungsmächten im Amt des Bürgermeisters. Er konnte es sich leisten, die schulische Ausbildung seines Sohnes durch Privatunterricht zu ergänzen. Der Junge tat sich besonders hervor durch flüssiges Vortragen von Texten. An zwei Abenden in der Woche musste er den Stammgästen in der Wirtschaft die Zeitung vorlesen. Man hatte in Fallersleben den ›Hamburger Unparteiischen Correspondenten‹ abonniert, der sowohl über die große Politik als auch über die kleinen Tagesgeschehnisse informierte. An die patriotischen Kommentare des Bürgermeisters Hoffmann wird sich der Sohn noch nach Jahrzehnten erinnern. Die Niederlagen der Preußen gegen die Franzosen wurden als Niederlagen für alle Deutschen empfunden.
Während die Gäste in der Wirtschaft ihr Bier tranken und Zigarren rauchten, las der Elfjährige die Berichte aus dem ›Hamburger Unparteiischen Correspondenten‹ vor, Berichte über Napoleons Feldzüge nach Spanien im Jahr 1809 und die Kämpfe der Truppen des Rheinbundes an der Seite des französischen Kaisers. Bald darauf beherrschten die Kriege in Süddeutschland und der Aufstand in Hessen die Schlagzeilen. Jubel kam in der Gastwirtschaft auf bei den Meldungen über den Sieg in der Schlacht von Aspern, Verzweiflung und Wut nach Napoleons erneuten Siegen, dann Triumphgefühle, als der vom französischen Kaiser seines Landes beraubte Herzog Friedrich Wilhelm wieder in Braunschweig einzog.
Im Jahr 1810 wurde Hannover mit dem Königreich Westfalen vereinigt, an dessen Spitze Napoleons Bruder Jérôme als König herrschte. Jetzt gab es auch im beschaulichen Fallersleben große Veränderungen. Frankreich war Besatzungsmacht, der kleine Ort wurde zum selbständigen Canton im neu gebildeten Oker-Departement erhoben, Bürgermeister Hoffmann wurde Canton-Maire, sein ältester Sohn Daniel avancierte zum Mairie-Secrétaire. Das Gehalt war zwar spärlich, aber das Amt gewährte dem patriotisch denkenden Bürgermeister einen gewissen Handlungsspielraum gegenüber der französischen Herrschaft. Heinrich Hoffmanns antifranzösische Haltung, die von ihm zeit seines Lebens lautstark vorgebrachten Ressentiments gegen die französische Kultur und seine bis zum Hass gesteigerte Abneigung gegen alles »Welsche« haben ihre Wurzeln in diesen jugendlichen Erfahrungen.
Das Leben unter einer Besatzungsmacht brachte gerade in einem kleinen und überschaubaren Gemeinwesen ein verändertes politisches Klima mit sich. »Plötzlich war nun alles anders geworden. Das öffentliche Politisieren hörte auf«, liest man in Hoffmanns Aufzeichnungen. Es ist nur zu verständlich, dass sich der über Jahrzehnte hinweg von der Polizei verfolgte Schriftsteller vor allem an die Allgegenwart der von den Franzosen eingesetzten Geheimpolizei erinnert. Diese ständige Bedrohung zieht sich wie ein roter Faden durch sein Leben: »Die geheime Polizei nämlich, diese saubere Napoleonische Einrichtung, war auch in Westfalen eingerichtet und zählte mehr Eingeborene als Fremde unter ihren Helfern und Helfershelfern – ewige Schmach für den deutschen Namen!«
Die Zensur, die seine schriftstellerische Arbeit bis ins hohe Alter beeinträchtigt hat, lernte Hoffmann schon als Zwölfjähriger kennen. Mit dem Vorlesen der Meldungen und Berichte aus dem ›Hamburger Unparteiischen Correspondent‹ hatte es jetzt ein Ende. Die französischen Besatzer sorgten für eine kontrollierte Berichterstattung: »Der Westfälische ›Moniteur‹, die einzige westfälische Zeitung, halb französisch, halb deutsch, ging von der Regierung aus; alle Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Flugblätter und Anzeigen standen unter der strengsten Zensur. Fremde Zeitungen waren zu teuer und durften sich ebenfalls nicht frei äußern. Der ›Hamburger Unparteiische Correspondent‹ hatte für uns aufgehört.« Man spürt die ganze Verbitterung des über Jahrzehnte hinweg von der Geheimpolizei verfolgten, von der Zensur eingeschränkten und schließlich wegen seiner kritischen Gedichte aus Amt und Würden gejagten Hoffmann, wenn er sich noch nach mehr als fünfzig Jahren an die Verfolgung von Polizei und Zensur erinnert: »Geheime Polizei und Zensur hatte bis jetzt keiner bei uns eigentlich gekannt, jetzt lernten wir sie in ihrer ganzen Bedeutung kennen: beide waren die besten Mittel zur gänzlichen Unterdrückung der Wahrheit und jeder vaterländischen und freisinnigen Regung.«
Seiner patriotischen Einstellung und seiner Franzosenfeindlichkeit zum Trotz hat Hoffmann aber eine durchaus differenzierte Haltung gegenüber den Neuerungen der Besatzer eingenommen. Die französischen Eroberer waren nicht nur die unerwünschte Besatzungsmacht, sie waren gleichzeitig auch die erwünschten Reformer: »Das junge Königreich Westfalen hatte Gleichheit vor dem Gesetz, mündliches und öffentliches Gerichtsverfahren, Schwurgerichte, allgemeine Conscriptions-und Steuerpflichtigkeit, freie Ausübung des Gottesdienstes der verschiedenen Religionsgesellschaften, gleiche Berechtigung zu öffentlichen Ämtern, Trennung der Justiz und Verwaltung und hatte – keine Hörigkeit, keine Frohnden und Zehnten, keine Privilegien und keinen Adel.« In diesem problematischen Spannungsfeld von Unterdrückung und Fortschritt war es nach Darstellung des Sohnes der Vater, der sich vorbildlich verhalten hat. Als Canton-Maire kam er seinen Pflichten nach, aber er schöpfte den Rahmen seiner Möglichkeiten voll aus, verweigerte Denunziationen, und im Zweifelsfall fällte er seine Entscheidungen zugunsten seiner Landsleute, nicht zugunsten der Besatzer.
Am 7. April 1812, wenige Tage nach der Konfirmation des gerade vierzehn Jahre gewordenen Heinrich, begleitete Daniel Hoffmann seinen Bruder in das nur eine Tagesreise entfernte Helmstedt. Das dortige Pädagogium stand zwar als gymnasiale Ausbildungsstätte nicht im besten Ruf, aber es bot doch genügend Möglichkeiten für eine ordentliche Ausbildung. Die Entdeckung seiner außerordentlichen Sprachbegabung sollte für den jungen Hoffmann die entscheidende Erfahrung dieser zwei Jahre auf dem Helmstedter Gymnasium werden.
Jede Künstlerbiographie fragt nach den prägenden Einflüssen, die in einem jungen Menschen den Grundstein zu einer künstlerischen Laufbahn gelegt haben. Manchmal ist es das Vorbild eines in der Kunst, Musik oder Literatur erfolgreichen Elternteils, dann wieder die Förderung einer frühzeitig erkannten Begabung, die am Anfang einer Künstlerlaufbahn stehen. Im Elternhaus Hoffmanns wird man vergebens nach solchen prägenden Einflüssen suchen. Besondere Anregungen auf dem Gebiet der Musik oder der Literatur hat der später so erfolgreiche Liederdichter und Sprachwissenschaftler in seiner Jugend nicht erhalten. Im Alter von vierzehn Jahren habe er angefangen, einfache Verse zu schreiben, berichtet Hoffmann in seinen ›Erinnerungen‹. Der um eine Beurteilung gebetene Lehrer drückte ihm daraufhin die Sprachlehren von Johann Heinrich Voß und Karl Philipp Moritz in die Hand, mit denen der Junge aber nichts anfangen konnte. Erst die Gedichte des Johann Gaudenz von Salis-Seewis, die der hilfsbereite Lehrer dem Wissbegierigen als vorbildliche Lektüre für angehende Dichter empfahl, wurden zu einer Art Schlüsselerlebnis. Der heute weitgehend vergessene Salis-Seewis, 1762 in Graubünden in der Schweiz geboren, genoss zu jener Zeit wegen seiner formgewandten Gedichte und nicht zuletzt wegen seiner persönlichen Bekanntschaft mit Goethe, Schiller und Herder einen guten Ruf als Dichter. Für den jungen Hoffmann wurde die Beschäftigung mit diesen Gedichten zur wichtigen Begegnung mit der Lyrik: »Ich las mit wahrer Andacht und las langsam, wohl ein Vierteljahr hindurch nichts als Salis; ehe ich ein neues anfing, kehrte ich gern zu den alten liebgewordenen zurück. Salis war zu sehr mein eigenes Selbst geworden, als dass ich an ein Darstellen meiner Leiden und Freuden gedacht hätte. So wie ich aber mit dem Technischen minder zu kämpfen hatte, stellte sich der Trieb zu dichten stärker ein als je zuvor.« Weder von den Eltern noch von den Lehrern, auch nicht von Freunden hat der junge Hoffmann irgendwelche Hilfe beim Schreiben von Gedichten bekommen. Er war auf sich allein gestellt. Aber die unermüdlichen Versuche, den richtigen Rhythmus der Sprache und die passenden Reime für seine noch hilflosen Verse zu finden, haben sein Sprachgefühl entwickelt.
Die frühen dichterischen Versuche des Vierzehnjährigen fanden vor dem Hintergrund der großen politischen Ereignisse des Jahres 1812 statt. Im Sommer marschierten französische Regimenter durch Helmstedt in Richtung Osten. Im Gymnasium bemühte man sich, die Schüler über die Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Man hatte die ›Augsburger Allgemeine Zeitung‹ abonniert, aus der sich die Jungen über Napoleons Kriegserklärung gegen Russland und die Gegenerklärung des Zaren informieren konnten. Im Herbst schwoll der durch die Straßen Helmstedts marschierende Strom von Soldaten an. Im Winter berichtete der ›Westfälische Moniteur‹ von der Niederlage der Franzosen vor Moskau und von der Flucht Napoleons. Bürgermeister Hoffman las diese Nachrichten seiner Familie vor, die in geschlossener Runde das Weihnachtsfest feierte. Auch Heinrich war dabei, Bruder Daniel hatte ihn trotz Schnee und Eis und klirrender Kälte im Pferdewagen abgeholt und nach Fallersleben mitgenommen. Als der Frühling Einzug hielt, marschierten wieder französische Regimenter durch Helmstedts Straßen, diesmal in Richtung Westen. Auch westfälische Soldaten waren dabei, die den Rückzug aus Russland in erbarmungswürdigem Zustand überlebt hatten und den neugierigen Schülern Einzelheiten von den Kriegsschauplätzen im fernen Russland berichten konnten. Als Heinrich in den Osterferien wieder in Fallersleben war, konnte er zum letzten Mal die plündernde Soldateska der Franzosen erleben. Wieder war es der Vater, der als Bürgermeister die Ordnung aufrechtzuerhalten versuchte und schlichtend eingriff, um Unheil zu verhüten.
Bald darauf erreichte der Geist der deutschen Freiheitskriege das Gymnasium in Helmstedt. Jetzt sprengten preußische Husaren durch die Straßen. »Am 24. Juli gingen vier meiner Mitschüler heimlich unter die preußischen Freiwilligen«, hat Heinrich in sein seit Jahresanfang geführtes Tagebuch notiert. Weitere Kameraden schlossen sich den Freiwilligen an, als die Kunde von der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 die Runde machte.
Das Ende des Königreichs Westfalen hat der Bürgermeister von Fallersleben auf souveräne Art und Weise überstanden. Er forderte seine Mitbürger, die von nun an nicht mehr Westfalen, sondern wieder Hannoveraner waren, in öffentlicher Rede auf, ihn wegen vorsätzlicher Ungerechtigkeiten oder sonstigen schuldhaften Verhaltens anzuklagen. Nachdem sich niemand mit Schuldvorwürfen gemeldet hatte, erklärte Heinrich Wilhelm Hoffmann seinen Rücktritt vom Amt des Bürgermeisters, verzichtete auf das Jahresgehalt von 50 Talern und zog sich im November 1813 ins Privatleben zurück.
Die politischen Ereignisse haben den Sohn durchaus beschäftigt, aber noch mehr kümmerte er sich um seine Ausbildung. Der junge Heinrich verfügte über eine enorme Arbeitskraft, die ihm sein ganzes Leben lang zustatten kommen sollte. Mit Erfolg erweiterte er seine Kenntnisse in den Fächern Latein, Griechisch und Französisch. Daneben schrieb er weiter Gedichte. »Für Poesie blieb ich nach wie vor beseelt und thätig trotz allen Aufregungen, welche sich durch das Kriegsgetümmel wiederholten.« Er las Kleist, Matthisson und Hölty, Schillers Balladen lernte er auswendig. Im Tagebuch notierte er: »Die Lectüre deutscher Dichter wird mir immer angenehmer.« Als das Gymnasium in Helmstedt am 24. Januar 1814 die Rückkehr von Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig mit einem Festakt beging, durften sechs ausgewählte Schüler Gedichte vortragen. Heinrich war einer von ihnen, er deklamierte ›Das Vaterlandslied für die Deutschen‹ von Ernst Moritz Arndt, der als Dichter der Freiheitskriege bei den Jungen hohes Ansehen genoß. Seine eigenen Gedichte kreisten in dieser Zeit um Motive aus dem Wechsel der Jahreszeiten und um den Tod der jüngsten Schwester. In seinen Mitschülern fand er ein aufmerksames Publikum.
Das Frühjahr 1814 brachte Veränderungen im Leben des Jungen mit sich. Auf Wunsch seines Vaters sollte er Helmstedt verlassen und auf das renommierte Katharineum in Braunschweig wechseln. Am 19. April nahm er von Lehrern und Mitschülern Abschied, schon am 25. April bestand er die Aufnahmeprüfung in seiner neuen Schule. Bei einem alten Küster und dessen Frau fand er Unterkunft, der Vater hatte das Kostgeld für drei Mahlzeiten am Tag bewilligt. Der Schulanfang fiel in die Zeit straff organisierter militärischer Aufrüstung, denn der Herzog von Braunschweig gab sich größte Mühe, das Heer seines kleinen Landes zu vergrößern und die Ausrüstung seiner Soldaten zu verbessern. »Kein Wunder, dass auch unter solchen Rüstungen meine Poesie ihre bisherige harmlose Richtung einbüßte«, erinnerte sich später der Dichter an seine jugendlichen Versuche. Begeistert von den Ideen der deutschen Freiheitskriege, las er jetzt die Lieder aus Theodor Körners ›Leyer und Schwert‹. Unter dem Eindruck der glücklich erfolgten Vertreibung der Franzosen und beeinflusst vom patriotischen Pathos von Körners Liedern verfasste er auf dem Braunschweiger Katharineum in kürzester Zeit einige Lieder und Xenien, die er seinem Vater vorlegte. Der alte Hoffmann zeigte sich beeindruckt.
Seinen ersten Erfolg feierte der junge Dichter am Tag nach dem 24. Juli 1814, dem Tag des Friedensfestes, das im ganzen hannoverschen Land gefeiert wurde. Beim Schützenfest der Schützengilde sang die versammelte Jugend von Fallersleben das Lied »Herein, herein in unsers Kreises Runde«, der Text stammte aus der Feder des jungen Heinrich Hoffmann. Wenige Wochen später überreichte ein Braunschweiger Buchdrucker dem stolzen Verfasser einige Abdrucke seines Liedes. Eine prägende Erfahrung! Die Art und Weise der Entstehung der ersten Veröffentlichung Hoffmanns ist symptomatisch für das Erscheinen vieler seiner Werke. Jeweils aus gegebenem Anlass wurde rasch ein Text verfasst und ebenso rasch ein Drucker gefunden. Schon nach wenigen Tagen kam die Gelegenheitsarbeit als Faltblatt oder einfacher Druckbogen heraus. An einem kontinuierlichen Aufbau eines Gesamtwerkes war Hoffmann zeit seines Lebens nicht interessiert.
Der frühe Erfolg war für den erst sechzehnjährigen Gymnasiasten eine große Motivat...