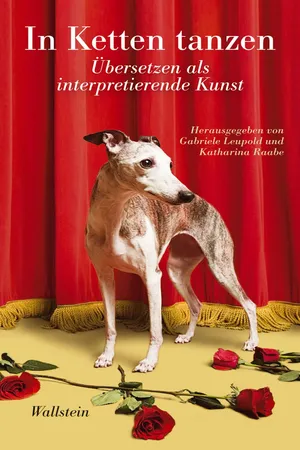![]()
REINHART MEYER-KALKUS
Koordinaten literarischer Vortragskunst
Goethe-Rezitationen im 20. Jahrhundert
Alte Aufnahmen
Goethe-Rezitationen im 20. Jahrhundert – das klingt wie ein typisches Deutschlehrer-Thema der 60er Jahre, als in schulischem Unterricht und Deutschlehrerausbildung noch Wert auf die Sprecherziehung gelegt und diese an kanonischen literarischen Texten, vornehmlich an Goethe-Texten, exerziert wurde. Ein didaktisches Hilfsmittel für diese Unterrichtseinheit war die Sprechschallplatte. Neben der Deutschen Grammophon Gesellschaft mit ihrem »Literarischen Archiv« waren auch andere Verlage engagiert, etwa der Freiburger Christophorus-Verlag, der seit Ende der 50er Jahre eine Serie von Sprechplatten für den Schulgebrauch mit didaktischen Erläuterungen für Lehrer herausbrachte: »Deutsche Dichtung. Eine klingende Anthologie«. In dieser Reihe erschien 1961 eine Sprechplatte mit dem bildungsdeutschen Titel Goethe-Interpretationen im Wandel der Zeit, zusammengestellt und kommentiert von dem nachmaligen »Sprecher der Nation« Gert Westphal. Auf dieser Platte finden sich Aufnahmen mit Rezitationen der »Prometheus«-Hymne von Josef Kainz (1858-1910), Alexander Moissi (1879-1935), Ludwig Wüllner (1858-1938) und Rolf Henninger (geb. 1925); sodann »Grenzen der Menschheit« von Friedrich Kayssler (1875-1945) und Eduard Marks (1901-1981); »Der Schatzgräber« von Albert Bassermann (1867-1952) und Gert Westphal (1920-2002); »Adler und Taube« von Hedwig Bleibtreu (1868-1958) und Maria Ott (geb. 1922); »Dauer im Wechsel« von Friedrich Kayssler (1874-1945) und Paul Hoffmann (geb. 1902).
In einem Begleittext begründet Gert Westphal seine Auswahl: »Die vorliegende Platte beweist neben vielen anderen Überraschungen, … wie radikal der Beginn eines neuen Stils [durch Josef Kainz] in der Schauspielkunst war. Wie es in seiner Nachfolge nur noch Modifizierungen dieses Stils gibt, nicht aber eigentlich Neues. Zahlreiche Nuancierungen, die aber kaum die Frage nach dem Stil, sondern viel eher die nach der Qualität stellen. … Mit Kainz etabliert sich – verbindlich für die erste Hälfte des neuen Jahrhunderts – das Primat geistiger Wahrhaftigkeit vor der Rhetorik und dem musikalischen Effekt. Keiner der Interpreten, die unsere Platte versammelt, hat dieses Primat außer acht gelassen, weder Kainzens Zeitgenossen, noch die unmittelbar Folgenden; weder die vom Naturalismus Geprägten, noch die Heutigen. Bei diesen beachtet man, was Kainz noch nicht sehen konnte, wie sehr sie, mit der Entwicklung der technischen Übertragungs- und Konservierungsmittel aufgewachsen, von den Apparaturen ihrerseits beeinflußt worden sind. … Die persönliche Interpretation ist in Versachlichung aufgegangen. Noch das aber ist nur eine Modifikation, ein neuer Stil ist damit nicht gewonnen worden.«1
Tatsächlich machen die »Prometheus«-Interpretationen von Kainz, Moissi, Wüllner und Henninger diesen Wandel auf beispielhafte Weise hörbar. Vor allem die Rezitation von Josef Kainz, 1902 aufgenommen und dann als Odeon-Schallplatte vertrieben (Beispiel 1), ist ein Markstein der Sprechkunst auf Tonträgern. Kainz’ Rezitation ist fern jeder didaktischen Textvermittlung und doch unmittelbar verständlich durch ihre klare Diktion und sinnbetonende Akzentuierung und Prosodie – glühend intellektuell und leidenschaftlich-wild. Kainz gliedert den Text in große, durch Akzente und Tonhöhenbewegungen strukturierte Ton- und Phrasierungsbögen, um die Kaskaden der rhetorischen Fragen dieses aufbegehrenden Halbgotts zu verdeutlichen. Höhepunkt ist die Absage an die Götter und die Hinwendung zu den leidenden und genießenden Menschen: »Hier sitz’ ich, forme Menschen / Nach meinem Bilde.«
Kainz’ biegsame, in allen Höhenlagen und Lautstärkegraden wohl durchgebildete Stimme erlaubt ihm, in ein, zwei Worten große Tonintervalle zu überspringen und damit den Wechsel von Stimmungen und Affekten hörbar zu machen – ein Äquivalent zu den zur selben Zeit von einem Komponisten wie Arnold Schönberg praktizierten harmonischen Kühnheiten, jenen »Kürzungen von Wendungen durch Weglassung des Wegs«2. Während sich das normale Sprechen im Tonraum einer Quarte bewegt, durchmißt Kainz’ Stimme den Umfang einer Oktave, wie unter expressivem Überdruck. Das bühnenmäßige Sprechen sei »wie ein Gesang zu gestalten«, soll er einmal gesagt haben.3 Allerdings benutzt Kainz diese sprechmusikalischen Mittel stets im Dienste der Charakterisierung des zugrunde liegenden Textes. Jede kleinste Phrase wird – im Interesse von Deutung und Faßlichkeit – individuell charakterisiert und gegenüber dem Vorhergehenden wie dem Nachfolgenden abgesetzt, durch Prosodie, Tempo, Lautstärke, Timbrierung und Gestus. Im Wechsel der distinkten Empfindungsakzente entsteht der Eindruck eines geradezu hysterischen Sprechens: Über dieses Gesicht huschen in dichtester Folge die verschiedensten Affekte, Zorn, Trotz, Zärtlichkeit und Lächeln.
Man muß sich den zu Kainz’ Zeit noch üblichen getragenen, metrisch bewußten und rhythmisch skandierenden Deklamations-Stil vergegenwärtigen, wie ihn Goethe für seine Weimarer Schauspieler verbindlich gemacht hatte und wie sie das Meininger Hoftheater bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts auf der Theaterbühne pflegte (wovon man in der »Prometheus«-Rezitation von Ludwig Wüllner noch ein Echo vernimmt), um den neuen Ton, die neue »Lebensgebärde«4 zu erkennen. Der Theaterkritiker Alfred Kerr meinte, Kainz habe die »rasenden Jambenjünglinge« mit den in schönem Wahnsinn rollenden Augen beiseitegeschoben und »jene realistischere, unserem Gefühl ungleich näher stehende Spielart eingeführt, … mit halb verhaltenen seelischen Gesten, die Empfindungen moderner, nervöser junger Leute« zeigen wollen.5 Allerdings befremdet heute der mit Stentorstimme gehämmerte Schluß von Kainz’ Rezitation: »Und Dein nicht zu achten, /wie ich.« Diesen sich überschlagenden Ton kennen wir als fanatischen Willensgestus aus den politischen Ansprachen Adolf Hitlers. Der Wiener Agitator hatte vermutlich Echos der Kainzschen Kunst aufgefangen und sie in seinen Sprechstil eingebaut.
Kainz wurde mit seinen gleichermaßen expressiven wie den Formstrukturen des Texts verpflichteten Rezitationen zum Ahnherrn einer ganzen Generation von Schauspielern und Rezitatoren, von Alexander Moissi über Fritz Kortner bis hin zu dessen Schüler Peter Stein.6 In Moissis »Prometheus«-Rezitation aus dem Jahre 1917 (Odeon 80762) mag man so etwas wie eine unmittelbare akustische Rezeption seines Vortragsstils erkennen. Moissi treibt die sprechsängerischen Komponenten – das Singen auf einer Tonhöhe und die expressiven prosodischen Tonhöhenbewegungen – noch weiter, verwendet diese Mittel aber gleichfalls zur Differenzierung der verschiedenen Textabschnitte und Markierung der Höhepunkte. Moissi ist der musikalischste aller Rezitatoren, mit einer heute unzeitgemäß anmutenden Neigung zum pathetischen Tremolo und langgezogenen Portamenti. Hat man sich über diese heute Heiterkeit auslösenden Stilmittel einmal hinweggesetzt, so besticht sein Vortrag – wie der anderer Rezitatoren der 20er Jahre – durch Kunstverstand und Formgefühl. Die Texte werden deutlich gegliedert, Formabschnitte und Höhepunkte herausgearbeitet, ohne daß die Linie der Rezitation und die Einheit des Vortrags gefährdet werden.
Daß dieser Kunstverstand nach 1945 keineswegs verschwunden, ja selbst noch in der Gegenwart lebendig ist, kann man an der »Prometheus«-Rezitation von Ulrich Mühe (1956-2007) aus dem Jahre 2000 erkennen (Patmos Verlag LC 04176). Mühe macht aus dem Text die dramatische Rollenrede eines aufrührerischen Künstlers. Mit sachlich-scharfem und spöttisch-verachtendem Ton scheint er sich noch einmal gegen die DDR-Kulturpolitiker und deren angemaßte Allmacht zu wenden, um die Autonomie der Kunst einzufordern. In der letzten Strophe ereignet sich das Unerwartete: Der Rezitator tritt mit ruhig-gefaßter Erzählerstimme aus der Rolle des Halbgotts heraus, gewissermaßen vor den Vorhang, und spricht nun in Eigenstellung zum Publikum, wie ein Akteur im Brecht-Theater. Es ist ein Bekenntnis zur Freiheit der Kunst, zugleich ein anderer Aufruf an das Volk gegen eine von Parteigottheiten regierte Welt, wie ihn Mühe mit anderen Künstlern im November 1989 auf dem Alexanderplatz vorgetragen hatte.
»Wie machen wir’s, daß alles frisch und neu / Und mit Bedeutung auch gefällig sei?« so fragte schon der Theaterdirektor im »Vorspiel auf dem Theater« in Goethes Faust. Um solchen Erwartungen hinsichtlich von Frische, Neuheit, Bedeutung und Gefälligkeit zu entsprechen, muß die literarische Vortragskunst zumindest zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie muß eine Vortragskonzeption haben, die dem Text »Jetztzeit« (Walter Benjamin) abgewinnt und ihn so behandelt, als wäre er eine Antwort auf unsere eigenen Fragen und Sensibilitäten, sie muß aber auch über die stimmlichen Mittel verfügen, um Textverständnis und Vortragskonzeption angemessen umzusetzen und hörbar zu machen. Die zugrunde liegenden literarischen Texte sind ästhetische Formeln, die immer wieder neu mit Leben erfüllt werden müssen.
Gert Westphals These, wonach man an den Goethe-Rezitationen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen Wandel zu größerer Sachlichkeit ablesen kann, ist nicht grundsätzlich falsch, aber modifizierungsbedürftig. Die Selbstdeutung einer Generation als »sachlich« ist ja immer des Selbstmißverständnisses verdächtig. Tatsächlich reduziert der auf der Christophorus-Sprechplatte vertretene Rolf Henninger – ein in den 50er Jahren viel beschäftigter Akteur von Klassiker-Inszenierungen – die wilden prosodischen Bewegungen, Dynamik und Spannungsbögen eines Kainz und Moissi. Doch findet er zu anderen pathetischen Mitteln eines gefaßten Nach-innen-Sprechens. Dank der veränderten aufnahmetechnischen Bedingungen mit leistungsfähigeren Mikrophonen und Aufzeichnungsgeräten sind seit den 50er Jahren akustische Nahaufnahmen möglich, die größere dynamische Differenzierungen und die expressive Atemgebung einfangen. Davon haben Henninger wie auch Will Quadflieg, Ernst Ginsberg und andere Protagonisten der Sprechkunst der 50er Jahre intensiv Gebrauch gemacht. Pathos als das Bewegende, Aufregende und Bestürzende eines Vortrags kann ganz unterschiedlich realisiert werden. Wo hier eine in Lautstärke und Geschwindigkeit akzelerierende Sprechweise die katastrophische Aufgeregtheit eines Seelenzustandes reflektiert, ist es dort ein Leiserwerden und Nachinnen-Sprechen, ein Abbruch und Verschweigen, das pathetisch wirkt. Jede Generation entwickelt ihre eigenen Pathos-Mittel, in der Sprechkunst ebenso wie in der politischen Rhetorik,7 und konträr erscheinende Stilmittel können ähnliche Funktionen erfüllen.
Westphals These ist aber noch aus einem anderen Grund anfechtbar: Sie ignoriert die antiklassizistischen Tendenzen, die in der Sprechkunst um 1960 neben dem klassizistisch gedämpften Pathos zu hören waren, etwa in den melodramatisch outrierten Rezitationen von Klaus Kinski oder in den versonnen-explosiven des ungleich artistischeren Oskar Werner, die beide gleichfalls den »Prometheus« rezitiert haben. Das Stichwort Versachlichung taugt nicht als Titel, unter dem die Geschichte der Goethe-Rezitationen oder von anderen Rezitationen im 20. Jahrhundert zu schreiben wäre. Der Wandel literarischer Vortragskunst läßt sich nicht im Bilde einer im Gänsemarsch prozedierenden Folge von Stilen fassen, und es gibt erst recht keine teleologische Stilentwicklung, hier ebensowenig wie in anderen künstlerischen Bereichen.
Stilwandel der Sprechkunst Goethes Tasso als Hörfassung (1961) und als Schauspiel (1969)
Goethe-Rezitationen auf der Vortragsbühne und Goethe-Deklamation im Theater sind im übrigen nicht voneinander zu trennen, auch wenn es sich um zwei ganz unterschiedliche Gattungen der Vortragskunst handelt, die den Akteuren Verschiedenes abverlangen – hier der Rezitator, der in seiner empirischen Person bzw. seiner »persona« immer als solcher erkennbar bleiben muß, wenn er den Text eines anderen vorträgt, dort der Schauspieler, der sich in die Rolle verwandelt, die er spielt. Seit der Goethezeit wurde über die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Schauspieler und Rezitator gestritten, von Klassizisten, welche Grenzpfähle zwischen den Vortragskünsten errichteten und sich gegen jede Vermischung allergisch zeigten, und von Romantikern, welche eben diese Vermischung als ästhetisch reizvoll empfanden und die Rezitation musikalisch und deklamatorisch aufluden.8 Dieser Streit hat heute an Schärfe verloren, ja er ist eigentlich inexistent geworden, da es keine anspruchsvolle Diskussion im Bereich der Vortragskunst mehr gibt wie noch in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.9 Es dürfte sich die Einsicht durchgesetzt haben, daß zwischen Bühne und Vortragspodium ein ständiger Austausch von Sprechweisen und Tonfällen stattfindet, schon aufgrund der Tatsache, daß die meisten Rezitatoren zugleich auch Schauspieler sind.
Die Veröffentlichung einer vom ORF Salzburg im Jahre 1961 im Studio Salzburg produzierten Hörfassung von Goethes Tasso und der Bremer Theaterinszenierung von Peter Stein aus dem Jahre 1969 auf DVD10 gibt ein Beispiel für einen Stilwandel innerhalb von nur wenigen Jahren. Es ist ein Dokument des Bruchs, den die Interpretation von Goethe-Dramen wie von klassischen Dramen über...