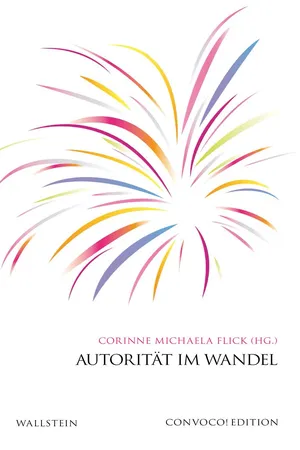![]()
Peter Maurer
Machtfragmentierung, Gewalt und die Autorität des Rechts – ein Blick auf bewaffnete Konflikte
Autorität und Autoritäten
Aus der Vogelperspektive gesehen, bezieht sich Autorität auf die persönliche, institutionelle oder soziale Stellung, auf die Hierarchie im Staat, in Privatunternehmen, religiösen Strukturen, im Berufsleben, in der Zivilgesellschaft und mehr. Man kann eine formelle oder eine De-facto-Perspektive einnehmen, kann sich Autorität auf der Grundlage von Stärke, Macht, Zustimmung, Ergebenheit, körperlichen, geistigen oder moralischen Faktoren oder irgendeiner Kombination davon vorstellen. Man kann über die Eigenschaften des damit einhergehenden Konzepts der »Legitimität« nachdenken und den Bezug zu Max Webers traditionaler, charismatischer und institutioneller Legitimität herstellen. Es gibt also eine Fülle an Perspektiven, unter denen wir den Wandel von Autorität betrachten können.
Die humanitäre Perspektive
Ich nehme hier die Perspektive einer humanitären Institution ein, die seit über 150 Jahren an den Frontlinien von Krieg und Gewaltkonflikten arbeitet, um
– mit Hilfe des Rechts die Humanität zu wahren,
– die politische Entscheidungsfindung zu beeinflussen,
– den Menschen Hilfe zu leisten und sie zu schützen.
Diese Arbeit bietet viele Anknüpfungspunkte zu Autorität und Autoritäten.
– Rechtliche Anknüpfungspunkte, weil wir durch die Genfer Konventionen (als dem umfassendsten ratifizierten Rechtsinstrument weltweit) ein Mandat und somit eine Art delegierter Autorität der Staaten dafür haben, sie bei der Umsetzung und Entwicklung des internationalen humanitären Völkerrechts zu unterstützen,
– politische Anknüpfungspunkte auf Grund unserer Rolle, mit Staaten und nichtstaatlichen Akteuren in einer neutralen, unparteilichen und unabhängigen Weise umzugehen, sodass diese angemessene humanitäre Strategien verfolgen, und
– operationale Anknüpfungspunkte durch unsere Arbeit, mit der wir Autoritäten durch humanitäre Maßnahmen ergänzen, unterstützen und vertreten.
Diese Perspektive eröffnet bestimmte Einsichten, die ich weiter ausarbeiten möchte im Hinblick auf
– das fallweise Unvermögen von Autoritäten, auf die Anliegen der Menschen einzugehen,
– den Wandel von Autorität auf Schlachtfeldern,
– die Auswirkung eines solchen Wandels auf die Autorität des Rechts,
– die Kosten für Individuen und Gemeinschaften, wenn die Autorität kollabiert, und
– die Möglichkeit der Wiederherstellung von Autorität durch neutrale und unparteiische humanitäre Maßnahmen.
Versagen der Autorität und ihr Wandel
Um zu ermessen, was in den letzten 150 Jahren mit der Autorität in bewaffneten Konflikten und deren Umfeld geschah, gilt es zunächst einen Blick darauf zu werfen, wie sich das Rote Kreuz (IKRK) als Institution entwickelt hat. Ausgehend von fünf Gründungsvätern und einigen Freiwilligen wurde das Rote Kreuz zu einer Organisation mit 15.000 qualifizierten Mitarbeitern weltweit, mit Niederlassungen in über 80 Ländern und einem Jahresetat von 1,6 Milliarden Schweizer Franken. Das Rote Kreuz bildet außerdem den Kern der internationalen Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung mit mehr als 100 Millionen Mitgliedern und 17 Millionen aktiven Freiwilligen, die sich weltweit in humanitärer Arbeit engagieren. Es ist im selben Tempo gewachsen, in dem Autoritäten in Staaten und Gesellschaften an der Aufgabe scheiterten, der eigenen Bevölkerung Hilfe zukommen zu lassen und sie zu schützen. Sein Engagement begann mit den »Verwundeten und Kranken im Feld«, konzentrierte sich während des Ersten Weltkriegs auf Kriegsgefangene und Häftlinge im Allgemeinen und verlagerte sich in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend auf Zivilisten. Neben dem Einsatz für die Respektierung des Rechts durch staatliche Armeen richtet sich die Aufmerksamkeit seit Jahrzehnten auf eine wachsende Zahl nichtstaatlicher bewaffneter Gruppen. Das Rote Kreuz hat sich an vorderster Stelle für Verbote von Waffen bzw. die Einschränkung ihres Gebrauchs eingesetzt. Und wir sind inzwischen selbst zu einer Autorität geworden, die darum kämpft, den Respekt für humanitäre Gesetze und Grundsätze überzeugend nahezubringen, zu unterstützen und zu begünstigen, um die Einhaltung dieser Normen sicherzustellen.
Für eine Organisation wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) ist die Veränderung von Autorität daher nicht bloß eine abstrakte Frage, sondern eine im Laufe der Geschichte täglich gemachte Erfahrung. Und das gilt heute mehr denn je, da das Scheitern politischer Dialoge und der politischen Diplomatie in den letzten Jahren vielfach dazu geführt hat, dass bewaffnete Konflikte eine neue Stufe der Radikalität und der negativen Folgen für die Menschen erreicht haben. Wir befinden uns in einer paradoxen Situation: Einerseits leben wir in einer zunehmend globalisierten Zivilisation, in der mehr Menschen als je zuvor in der Menschheitsgeschichte informiert, gebildet, gesund und wohlhabend sind und von Institutionen und Autoritäten profitieren, die ihre Leistung ständig verbessern. Gleichzeitig stellen wir aber in weiten Teilen der Welt einen Mangel an Zugang zur Grundversorgung, hohe Gewaltpegel, ökonomische Ungerechtigkeit, schlechte Regierungsführung und Korruption fest. 700 Millionen Menschen leben unterhalb der Armutsgrenze, und mehr als zwei Milliarden Menschen leben in instabilen Staaten und sind in mehr Ländern als jemals zuvor instabilen Verhältnissen ausgesetzt.
Existierende Autoritäten in Frage stellen
Der Wesenskern des Konflikts besteht genau darin, dass Autorität in Zweifel gezogen und angefochten wird. Gewalt ist oft die direkte Konsequenz eines Antagonismus der Macht zwischen mehreren Akteuren und Autoritäten oder das Resultat eines Ausschlusses von der Macht. Nehmen wir den sogenannten arabischen Frühling und die Gewalt, die damit einherging. Am Anfang stand ein Aufstand, und zwar nicht der Armen gegen die Reichen, nicht etwa von Terroristen gegen eine legitime Staatsgewalt, sondern von Menschen, die im Umgang mit ihren jeweiligen Autoritäten Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Marginalisierung erlebten und von der Autorität im Staat ausgeschlossen waren.
An vielen Orten, an denen wir im Einsatz sind, beobachten wir konfliktträchtige Beziehungen entlang der verschiedenen religiösen, politischen, stammesdefinierten, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bruchlinien, mit einer hohen Zahl von Gewaltvorfällen und nur wenigen oder gar keinen legitimen politischen Prozessen, die zu einem Konsens über die Zukunft der Gesellschaft führen. Wir stellen einen Mangel an Bereitschaft fest, Gewalt zu verhindern oder bewaffnete Auseinandersetzungen zu beenden. Auf allen Seiten der Frontlinien begegnen wir starken Überzeugungen, wonach Gewalt am Ende die besseren Optionen bieten wird als die gegenwärtige Situation oder als ein politischer Prozess, der von allzu vielen Menschen lediglich als ein Prozess der Benachteiligung, des Ausschlusses, der Ungerechtigkeit und unabänderlicher Armut empfunden wird – oder kurz gesagt, als gescheiterte Integration. In vielen Gesellschaften sehen wir keinerlei Bedürfnis, mit jenen Mitgliedern der Gemeinschaft zusammenzuleben, die sich auf der anderen Seite der trennenden Gräben befinden, und deshalb auch keinen Wunsch, Institutionen und Gemeinschaft gemeinsam zu organisieren. Vielen Regionen, in denen wir arbeiten, fehlt es schlicht und einfach an Autoritäten, die sich um die Vielfalt in der Gesellschaft kümmern. Das sind die Situationen, in denen wir als humanitär Handelnde sagen müssen: Wir brauchen politische Lösungen. Wir können diese Probleme nicht durch Humanitarismus lösen. Nur ein legitimer, inklusiv organisierter politischer Prozess unter den entscheidenden Konfliktbeteiligten kann die betreffenden Gesellschaften letzten Endes aus einem bewaffneten Konflikt herausführen und inklusiv verfasste Gesellschaften aufbauen. Bis es zu solchen Prozessen kommt, mögen humanitäre Akteure durchaus eine besondere Rolle spielen und etwas zu bieten haben.
Fragmentierte Machtbereiche auf heutigen Schlachtfeldern
Der kennzeichnende Grundzug heutiger Konflikte, in denen das IKRK tätig ist, ist die Zersplitterung der Befugnisse und Autoritäten, sind strukturlose Kämpfe bei unklarer Befehlsgewalt, Kontrolle und Kommunikation, sind ständig wechselnde Bündnisse sowie langfristige gewalttätige Auseinandersetzungen und ein hohes Maß an Gewaltintensität mit tiefgreifenden Folgen für die Gesellschaften. Die Rede ist vom Nahen Osten (Syrien, Irak, Jemen, Israel/ Palästina oder Libyen), von der Region des Tschadseebeckens, dem Horn von Afrika oder dem Nord- und dem Südsudan, von Afghanistan – und ja, auch von Europa (Ukraine, Berg-Karabach) – und vielen weiteren.
In solchen Kontexten sind eine Reihe von Staaten und nichtstaatlichen Akteuren – in den Konfliktregionen und außerhalb davon – auf zahlenmäßig zunehmenden Schlachtfeldern in Kampfhandlungen verwickelt. Staaten operieren außerdem verdeckt mit bewaffneten Streitkräften oder nutzen ferngesteuerte Drohnen, setzen Roboter oder andere hochentwickelte Cybertechniken ein, während nichtstaatliche Akteure, die vorgeben und anstreben, Staaten zu sein, staatsähnliche Funktionen übernehmen, indem sie die Wasserversorgung, Krankenhäuser, Schulen und lokalen Polizeiwachen betreiben. Es ist selten, dass irgendeine dieser Gruppen – von der Hamas bis zur Hisbollah, von Al Nusra bis zum Islamischen Staat, von den Taliban bis zu Boko Haram – ausschließlich in der militärischen Dimension existiert; für die Bevölkerung in ihrem Herrschaftsbereich sind sie Autoritäten, die soziale Dienste bereitstellen – Autoritäten, die diese Gruppen auch sein wollen.
Autoritäre Machtausübung
Während das wesentliche Merkmal der Autorität auf dem Schlachtfeld die Fragmentierung ist, erleben wir bei den Konfliktparteien selbst oft das genaue Gegenteil. Das Paradox besteht darin, dass zwar die Autorität an vielen Orten fragmentiert ist und weiter zerfällt, die autoritäre Macht innerhalb der verschiedenen Gruppen jedoch an Stärke gewinnt. Das wiederum macht Konflikte noch »gewaltträchtiger«, wie es Amartya Sen in seinem bemerkenswerten Werk über »Identity and Violence«[1] so treffend beschrieben hat.
Mangel an Rechtskonformität und Vertrauen in das Recht
Mit der Fragmentierung und Gewalt verflüchtigt sich – wie wir deutlich erkennen können – das Vertrauen in das Kriegsrecht, was für die Autorität dieses rechtlichen Rahmens weitreichende Folgen hat. In den gegenwärtigen Konflikten werden oft die elementarsten Verhaltensregeln verletzt. Und obwohl dies an sich nichts Neues ist – schließlich sind wir seit 150 Jahren Zeugen von Weltkriegen und Völkermorden und Verbrechen gegen die Menschheit –, könnte die Dynamik heute doch einige Besonderheiten aufweisen.
Diese Dynamik ist im Grunde genommen recht einfach. Die Kriegführenden wissen normalerweise, dass ein Militäreinsatz Umsicht verlangt, dass Zivilisten geschützt, Frauen und Kinder verschont werden müssen, Krankenhäuser nicht angegriffen werden dürfen, Gefangene menschlich zu behandeln sind und ihre Folterung untersagt ist. Häufig sehen wir aber dort, wo wir mit ihnen zu tun haben, kein Vertrauen darauf, dass die Gegenseite das Recht ebenso umsetzen wird. Es ist der Mangel an Vertrauen in die Wechselseitigkeit, der die Dynamik der Rechtsmissachtung auslöst. Das Kriegsrecht, als moralische und praktische Autorität über Jahrhunderte in den Gepflogenheiten und dem Einverständnis von Kriegführenden verwurzelt, verliert unter solchen Umständen seine Autorität. Die totalitäre Rhetorik und Praxis heutiger Kriegsführung, die Enthumanisierung des Gegners, die überzogene Politisierung des Rechts, die hauptsächlich verwendet wird, um den Gegner öffentlich bloßzustellen, die Stigmatisierung des Gegners, die Doppelmoral bei der Anwendung des Rechts, all diese Faktoren tragen zum Erscheinungsbild eines Rechts bei, das systematisch missachtet wird. Das internationale humanitäre Völkerrecht war jahrzehntelang die nicht auf dem Radarschirm auftauchende Disziplin der Militärs, ihrer Juristen, Akademiker und des IKRK, wenn es darum ging, für die Dilemmata zwischen militärischer Notwendigkeit und dem Schutz von Zivilisten inmitten des Konflikts praktische Lösungen zu finden. Heute spielen sich Verletzungen des internationalen humanitären Völkerrechts in einem hochgradig kommunikativen Umfeld ab, das zu so etwas wie einem erweiterten Schlachtfeld geworden ist. Eine Seite beschuldigt die andere und umgekehrt, die Genfer Konvention zu verletzen, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen; jede Seite benutzt die rechtliche Zurechenbarkeit als politisches Instrument und nicht als eine offensichtliche und nichtpolitische Konsequenz der Rechtsverstöße. Da das Recht zu einem Instrument politischer Propaganda gemacht wird, ist das Vertrauen der Kriegführenden darauf, dass das Recht dazu da ist, ihnen und ihrer Rolle im Gefecht zu nützen, rasch aufgebraucht.
Während in den Nachrichten hauptsächlich von den wahllos verübten terroristischen Anschlägen in immer mehr Städten weltweit die Rede ist, spiegelt dies in Wirklichkeit nur die Verflüchtigung der regulativen Autorität des Rechts. Bei Licht besehen ist offenkundig, dass uns in vielen Konflikten heutzutage der Konsens einer geteilten Humanität und minimaler Verhaltensmaßstäbe fehlt. Wir beobachten deswegen vielfach kaum einen Unterschied zwischen dem Verhalten staatlicher und nichtstaatlicher Akteure. Die uns vorliegenden Zahlen zu den Angriffen auf medizinische Dienste in elf Ländern zeigen, dass staatliche und nichtstaatliche bewaffnete Gruppen für solche Rechtsverstöße fast zu gleichen Teilen verantwortlich sind. Sie zeigen auch, dass sowohl staatliche Streitkräfte als auch nichtstaatliche bewaffnete Gruppen in Konfliktzonen mit höherer Wahrscheinlichkeit medizinische Dienste – ...