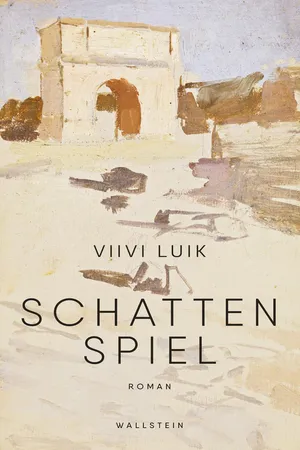![]()
Fahrkarte für den Nachtzug
Innenansichten von Aventin und Parioli bekam ich im Zuge unserer Wohnungssuche. Im Kielsog eines Maklers kann man in den Wohnungen fremder Leute in Winkel gelangen, die ansonsten nicht einmal ihre Bekannten und Freunde ohne Weiteres zu Gesicht bekommen. Man kann alle Badezimmer und Schlafzimmer besuchen, ohne dass jemand es einem übelnähme.
Man kann auch das Dienstmädchenzimmer und die Küche sehen, was einem sonst nie gezeigt wird.
Die dunkle Wohnung in der Via dei Coronari war letztlich nur eine vorübergehende Unterkunft, der Zustand vor der echten Wohnung. Wir gingen zunächst leichtfertig an die Wohnungssuche in Rom heran. Wer konnte schon ahnen, dass eine Wohnungssuche in Rom der Beschaffung einer Fahrkarte für einen ausgebuchten Nachtzug gleichkommt?
Wer konnte schon ahnen, was Roms Häuser verbargen und wie viele von ihnen im Großen Jahrzehnt der Hässlichkeit errichtet worden waren, in den sechziger Jahren? Dieses Jahrzehnt der Hässlichkeit überschattet ganz Italien, sogar in der Toskana und in Umbrien findet man Häuser, die in jener Zeit errichtet worden sind. Es ist wie ein über ganz Italien ausgebreitetes sowjetzeitliches Moskau. Dieselben billigen Klötze aus Beton und Glas, der gleiche Stempel von Nachlässigkeit und Geist der Hoffnungslosigkeit. Wo immer man diese Häuser sieht, bei ihrem Anblick denkt man sofort an die Schlagwörter und Modematerialien der damaligen Zeit: Asbest, Silikat, Eternit.
Eines Tages hatten wir bis zum Auszug aus der Via dei Coronari noch zwei Wochen Zeit, und wir wussten nicht, wohin. Wir mussten zunächst mal einen Makler suchen.
Im Laufe der Prozedur stellte sich heraus, dass im Moment alle einen Makler suchten. Dass alle eine Wohnung suchten und dass es in keiner anderen Hauptstadt ein so geringes Angebot und eine so große Nachfrage gab wie in Rom. In Rom wimmelt es von Ausländern, die alle hoffen, einen guten Makler zu finden und eine schöne Wohnung zu bekommen. Alle suchen eine schöne möblierte Wohnung im Herzen von Rom zu einem günstigen Preis.
Die Leitfäden und Beschränkungen hinsichtlich der Wohnungssuche waren streng. Was bewies, dass die entsprechenden Stellen im Ministerium keinen blassen Schimmer von den Zuständen auf dem römischen Wohnungsmarkt hatten. Es kam einem Wunder gleich, für den Estnischen Staat eine billige Wohnung mit einer guten Adresse zu finden, die obendrein noch möbliert sein sollte.
Als sie unsere Wünsche hörten, wurden die Makler nervös, schauten zur Seite und einem nicht mehr in die Augen, gähnten mit geschlossenem Mund und trugen alle Zeichen von Desinteresse zur Schau, mit einem Wort, sie verwendeten jene Codes und Geheimsprachen, die keinerlei Erklärungen bedurften.
Die große Wohnungssuche in Rom war nicht bloß eine Wohnungssuche, vielleicht war es auch die Suche nach dem verlorenen Zuhause, denn Estland ist das Land des verlorengegangenen Zuhauses, das Land von in Todesangst verlassenen und mit Gewalt fortgenommenen Heimstätten. Später sieht man dann nur noch den Schornsteinsockel im Gebüsch, bestenfalls findet man einen Brunnenstandort und Steine des Fundaments, mehr nicht. Aber man weiß nicht mehr, wem sie einst gehörten und wo der geblieben ist, dem sie gehörten. Die alten Fliederbüsche und die alten Apfelbäume werden vom neuen Besitzer gefällt. Die Wurzeln werden gekappt, was war, ist vorbei. Aber in der Luft wirbeln Verwünschungen umher wie Querschläger. Man geht ihnen lieber aus dem Weg.
In Rom, der Ewigen Stadt, fällt einem das alles ein. Kein Zufall, dass ich gerade in Rom diese Zeilen schrieb:
»Und doch haben die Esten eine gemeinsame und auffällige Eigenschaft – Heimweh. Das ist ein Thema, das die estnische Dichtung und die Volkslieder durchzieht, die Literatur und die Journalistik. Möglicherweise ist es durch die historischen Erschütterungen des zwanzigsten Jahrhunderts noch verstärkt worden – durch die sibirischen Straflager und die Flüchtlingslager Deutschlands, aber seine Wurzeln liegen tiefer, irgendwo in einer Zeit, als der Este noch ein in ein fremdes, fernes nördliches Land geratener schottischer Soldat, dänischer Seemann oder schwedischer Umsiedler war, der sich in der Stunde der Dämmerung zurücksehnte nach seiner fernen Heimat. Von dem Moment an, in dem er seine Sprache vergessen hatte und an ihre Stelle die estnische trat, war auch der Heimweg vergessen. Dieses Motiv des verlorenen Zuhauses durchzieht die gesamte estnische Kultur.«
Möglicherweise ist der tiefere und unsichtbarere, der unbewusste Grund für alle Umzüge aller Menschen die Suche nach dem verlorenen Zuhause. Vielleicht suchen all die Ausländer, die um die römischen Makler herumschwirrten, nur ihre eigenes verlorenes Zuhause. Wie auch wir. Auch wir brauchten unbedingt eine Fahrkarte für den Nachtzug.
Es war Herbst. Mitte November. Der Regen war vorbei, und die römische Sonne erwärmte wieder den Asphalt und die Treppen. Und sie erwärmte auch jenen kleinen Platz in der Nähe der Via dei Coronari, auf dem ein altes Paar übernachtete. Jeden Abend holten sie ihre Matratzen und Schlafsäcke, ihr Bett, aus dem Versteck und breiteten sie auf dem warmen Asphalt aus.
Die italienischen Obdachlosen unterscheiden sich von den estnischen Obdachlosen wie Tag und Nacht. Sie sind mehrheitlich keine Alkoholiker, und mehrheitlich kümmern sie sich um ihr Äußeres. Ihre Kleidung ist sauberer, und sie stinken nicht. Manchmal kann man neben einem plätschernden Springbrunnen einen Obdachlosen erblicken, der mit Rasiermesser, Pinsel und Handspiegel ausgerüstet ist und sich sorgfältig rasiert.
Mit jedem Tag wurde der schwarze und kühle Schatten länger, die Sonne vermochte den Platz nicht mehr zu erwärmen. Das obdachlose alte Paar schaffte eine Karre herbei und zog mit seinen Matratzen fort. Nahm sein Bett und ging. Offenbar hatten sie einen Ort, wohin sie gehen konnten. Vielleicht zogen sie vom Sommerlager in die Winterwohnung, und vielleicht war dies ein eingespieltes Ritual. Möglicherweise hatten sie irgendwo eine trockene Höhle, in der man auch Feuer machen konnte. In Italien ist es nichts Besonderes, in einer Höhle zu leben. Höhlen gibt’s zur Genüge. Die von den Etruskern gegrabenen Höhlen werden bis heute genutzt.
Der Signore stimmte ein Lied an, während er die Karre schob. Die Signora drückte sich einen Apfelsinenzweig mit einer besonders runden und besonders orangen Apfelsine an die Brust, die sie zärtlich streichelte, als ob es ihr gelungen sei, diese Apfelsine als Höhlenwärmerin mitzunehmen.
Wenn man darüber schreibt und die niedergeschriebenen Sätze noch mal überfliegt, kommt einem das alles sehr dichterisch vor, besonders diese Signora mit ihrer Apfelsine, aber in Wirklichkeit war es so wie immer im Leben, wo die Apfelsine in ein und demselben Moment sowohl Symbol als auch Nahrungsmittel ist, und die Signora selbst hatte nicht die leiseste Ahnung davon. In Estland wären das eine Alte und ein Alter gewesen, in Italien aber waren es il signore und la signora, ihr Schritt war nicht plump, und sie freuten sich darüber, dass sie eine Karre und einen Apfelsinenzweig hatten.
Durch diese Sätze hier mag der Eindruck entstehen, als würde ich das Leben Obdachloser idealisieren und sagen wollen, was fehlt den Obdachlosen denn, schmeiß bloß deine Matratze auf die Karre und ab geht die Post. In Wirklichkeit war ich entsetzt darüber, wie ein schwarzer Schatten den Platz überzog und wie sie sich mit ihrer Karre vor ihm in Sicherheit brachten.
Unsere Wohnung in der Via dei Coronari unterschied sich von dem mit einem schwarzen Schatten überzogenen Platz nicht so sehr, wie man vielleicht annehmen möchte. Wir unterschieden uns von jenen Obdachlosen mit der Karre nicht so sehr, wie man vielleicht annehmen möchte.
Als die Nächte kälter wurden, stellte sich heraus, dass die Heizung falsch eingebaut war und nicht funktionierte. Die ohnehin dämmrigen Zimmer waren nun ganz dunkel. Die Makler breiteten bedauernd die Arme aus.
Schließlich tauchte ein neuer Makler auf, Signor Necci, der über »viele ziemlich gute Adressen« verfügte. Mir kommt es bis heute so vor, als wäre dieser glatte und solide Signor Necci in seinem grauen Mantel mit Fischgrätenmuster aus einem unterirdischen Gang heraus aufgetaucht, aus einer Höhle oder aus Katakomben. Aus einem Tunneleingang. Denn mit ihm ließen wir die schwarze, schmale und alte, in den finsteren Herbstschatten gehüllte Via dei Coronari hinter uns.
Der Signore hatte eine schmale Ledermappe mit Wohnungsplänen unterm Arm und einen Schal um den Hals, der vermutlich teurer war als bei manch anderen der Mantel.
Signor Necci wusste, wie man es machen musste! Er seufzte an Stellen, wo ein Seufzer angebracht war, und er winkte ab, wo Abwinken nötig war. Er stutzte die Flügel, gab aber auch Schwung. Jedes Mal, wenn wir uns mit ihm getroffen hatten, konnten wir beratschlagen: »Was glaubst du, was er damit meinte, als er sagte, dass …?« Oder: »Ich weiß nicht, ob er wirklich kapiert hat, dass es keinen Sinn hat, uns zu teure Dinge zu zeigen …«
In Rom kann man nie wissen, ob die Menschen, die man trifft, überhaupt Wesen aus Fleisch und Blut sind oder Phantome, die sich auf deine Kosten einen Spaß erlauben. In Rom ist alles möglich. Nicht einmal Signor Necci kann sicher gehen, wer zum Scherz seine Gestalt annimmt und Wohnungssuchende mit Wohnungen betört, von denen später niemand etwas gehört haben will.
Wir werden nie erfahren, ob Signor Necci, der eines Tages auf dem schwarzen Basaltpflaster der Via dei Coronari stand, aus dem Nichts auftauchte wie bestimmte Figuren aus einem bekannten Roman von Bulgakow, oder ob er irgendwo auch ein Zuhause hatte mit Kleiderschrank, Esstisch, Frau und Kindern. Anhand seines Mantels, Schals und Blicks war das unmöglich auszumachen.
Der heutige Tag und das Zimmer, in dem ich in diesem Moment im kühlen Frühjahrslicht über diesen römischen Herbsttag schreibe, waren noch Jahre entfernt, dieser Tisch und der Stuhl hier befanden sich in zweitausend Kilometern Entfernung vom Zentrum Roms.
Man darf nicht vergessen, dass damals noch Menschen lebten, die heute längst tot sind. Und sie lebten nicht nur, sondern sie waren aktiv, und ihre Denkungsart gab in der Welt den Ton an. Am Leben waren noch eine ganze Menge Menschen, die an Fortschritt und Wirtschaftswachstum glaubten, an Darwin und Newton, an Antibiotika und Demokratie, an die Gewerkschaftsbewegung und den technischen Fortschritt. An dem, was heute allmählich zu aberwitzigen Märchen verkommt, wurde damals noch nicht so ohne weiteres gezweifelt.
In den Ohren jener Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts klang das Wort »Produktion« noch vielversprechend. Sie waren der Meinung, je mehr Fabriken und Produktionsstätten es gebe, desto besser werde das Leben.
Im zwanzigsten Jahrhundert wurden sogar Tierställe als Fabriken bezeichnet. Es wurden nicht mehr Kühe, Hühner, Schweine oder Schafe gezüchtet, sondern es wurden immer mehr Milch, Fleisch und Eier produziert. Schwache und kranke Tiere wurden verbrannt. Bäume wurden gefällt und Felder betoniert. Es wurden neue Parkplätze und Produktionsgebäude gegründet. Familien reproduzierten neue Arbeitskräfte.
Viel Hoffnung wurde aufs Geld gesetzt. Diese mittlerweile verstorbenen Menschen glaubten bis in ihre Todesstunde ans Geld. Bis sich plötzlich herausstellte, dass man mit Geld gegen den Tod nichts unternehmen kann.
Wer weiterlebte, von dem war Gemurre und Gemecker zu vernehmen. Die Supermärkte waren voll mit Milch, Eiern und Fleisch, aber man traute den Lebensmitteln nicht mehr. Man versuchte herauszubekommen, was in ihnen steckte.
Vor Fleisch und Eiern hatte man regelrecht Angst. Auch Obst und Gemüse fürchtete man. In den Läden konnte man ratlose Menschen erblicken, die einen glänzenden roten Apfel in die Hand nahmen, ihn einen Moment skeptisch von allen Seiten betrachteten, sogar daran rochen, und ihn dann wieder zurücklegten. Dasselbe taten sie mit einer Apfelsine und einer Mandarine, mit einer Birne und einer Möhre. Was gab es viel Angst und Zweifel! Und es griff immer weiter um sich, tut es bis heute.
In England wurden Kühe verbrannt und in Deutschland Schweine. Ständig gingen Menschen verloren. Eine Geschichte, die einstmals in Amerika passiert war, wiederholte sich in Europa, und alle Beteiligten waren wie gehabt ahnungslos. Das längst vergangene Unglück, das sich in der Ferne ereignet hatte, war allen entfallen. Neue Menschen waren herangewachsen. Wieder kamen drei elegante Männer in eine Schule, zeigten ihre Papiere und verkündeten abermals, dass sie für Filmaufnahmen Kinder benötigten. Und dass die Lehrer bis morgen in ihren Klassen die schönsten Kinder auswählen sollten. Am nächsten Tag wurden die schönsten Kinder mit dem Bus fortgebracht. Sie wurden nie wieder gesehen. Die ganze Sache blieb ein Rätsel. Wie auch beim letzten Mal.
Auch entdeckte man eine gefährliche Zecke im Gras, die Krankheit säte. Man bekam Angst vor Wald und Feld. Wer vom Weg ins Gras trat, konnte vom gleichen Grauen erfüllt werden wie beim Anblick einer Spritze in der U-Bahn. Eine Spritze war eine Mordwaffe geworden. Wenn die Angst allzu groß wurde, begann man selbst damit, anderen Furcht einzuflößen. Betrug gab es viel. Demokratie wurde ein Schimpfwort.
Manche empfanden nichts. Sie waren nicht erregt. Sie zogen sich eine Linie rein und ritzten sich oder anderen unter Begleitung des Grölens von Rammstein mi...