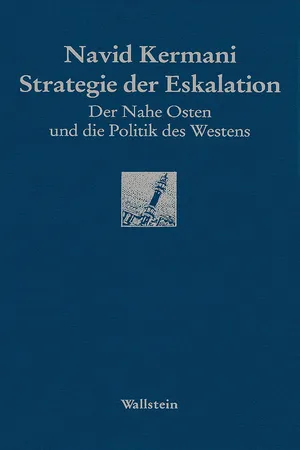![]()
Neujahr 2003
Schwarze, die nicht weiß werden dürfen – Europa und der Nahe Osten
Die Vereinigten Staaten haben die Demokratie entdeckt. In der Propagandaschlacht um den Irak sind amerikanische Regierungsvertreter in den letzten Wochen auf ein neues Argument verfallen: Demokratisieren wollen sie nun den Nahen Osten, generalstabsmäßig wie es Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg mit Deutschland getan habe. Der Irak sei nur der Anfang für eine umfassende Neuordnung der gesamten Region.
Das Problem an dem Vorhaben ist weniger, daß es imperial oder größenwahnsinnig ist, wie es in Europa reflexartig heißt. Das Problem ist, daß niemand es ernst nimmt. Wenn schon kaum ein Verbündeter der Bush-Administration die hehren Worte über die Demokratie glaubt, werden sie im Nahen Osten erst recht nicht verfangen. Immerhin hat sich im kollektiven Gedächtnis der Europäer und speziell der Deutschen bei aller Kritik im Einzelnen die historische Rolle der Vereinigten Staaten als Befreier eingegraben – eine Erfahrung, die dem Nahen Osten fehlt. Dort beschränkte sich das amerikanische Engagement von seinem Beginn an auf die einseitige Unterstützung Israels, die Kontrolle der Ölquellen, den Sturz gewählter Regierungen und das Bündnis mit Diktatoren. Und nun plötzlich Demokratie? Daß Amerika und der Westen insgesamt die Werte – und sei es militärisch – verfechten würden, durch die sie sich selbst definieren, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber schön wäre es, brächte es doch zusammen mit den furchtsamen Europäern auch die nahöstlichen Diktatoren in Begründungsnot, könnten sie sich doch nicht mehr mit Exkursen über die westliche Heuchelei aus der Legitimationsschlinge retten.
Die islamische Welt, so heißt es seit dem 11. September immer wieder, stehe dem Westen zunehmend feindlich gegenüber. Warum hassen sie uns bloß? wird auf Titelseiten scheinbar hilflos gefragt, um sogleich auf die grundlegend andersartigen Werte von Muslimen zu verweisen. Der sanftmütige Intellektuelle verlangt, Verständnis für das Fremde aufzubringen, während der kulturkämpferische Kraftprotz auf die Überlegenheit des eigenen Wertesystems pocht. Beide übersehen, daß sich viele Menschen in der islamischen Welt – nicht anders als in anderen südlichen und östlichen Regionen – sich über den Westen und speziell die Vereinigten Staaten nicht etwa deshalb erregen, weil sie von deren Werten nichts wissen wollen, sondern weil sie den Glauben längst verloren haben, daß der Westen sie ihnen gegenüber tatsächlich vertritt. Der Unmut gründet gerade nicht in einem Gefühl der Überlegenheit, sondern in der Verbitterung über diese Zurückweisung, die immer häufiger ins Ressentiment umschlägt. Das nächstliegende Beispiel hierfür ist die Türkei, die nicht für alle Zeiten darum buhlen wird, zu Europa gehören zu dürfen. Das Wort von den »doppelten Standards«, das allgegenwärtig ist, wo in muslimischen Gesellschaften über den Westen gesprochen oder geschrieben wird, ist ein präziser Ausdruck dieser Enttäuschung. Denn es fordert gerade jene Universalität der grundlegenden humanitären Werte ein, die multikulturelle Optimisten hierzulande leichtfertig in Frage stellen.
Es ist keineswegs so, daß die meisten Iraner, Indonesier, Türken oder Libanesen danach streben, mit möglichst willkürlichen Rechtssystemen, in undemokratischen Verhältnissen und ohne sozialen Ausgleich zu leben. Daß die Demokratie sich in der islamischen Welt bisher selten durchgesetzt hat, hat viele hausgemachte Gründe, unter anderem eine tiefgreifende Krise der religiösen Kultur, aber auch überkommene soziale Strukturen, ökonomische Verwerfungen und vor allem eine fast durchweg katastrophale Situation im Bildungswesen. Der verheerende Bericht, den die Vereinten Nationen Ende 2002 über den Zustand der arabischen Welt vorgelegt haben, ist beklemmend realistisch. Aber wer deswegen die Araber pauschal als unsozial und undemokratisch abschreibt, sollte bedenken, daß der Bericht von arabischen Autoren verfaßt worden ist. Man mag den arabischen Gesellschaften Passivität oder Furchtsamkeit vorwerfen, aber nicht, daß es ihnen noch immer am Bewußtsein der eigenen Zurückgebliebenheit und der fehlenden Demokratie mangelt. Die führenden arabischen Zeitungen haben zuletzt kein brennenderes Thema gehabt.
Blickt man nicht nur auf die arabische Welt (und übersieht nicht die halbwegs funktionierende Demokratie Libanon), dann läßt sich das Klischee, die Muslime seien per se undemokratisch eingestellt, nicht aufrechterhalten. Bangladesch, Indonesien, die Türkei, Iran – in den bevölkerungsreichsten Staaten der islamischen Welt ist die Demokratie auf dem Vormarsch, so vehement sie auch von Diktatoren, religiösen Führern oder Militärs bekämpft wird. Sogar in Kaschmir mit seiner fünfzigjährigen Geschichte der Unterdrückung zeigen Umfragen und Wahlen, daß die Mehrheit der Menschen sich weiterhin für eine friedliche Lösung und gegen den Terrorismus ausspricht. Auch in Pakistan, wo bei den jüngsten Wahlen die Islamisten aus der bisherigen Bedeutungslosigkeit aufgestiegen sind, würde ein Referendum, ob die Menschen in einem Gottesstaat leben wollen, ein klares Votum für die Demokratie ergeben, vermutlich sogar unter vielen Wählern der religiösen Parteien. Und in der arabischen Welt schließlich wirken die Autokraten immer mehr wie anachronistische Gestalten – was nicht zuletzt der beispiellose Erfolg des Debattensenders al-Dschasira vor Augen führt, der mehr zur demokratischen Bewußtwerdung in der arabischen Welt beigetragen hat als alle westlichen Demokratien zusammen. Nein, der Kapitalismus mag sich zwangsläufig und brutal durchsetzen, aber das eigentliche Erfolgsmodell des Westens ist die parlamentarische Demokratie. Kein anderes System übt heute weltweit größere Anziehungskraft aus.
Die Verhältnisse in den genannten Ländern mögen also trotz unübersehbarer Fortschritte noch weit von westlichen Standards entfernt sein, aber die Menschen in der islamischen Welt sind darüber nicht froh, sondern bestürzt oder resigniert, und sie werfen dem Westen nicht seine Werte vor, sondern daß er sie verrät, wenn er Diktaturen, korrupte Regime oder den Terror einer Staatsgewalt deckt. Gewiß geht die Sympathie für Osama bin Laden, die Taliban oder Saddam Hussein über einige extremistische Kreise hinaus, aber die verzweifelte Frage, die einem zwischen Rabat, Teheran und Jakarta weit häufiger begegnet, lautet, warum der Westen diese politischen Monster so viele Jahre unterstützt hat. Wer vom Haß der islamischen Massen auf den Westen schwafelt, der möge zur Probe in den genannten Städten Visa feilbieten: Wäre der Westen dort wirklich so unbeliebt, würde speziell die Jugend kaum lieber heute als morgen dorthin auswandern. Könnte es nicht sein, daß die Terroristen den Westen auch deshalb bekämpfen, weil sie auf seine Wirkung neidisch sind? Wenn die türkische Gerechtigkeitspartei in die Europäische Union drängt, die iranischen Studenten gegen die Taliban an ihrer Staatsspitze demonstrieren oder arabische Intellektuelle die Weltgemeinschaft um Unterstützung im Kampf gegen ihre Diktaturen bitten, dann appellieren sie implizit an einen Mythos globaler Werte, an den man im Westen um so weniger glaubt, je hölzerner die Predigten der Staatsmänner und Leitartikler ausfallen.
Daß die Demokratie und Marktwirtschaft eine Anziehungskraft ausüben, von der die Terroristen nur träumen können, hat mit dem Islam und ob er tolerant ist oder den Werten der Aufklärung entgegensteht, wenig zu tun, vielmehr damit, daß nach dem Ende der großen Ideologien, dem wirtschaftlichen Niedergang in beinah allen Ländern außerhalb der westlichen Wohlstandssphäre und der Häufung und neuen Grausamkeit bewaffneter Konflikte der Mehrheit der Menschen – nicht nur den Muslimen – kaum mehr als die Sehnsucht geblieben ist, ein einigermaßen friedliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Die jungen Menschen, die in der Hoffnung auf ein Visum nachts überall in Hauptstädten der islamischen Welt vor den westlichen Botschaften campieren, tun dies nicht, weil sie Muslime sind. Sie hören aber auch nicht auf, Muslime zu sein, wenn sie im Westen leben wollen. Weder kollidiert der Wunsch, in einem freien, säkularen System zu leben, mit ihrer religiösen Überzeugung, noch leiten sie den Wunsch aus dem Glauben ab. Vielmehr gilt für sie, was für Europäer selbstverständlich ist: Nicht alle ihre Begehren sind durch die Religion determiniert.
Es ist die Obsession des Westens, die Muslime auf den Islam zu reduzieren. Daß sich in der islamischen Welt nur ungenügende demokratische Strukturen herausgebildet haben, läßt sich nicht bestreiten. Aber wer das Problem allein mit dem Islam erklärt, übersieht, daß es kaum irgendwo außerhalb der westlichen Wohlstandsinseln blühende Demokratien gibt. Es gibt in vielen Ländern ein wachsendes Bedürfnis nach Demokratie – das aber ist eine weltweite Bewegung, die im Nahen Osten ebenso zu beobachten ist wie in Südamerika, Osteuropa oder in Süd- und Zentralasien. Die Muslime sind weder undemokratisch, weil sie Muslime sind, noch sind sie demokratisch, weil der Islam die Demokratie einfordert. Wie jede andere Weltreligion hält der Islam Legitimationen für alle erdenklichen gesellschaftlichen Systeme bereit. Ist man Demokrat, wird man die entsprechende Interpretation schon finden, aber ebenso trefflich läßt sich der Sozialismus aus dem Koran ableiten, und daß eine Theokratie islamisch legitimiert werden kann, das haben die Iraner bis zum Überdruß erfahren. Das bedeutet, daß auch der Koran seine gesellschaftliche Funktion erst im Zusammenhang mit anderen Faktoren entfaltet. Damit ist keineswegs gesagt, daß man den religiösen Faktor vernachlässigen darf. Vielmehr geht es darum, auch die Religion in einem säkularen Deutungszusammenhang zu verstehen.
Der westliche Blick auf die islamische Welt ist hier absolut fundamentalistisch: Man schließt von vermeintlich vorgegebenen Normen oder sogar von einzelnen Versen des Korans auf die gesellschaftliche Realität. Würde man diese Logik auf die restliche Welt übertragen, müßte man die Tatsache, daß Lateinamerika bis vor wenigen Jahren durchweg von Militärdiktaturen regiert wurde, allein mit dem Katholizismus begründen, die Chinesen qua Hautfarbe zu Kollektivisten erklären oder die israelische Besatzungspolitik ausschließlich aus der Bibel erklären. Dann wäre es auch nicht mehr weit zu jenen Theorien, die mit der Kriminalitätsstatistik anfangen und damit enden, daß Schwarze eben zu Verbrechen neigen.
Niemand würde die protestantischen Extremisten in Nordirland als Soldaten Luthers bezeichnen oder die Vergewaltigungen muslimischer Frauen, die Schändung muslimischer Friedhöfe in Bosnien, obwohl sie doch unter Berufung auf eine christliche Lehre begangen wurden, mit dem Neuen Testament begründen. Das religiöse Vokabular wird zurecht in einem konkreten gesellschaftlichen, machtpolitischen und nicht zuletzt propagandistischen Zusammenhang wahrgenommen und damit in seinem Wahrheitsanspruch relativiert. Damit wird die religiöse Begründung weder geleugnet noch unterschätzt, aber in einen Kontext mit anderen Faktoren gesetzt und erklärt. Sobald aber an einem Ort zwischen Rabat und Kuala Lumpur eine Bombe explodiert, müssen muslimische Fundamentalisten Allahs Schwert gezückt haben, werden Koranverse angeführt und entschuldigende oder anklagende Urteile über den Islam gefällt. Die säkulare Wahrnehmung des Westens nimmt den Orient aus, der so exemplarisch zum Ort der Religion wird, wo sämtliche kulturellen und politischen Entwicklungen und Ereignisse ursächlich mit dem Glauben erklärt werden müssen. Damit deckt sie sich mit der Wahrnehmung innerhalb des islamischen Fundamentalismus. Auf beiden Seiten wird die Urbegründung jedes Phänomens in der islamischen Welt in den religiösen Quellentexten angesiedelt, eine durch und durch normative Haltung, die sich in bezug auf die Geschichte und Gegenwart der westlichen Welt sofort diskreditieren würde. Der islamistische Slogan »Der Islam ist die Lösung!« ist nichts anderes als die Kehrseite des Slogans »Der Islam ist die Bedrohung!«
Trauriges Beispiel für einen solchen Fundamentalismus ist die Debatte um die Türkei. Es gibt viele Gründe, die für und gegen einen Beitritt sprechen. Die Türkei ist kein baltischer Zwergstaat. Sie grenzt an Krisenregionen, ist wirtschaftlich unterentwickelt und weist noch immer erhebliche demokratische Defizite auf. Natürlich hätte ein Beitritt auch Vorteile: Neue Märkte würden entstehen, die Einflußsphäre Europas würde sich ausweiten und vieles andere mehr. Der Türkei ist der Beitritt schließlich nicht aus Gründen der Entwicklungshilfe in Aussicht gestellt worden, sondern weil sich die europäischen Regierungen Vorteile davon versprachen. Aber anstatt die verschiedenen Aspekte kühl und im Sinne eigener, materieller Interessen abzuwägen, argumentieren beinah alle Diskutanten mit der Kultur: Ist der Islam mit den Werten Europas vereinbar? »Niemals!«, rufen die Gegner und zitieren eifrig Verse aus dem Koran. »Aber natürlich!«, rufen die Befürworter und verweisen auf das städtische Leben in Istanbul oder Ankara, das sich innerhalb eines europäischen Koordinatensystems bewegt. Wäre die türkische Wirklichkeit allein aus dem Koran abzuleiten, hätten die Gegner recht: Ein solches Land hätte im europäischen Wertesystem keinen Platz, sowenig wie ein christliches Land, das allein mit Bibelversen zu verstehen wäre. Doch verschweigen auf der anderen Seite der Debatte die Befürworter allzu gern, daß man sich außerhalb der Städte und zumal in den Dörfern Anatoliens tatsächlich auf einem anderen Kontinent wähnen mag. Das aber heißt, daß die Grenze Europas, wenn man den Begriff einmal so emphatisch gebrauchen darf, nicht zwischen Christentum und Islam, sondern mitten durch die Türkei selbst verläuft, zwischen dem, was die türkische Soziologin Nilüfer Göle die »weiße« und »schwarze« Türkei nannte. Die »weißen« Türken haben nicht aufgehört, Muslime zu sein, vielmehr handelt es sich um eine bittere, aber zutreffende soziale Kategorisierung, die bis vor zwei, drei Jahrzehnten auf Spanien oder Griechenland anzuwenden gewesen wäre. Anwenden läßt sie sich aber auch auf die Muslime in Deutschland, die in der ersten Generation zumeist aus ländlichen Gegenden stammen. Die Schwierigkeiten, sich in eine städtische, industrialisierte Welt einzugewöhnen, sind zum großen Teil die gleichen, wie sie als Folge der Landflucht überall in den Metropolen der islamischen Welt zu beobachten sind. Einem Angehörigen der Istanbuler, Beiruter oder Teheraner Mittelschicht sind die Gewohnheiten und Wertvorstellungen eines anatolischen oder belutschorischen Dorfbewohners kaum weniger fremd als den meisten Deutschen. Die deutschen Probleme mit der Integration wären daher weit unscheinbarer, stammte das Gros der muslimischen Einwanderer aus den Städten. So wird immer wieder verwundert vermerkt, daß Migranten aus dem Libanon oder aus Iran in großer Zahl in die Bildungs- oder Wirtschaftseliten ihrer neuen Heimat vorstoßen. Das liegt gewiß nicht an ihrem Abfall vom Islam, sondern erklärt sich daraus, daß sie bereits in der alten Heimat Angehörige privilegierter, bürgerlicher Schichten waren.
Schon das Wort vom »Dialog der Kulturen« ist die schiere Ideologie: Als ob da zwei Subjekte wären, der Islam und der Westen, die sich nun endlich verstehen müßten. Wo, bitteschön, müßten in diesem Gesprächskreis die westlichen Muslime Platz nehmen, die Bosnier zum Beispiel oder die zweite und dritte Generation der muslimischen Einwanderer? Wo wäre der Platz des arabischen Bürgertums, der orientalischen Christen, der Intellektuellen, die mit Paris im Kopf anstatt mit Mekka groß werden. Nein, der Dialog der Kulturen ist eine Karikatur. Das Problem ist allerdings, daß sich solche Karikaturen in immer mehr Köpfen festsetzen und dann zu politischem oder gar militärischem Handeln führen. Nicht bloß Osama bin Laden hat die starre Dichotomie der Kulturen verinnerlicht. Auch in Europa wird die eigene Kultur zunehmend essentialisiert, als eine eigenständige anthropologische Größe gedacht, die unabhängig von den Menschen existiert und wirkt.
Europa ist ein säkulares Projekt, das sich in seinen selbstverschuldeten Katastrophen zu seiner jetzigen Gestalt und Anziehungskraft herausgeschält hat. Auf der expliziten Glaubensneutralität des Projektes, wie es sich aus der Französischen Revolution herleitet, zu beharren, bedeutet nicht, den religiösen (allerdings keineswegs ausschließlich christlichen) Ursprung vieler europäischer Werte zu verleugnen. Aber es sind Werte, die säkularisiert, also im Laufe der Zeit innerweltlich begründet worden sind. Von nichts anderem sprechen die zahlreichen islamischen Reformdenker, die sich nicht mehr mit der Frage aufhalten, ob etwa die Menschenrechte koranisch seien, sondern sie aus der menschlichen Vernunft ableiten – und damit unterstreichen, daß es Normen außerhalb des Religiösen gibt. Wer mit der Rede vom christlichen Abendland ein islamisches Land per se für uneuropäisch erklärt, verkennt nicht nur die europäische Geschichte, die mit Andalusien und dem Osmanischen Reich intellektuell und geographisch eine zentrale islamische Präsenz hatte und zu immerhin drei mehrheitlich muslimischen Ländern auf europäischem Boden geführt hat. Er macht aus Europa eine Religion, beinah eine Rasse und stellt damit das Vorhaben der europäischen Aufklärung auf den Kopf. Denn dieses gewinnt seine Unverwechselbarkeit gerade dadurch, daß es eine weltliche, prinzipiell allen Bürgern offene Willensgemeinschaft propagiert. Gerade weil die europäischen Werte säkular sind, sind sie an keine bestimmte Herkunft oder Religion gebunden, sondern lassen sich prinzipiell übertragen. Die radikale Offenheit ist ein Wesensmerkmal des europäischen Projektes und sein eigentliches Erfolgsgeheimnis: In allen Kulturen gibt es führende geistige Bewegungen, die genau diese Übersetzung immer wieder neu angehen, etwa indem sie die Demokratie oder die Menschenrechte in ein chinesisches, schwarzafrikanisches oder eben islamisches Vokabular überführen. Das geschieht im Islam (nicht anders als in der übrigen »Dritten Welt«) mit noch begrenztem Erfolg, aber mit wachsender Intensität. Der Terrorismus ist auch eine Reaktion auf diesen geistigen Umbruch. Nirgends ist es ihm gelungen, die Massen für sich zu gewinnen. Im Gegenteil: Als Kabul von den Taliban befreit wurde, kam es zu Fr...